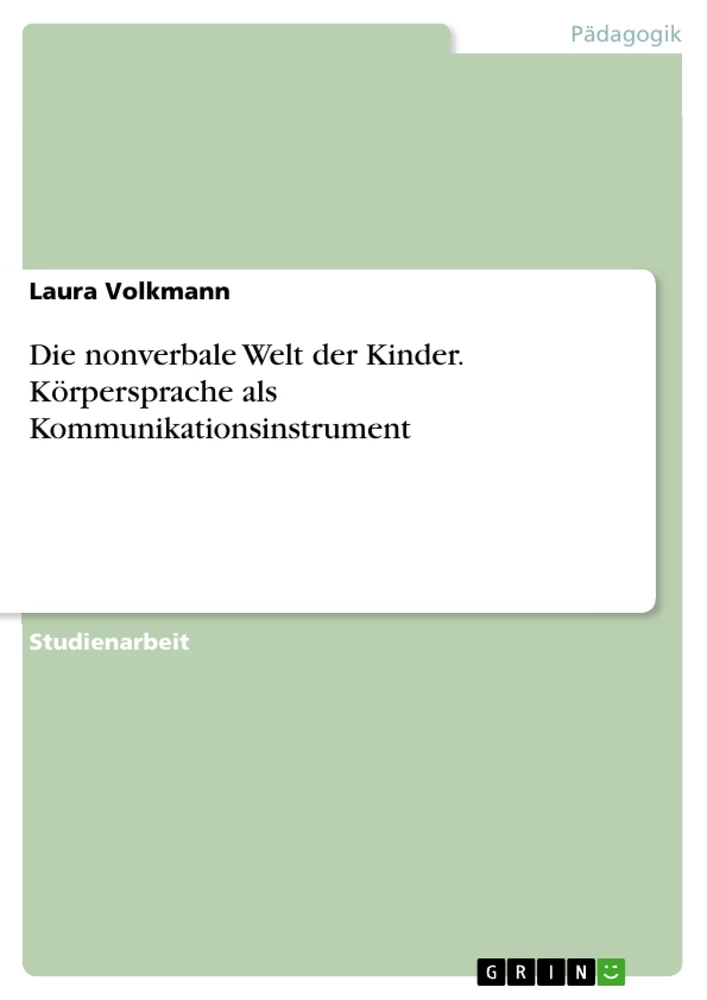Ziel dieser Arbeit ist es, speziell auf die Kommunikation von Kindern einzugehen, da sich Körpersprache bereits im Kindesalter entwickelt und dadurch der Grundstein für spätere Kommunikation gelegt wird.
Des Weiteren war es meine Absicht darauf einzugehen, wie Körpersprache in der Schule eingesetzt werden kann.
Im ersten Teil der Arbeit wird die Körpersprache theoretisch beleuchtet, ein exemplarisches Kommunikationsmodell vorgestellt sowie auf die verschiedenen Kommunikationsformen eingegangen, die es bei der Körpersprache gibt.
Der zweite Teil betrachtet die Körpersprache praktisch. Hier wird auf die Besonderheiten kindlicher Kommunikation Bezug genommen und Fragen geklärt, wie beispielsweise wann, wie und wodurch Körpersprache entwickelt wird.
Außerdem wird die Frage erörtert, wie Körpersprache helfen kann, Kinder und deren Gefühle besser zu verstehen.
Im dritten Teil wird zur Praxis Bezug genommen und die Körpersprache im Unterricht beleuchtet:
Wo, wann und wie äußert sich Körpersprache im Unterricht? Kann sie verfeinert werden und wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es hierfür?
Hier werden Beispiele genannt, welche in den Unterricht eingebaut werden können, um das Thema Körpersprache mit den Schülerinnen und Schülern zu behandeln. Ein Beispiel soll dann anhand eines Unterrichtsentwurfes als didaktisch-methodische Analyse genauer ausgeführt werden.
Der Schluss beinhaltet ein Fazit, welches die vorigen Beispiele bewertet und eine kurze Zusammenfassung bietet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Körpersprache theoretisch betrachtet
- Nonverbales Kommunikationsmodell
- Die Kommunikationsformen der Nonverbalen Kommunikation
- Gestik
- Mimik
- Blickkontakt
- Körperhaltung
- Körpersprache praktisch betrachtet
- Körpersprache bei Kindern
- Nonverbale Kommunikation - von Anfang an
- Vor der Geburt
- Bei der Geburt
- Nach der Geburt
- Im Säuglingsalter
- Kleinkind- und Vorschulalter
- In der Schulzeit
- Körpersprache von Kindern
- Körpersprache als Hilfsmittel, Kinder zu verstehen.
- Körpersprache - Ausdrucksform von Gefühlen
- Körpersprache und Schule
- Exemplarische Beispiele zum Thema Körpersprache im Unterricht
- Möglicher Unterrichtsentwurf zum Thema Körpersprache entdecken
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der nonverbalen Kommunikation von Kindern, speziell mit Körpersprache als wichtiges Kommunikationsinstrument. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Bedeutung von Körpersprache im Kindesalter und deren Rolle im schulischen Kontext. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für kindliche Kommunikationsformen zu entwickeln und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Körpersprache im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden kann.
- Entwicklung und Bedeutung von Körpersprache im Kindesalter
- Nonverbale Kommunikationsmodelle und ihre Anwendung auf kindliche Kommunikation
- Körpersprache als Mittel zum Verstehen von Kindern und deren Gefühlen
- Der Einsatz von Körpersprache im Unterricht und mögliche didaktische Ansätze
- Bedeutung der Körpersprache für die Interaktion zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz nonverbaler Kommunikation für das Verständnis kindlicher Interaktion. Das zweite Kapitel beleuchtet die Körpersprache aus theoretischer Sicht, indem es ein Kommunikationsmodell vorstellt und die verschiedenen Kommunikationsformen der nonverbalen Kommunikation wie Gestik, Mimik, Blickkontakt und Körperhaltung analysiert. Im dritten Kapitel wird die Körpersprache praktisch betrachtet. Hier werden die Besonderheiten kindlicher Kommunikation beleuchtet, die Entwicklung der Körpersprache im Kindesalter beschrieben und Möglichkeiten aufgezeigt, wie Körpersprache helfen kann, Kinder und deren Gefühle besser zu verstehen. Das vierte Kapitel widmet sich der Anwendung von Körpersprache im Unterricht. Es werden exemplarische Beispiele für den Einsatz von Körpersprache im Unterricht vorgestellt, ein möglicher Unterrichtsentwurf zum Thema Körpersprache analysiert und mögliche didaktische Ansätze diskutiert.
Schlüsselwörter
Körpersprache, nonverbale Kommunikation, Kinder, Entwicklung, Schule, Unterricht, Kommunikation, Kommunikationsmodell, Gestik, Mimik, Blickkontakt, Körperhaltung, Gefühle, didaktische Ansätze, Interaktion
Häufig gestellte Fragen
Wann beginnt die Entwicklung der Körpersprache bei Kindern?
Die nonverbale Kommunikation beginnt bereits vor der Geburt. Nach der Geburt ist sie im Säuglings- und Kleinkindalter das primäre Mittel, um Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken.
Welche Formen der nonverbalen Kommunikation gibt es?
Dazu gehören die Mimik (Gesichtsausdruck), Gestik (Handbewegungen), Blickkontakt und die Körperhaltung.
Wie kann Körpersprache Lehrkräften in der Schule helfen?
Sie dient als Hilfsmittel, um die Gefühle von Kindern besser zu verstehen, auch wenn diese noch nicht verbalisiert werden können. Zudem ist sie ein wichtiges Instrument für die Interaktion und Klassenführung.
Kann man Körpersprache im Unterricht gezielt thematisieren?
Ja, durch didaktische Ansätze und spezielle Übungen können Schüler dafür sensibilisiert werden, ihre eigene Körpersprache und die ihrer Mitmenschen bewusster wahrzunehmen und zu verfeinern.
Warum ist Blickkontakt bei Kindern so wichtig?
Blickkontakt ist eine fundamentale Form der Beziehungsaufnahme und signalisiert Aufmerksamkeit sowie soziale Verbundenheit.
- Arbeit zitieren
- Laura Volkmann (Autor:in), 2015, Die nonverbale Welt der Kinder. Körpersprache als Kommunikationsinstrument, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/423572