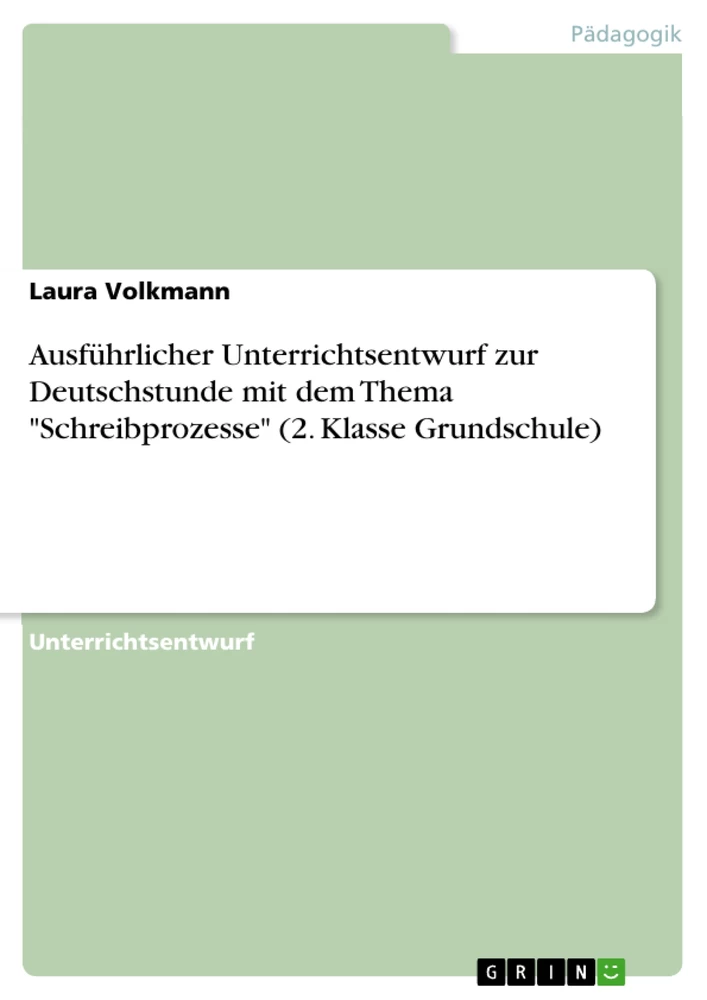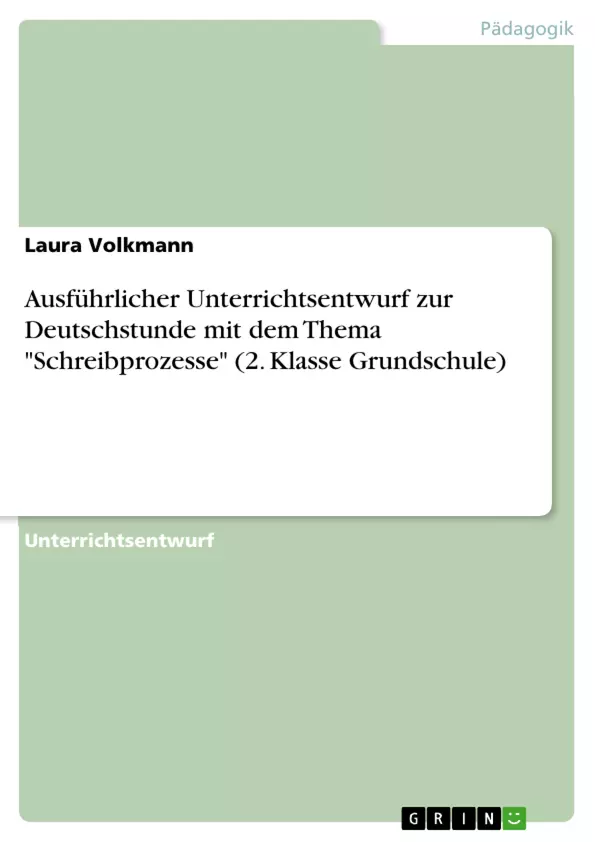Dieser ausführliche Unterrichtsentwurf wurde zu einer Deutschstunde in einer 2. Klasse geschrieben. Das Thema der Stunde waren Schreibprozesse.
In der Klasse 2b, der Grundschule, sind 15 Kinder. Davon sind lediglich fünf Kinder Jungen. Auf Grund des Mädchenüberhanges handelt es sich bei der Klasse 2b um eine sehr ruhige, liebe und motivierte Klasse. Lediglich eines der Kinder besitzt einen Migrationshintergrund, weshalb es im Fach Deutsch, im Vergleich zu ihren Klassenkameraden, Probleme aufweist. Sch.1 ist sehr viel langsamer als ihre Klassenkameraden und hat große Probleme Wörter korrekt zu verschriften. Sie besucht die zweite Klasse nun zum zweiten Mal, hat jedoch immer noch Probleme damit, Wörter lautgetreu zu verschriften. Häufig verfällt sie in eine skelettartige Schreibung zurück.
Inhaltsverzeichnis
- Bedingungsanalyse
- Soziokulturelle Voraussetzungen
- Fachliche Voraussetzungen und Entwicklungsstand der SuS
- Methodische Voraussetzungen
- Institutionelle Voraussetzungen
- Sachanalyse
- Sachstruktur
- Didaktische Analyse
- Methodische Analyse
- Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, den Schülern der zweiten Klasse ein tieferes Verständnis des Schreibprozesses zu vermitteln. Der Fokus liegt auf der Erkenntnis, dass Schreiben nicht nur eine mechanische Handlung ist, sondern ein kreativer Prozess, der es ermöglicht, eigene Gedanken und Ideen zu formulieren und zu kommunizieren.
- Die Bedeutung von Schrift als Werkzeug zur Informationsvermittlung und -bewahrung.
- Die Rolle von Schreibprozessen bei der Entwicklung von Texten und Geschichten.
- Die Bedeutung von Planung und Vorbereitung im Schreibprozess.
- Die Vielfältigkeit von Schreibstilen und individuellen Schreibweisen.
- Die Förderung der Kreativität und des selbstständigen Lernens im Schreibprozess.
Zusammenfassung der Kapitel
Bedingungsanalyse
Dieses Kapitel analysiert die soziokulturellen, fachlichen, methodischen und institutionellen Voraussetzungen der Klasse 2b im Hinblick auf die Thematik "Schreibprozesse". Es wird ein Überblick über die Zusammensetzung der Klasse, den Entwicklungsstand der Schüler im Fach Deutsch und die methodischen Präferenzen der Klasse gegeben. Die Analyse bezieht sich auf die spezifischen Bedürfnisse und Lernvoraussetzungen der Schüler, um einen optimalen Unterricht zu gewährleisten.
Sachanalyse
Das Kapitel "Sachanalyse" beschäftigt sich mit der Struktur und Bedeutung des Begriffs "Schreiben". Es wird erläutert, wie Schrift als Medium der Kommunikation dient und wie Schreibprozesse die Schüler in die Lage versetzen, eigene Gedanken und Ideen auszudrücken. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Geschichten als schriftsprachliche Einheiten und der Fähigkeit, durch Textproduktion Bedeutungen zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Schreibprozesse, Textproduktion, Schrift, Kommunikation, Geschichte, Planung, Kreativität, Individualität, Lernförderung, Grundschule, Deutschunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer Deutschstunde zum Thema Schreibprozesse in der 2. Klasse?
Ziel ist es, den Schülern zu vermitteln, dass Schreiben ein kreativer Prozess zur Formulierung eigener Gedanken ist, und sie über die rein mechanische Verschriftung von Wörtern hinaus zur Textproduktion zu führen.
Welche fachlichen Voraussetzungen sollten Zweitklässler für Schreibprozesse mitbringen?
Die Schüler sollten in der Lage sein, Wörter weitgehend lautgetreu zu verschriften. In der 2. Klasse beginnt zudem der Übergang von Einzelsätzen hin zur Strukturierung kleinerer Geschichten.
Wie kann man Kinder mit Migrationshintergrund beim Schreiben fördern?
Wichtig ist eine individuelle Unterstützung, da diese Kinder oft noch Probleme mit der lautgetreuen Schreibung haben. Hilfsmittel wie Bildkarten oder Wortspeicher können helfen, Sprachbarrieren zu überwinden.
Warum ist die Planung im Schreibprozess so wichtig?
Planung hilft den Schülern, ihre Gedanken zu ordnen, bevor sie mit dem Schreiben beginnen. Dies reduziert die kognitive Belastung und führt zu strukturierteren Texten.
Was versteht man unter „skelettartiger Schreibung“?
Dabei werden beim Schreiben nur die markantesten Konsonanten eines Wortes notiert (z.B. „Hnd“ für Hund). Die Förderung im Unterricht zielt darauf ab, diese Phase zu überwinden und zur vollständigen Laut-Buchstaben-Zuordnung zu gelangen.
- Quote paper
- Laura Volkmann (Author), 2015, Ausführlicher Unterrichtsentwurf zur Deutschstunde mit dem Thema "Schreibprozesse" (2. Klasse Grundschule), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/423590