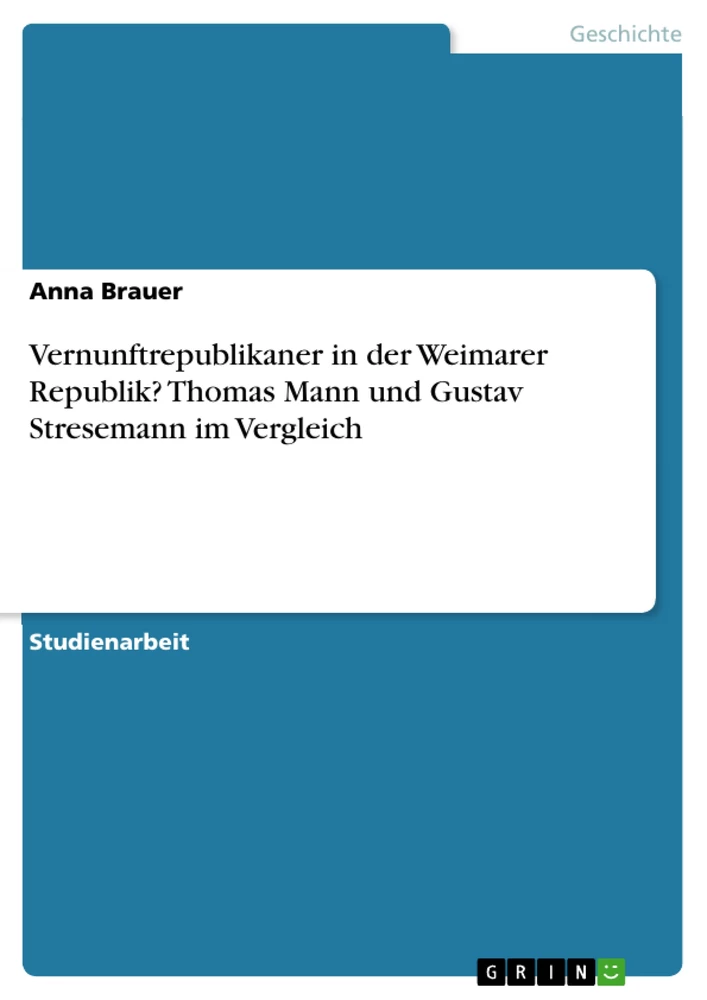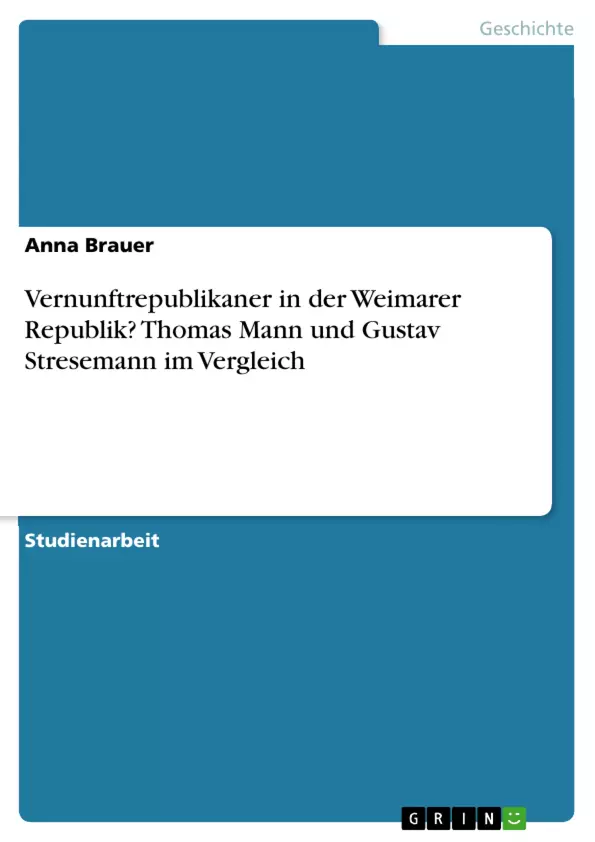Ziel dieser Hausarbeit ist es, Thomas Mann und Gustav Stresemanns politisches Leben miteinander zu vergleichen und aufzuzeigen, ob und inwiefern das Prädikat des Vernunftrepublikaners auf Mann und/oder auch auf Stresemann zutrifft. Hierzu wird zunächst Manns und Stresemanns politische Entwicklung nachgezeichnet und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten aufgezeigt. Auf eine vollständige Nennung aller Ämter, Gremien und Tätigkeiten, welche Stresemann inne hatte beziehungsweise ausführte, wird verzichtet, da es den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen würde. Beispielhaft werden nur einige herausragende Stationen genannt, welche nötig sind, um diesen Vergleich zu ermöglichen. Der Vergleich beschränkt sich auf den Zeitraum von Thomas Manns Geburtsjahr 1875 bis zu Gustav Stresemanns Tod 1929.
Als Grundlage dienten neben Ekkehart Baumgartners "Frühe Lebenskrise und Ursprung künstlerischer Produktivität: Thomas und Heinrich Mann, Hermann Hesse und Robert Musil, Franz Kafka und Rainer Maria Rilke im Vergleich" auch Julia Schölls "Einführung in das Werk Thomas Manns2 sowie Wilhelm von Sternburgs "Gustav Stresemann".
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familie und Jugend
- Thomas Mann
- Gustav Stresemann
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Der Erste Weltkrieg
- Thomas Mann
- Gustav Stresemann
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Die Weimarer Republik
- Thomas Mann
- Gustav Stresemann
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit verfolgt das Ziel, das politische Leben von Thomas Mann und Gustav Stresemann zu vergleichen und zu untersuchen, ob und inwiefern das Attribut des Vernunftrepublikaners auf beide Personen zutrifft. Die Arbeit zeichnet die politische Entwicklung beider Persönlichkeiten nach und beleuchtet Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
- Politische Entwicklung von Thomas Mann und Gustav Stresemann
- Der Einfluss von Familie und Jugend auf die politische Haltung beider Persönlichkeiten
- Die Haltung von Thomas Mann und Gustav Stresemann zum Ersten Weltkrieg
- Die Rolle von Thomas Mann und Gustav Stresemann in der Weimarer Republik
- Die Frage, ob und inwiefern Thomas Mann und/oder Gustav Stresemann als Vernunftrepublikaner bezeichnet werden können
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel "Familie und Jugend" beschreibt die frühen Lebensumstände von Thomas Mann und Gustav Stresemann und beleuchtet den Einfluss von Familie und Jugend auf ihre politische Entwicklung. Der Erste Weltkrieg und die Weimarer Republik werden in den folgenden Kapiteln betrachtet. Dabei wird jeweils die politische Haltung von Thomas Mann und Gustav Stresemann zu den jeweiligen Ereignissen und Herausforderungen dargestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Hausarbeit sind die politische Entwicklung von Thomas Mann und Gustav Stresemann, die vergleichende Analyse ihrer politischen Haltungen, der Einfluss von Familie und Jugend auf die politische Entwicklung, die Rolle des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Republik, sowie die Frage, ob und inwiefern Thomas Mann und/oder Gustav Stresemann als Vernunftrepublikaner bezeichnet werden können.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein "Vernunftrepublikaner"?
Ein Vernunftrepublikaner ist jemand, der die Republik nicht aus emotionaler Überzeugung ("Herzensrepublikaner"), sondern aus rationaler Einsicht in die politische Notwendigkeit unterstützt.
Gilt Thomas Mann als Vernunftrepublikaner?
Ja, Thomas Mann wandelte sich vom monarchistisch gesinnten Autor zum Unterstützer der Weimarer Republik, vor allem um die Kultur vor dem Chaos zu bewahren.
War Gustav Stresemann ein Vernunftrepublikaner?
Stresemann war ursprünglich Monarchist, erkannte aber als Außenminister und Kanzler, dass nur die Stabilisierung der Republik Deutschlands internationale Lage verbessern konnte.
Welche Gemeinsamkeiten hatten Mann und Stresemann?
Beide stammten aus dem bürgerlichen Milieu, waren anfangs national-konservativ eingestellt und stellten sich später aus pragmatischen Gründen hinter die junge Demokratie.
Wie beeinflusste der Erste Weltkrieg ihre politische Haltung?
Der Krieg und die anschließende Niederlage führten bei beiden zu einer tiefen Krise und der Erkenntnis, dass das alte Kaiserreich nicht mehr restaurierbar war.
Bis zu welchem Zeitpunkt vergleicht die Arbeit die beiden Personen?
Der Vergleich beschränkt sich auf den Zeitraum bis zum Tod von Gustav Stresemann im Jahr 1929.
- Quote paper
- Anna Brauer (Author), 2016, Vernunftrepublikaner in der Weimarer Republik? Thomas Mann und Gustav Stresemann im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/423676