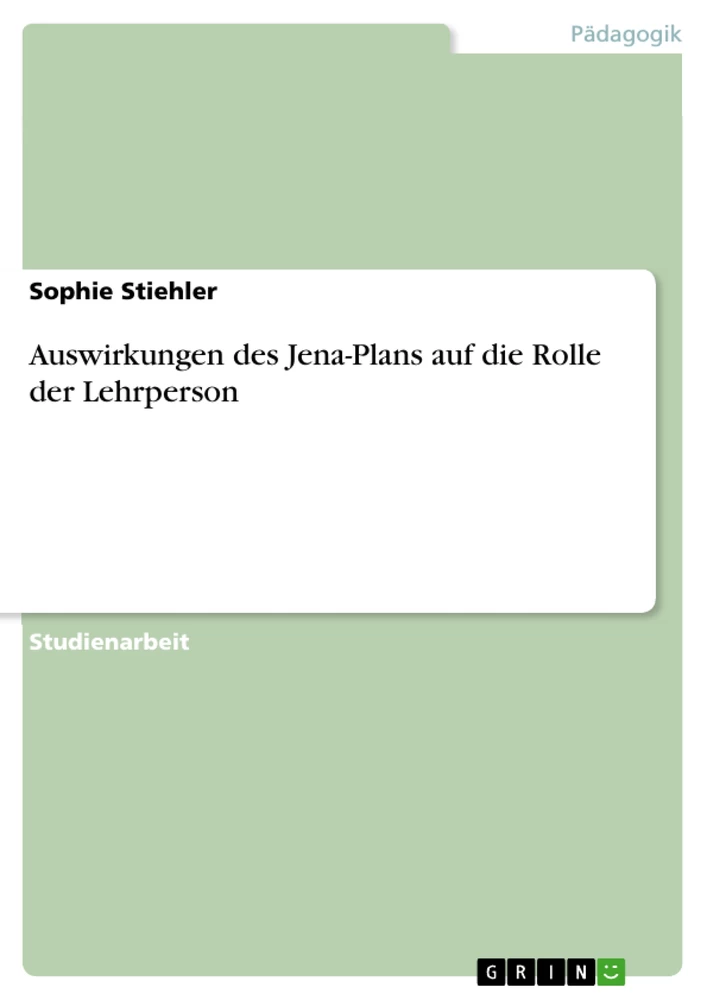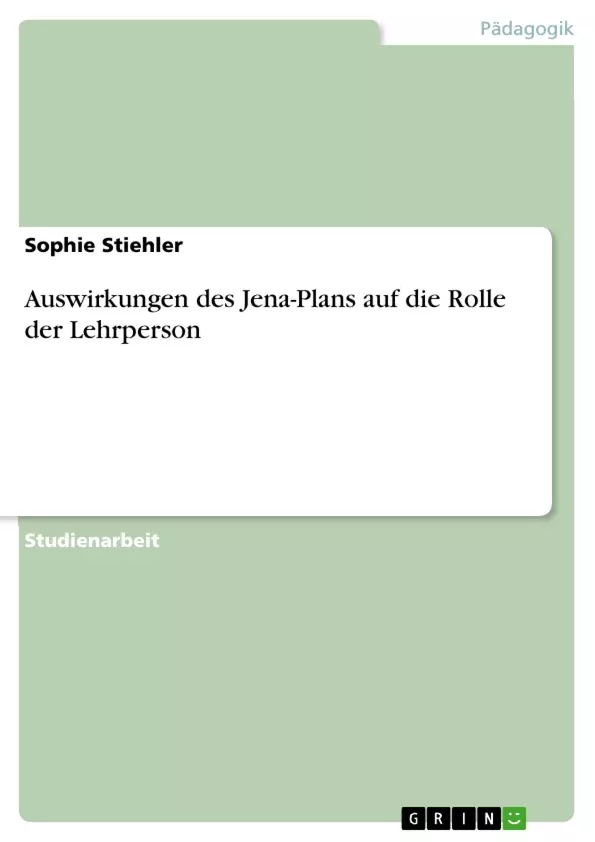Im Jena-Plan werden Tätigkeiten von Kindern in kindgerechter rhythmischer Folge über Tag und Woche (auch über das Jahr) hinweg angeordnet, die so eine günstige Voraussetzung für Aufmerksamkeit, Interesse und Erfolg des Kindes bilden.
Das Ziel ist die Weltorientierung und der Anspruch sich in variablen Situationen mit einmal gemachten Erfahrungen, angeeigneten Fähigkeiten und Fertigkeiten zurechtzufinden. Damit soll ein wesentlicher Anspruch in einem Zeitalter sich ständig verdoppelnder Wissensfakten an die Bildungsinstitution Schule erfüllt werden.
Inhalt
1 Definitionen
2 Der Wochenplan nach Jena-Plan
3 Veränderte Rolle der Lehrperson
4 Literaturverzeichnis
1 Definitionen
Jena-Plan: Im Jena-Plan werden Tätigkeiten von Kindern in kindgerechter rhythmischer Folge über Tag und Woche (auch über das Jahr) hinweg angeordnet, die so eine günstige Voraussetzung für Aufmerksamkeit, Interesse und Erfolg des Kindes bilden.
Das Ziel ist die Weltorientierung und der Anspruch sich in variablen Situationen mit einmal gemachten Erfahrungen, angeeigneten Fähigkeiten und Fertigkeiten zurechtzufinden. Damit soll ein wesentlicher Anspruch in einem Zeitalter sich ständig verdoppelnder Wissensfakten an die Bildungsinstitution Schule erfüllt werden. (vgl. Herker o.J., S.3)
2 Der Wochenplan nach Jena-Plan
Allgemein vorherrschendes Verständnis vom Wochenplan:
Es werden lediglich wenige, zumeist inhaltlich sehr unterschiedliche und nach Fächern getrennte Aufgaben in schriftlich fixierter Form dem Kind ausgehändigt. Das Kind darf die Bearbeitung in eng gesetzten Grenzen eigenständig gestalten (Wahl des Arbeitstempos, der Abfolge der Aufgaben, des Partners).
Im Jena-Plan Wochenplan gilt es unterschiedlichen Aktivitäten nach lernhygienischen und pädagogischen Kriterien und Interessen nachzugehen, die so Spannung erzeugen und echten Fragen führen. Dementsprechend sollte Schule und auch Unterricht, damit er von Schülern als signifikant erlebt wird, stärker auf das Interesse der Schüler ausgelegt werden (vgl. Seitz, Hauptmann, Hezdel, & Neumann, o.J., S.123).
Nach dem inklusiven Prinzip darf kein Kind zu kurz kommen, nicht das leistungsstarke, das schwache oder behinderte Kind. Insofern wird das Lernen in den vorgesehenen Phasen zum individuell bedeutsamen und lebensbedeutsamen Lernen. Die derzeitige Lebenswelt der Kinder legt die Betonung von Primärerfahrungen während des Unterrichts nahe, das Material des Lernens ist zuerst das Leben selbst, nicht das Lernmaterial (vgl. Seitz, Hauptmann, Hezdel, & Neumann, o.J., S.124).
Leitgedanken:
- Wochenplan statt Stundenplan (rhythmisches Freiarbeiten)
- Unterricht in Stammgruppen statt Jahrgangsklassen
- Attraktive Arbeitsmittel
- Präsentation von Arbeitsergebnissen
- Beurteilen (ohne Noten),
- Intensives Einbeziehen der Eltern ins Schulgeschehen
- Feiern und Schulwohnstube
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1 Skiera, E. 1985, S.78
- „der Wochenplan gibt an, wie durch Gesprächs-, Spiel-, Arbeits- und Feiersituationen nach einer rhythmischen Ordnung gestrebt wird, wobei der Wochenplan aus pädagogischen Gründen flexibel gehandhabt wird
- Der Montagmorgen beginnt mit Feier und Gespräch, als Übergang vom Wochenende zu den Werktagen
- Im Wochenplan ist eine Anzahl von Blockperioden aufgenommen. Eine Blockperiode bzw. freies Arbeiten hat eine Dauer von ungefähr 100 Minuten. Darin bestimmen die Kinder, innerhalb der Grenzen, die in gemeinsamer Absprache zwischen Gruppenleiter und Kindern festgelegt wird, was sie tun, auf welche Weise, ob allein oder mit anderen, an welchem Ort, um (zusammen)arbeiten zu lernen und Verantwortung für die eigene Arbeit zu entwickeln.
- Die letzte Schulzeit (Freitagmittag) endet mit Gespräch und Feier als Übergang zum Wochenende.
- Der Wochenplan gibt für die letzte Schulzeit eine Periode für freies Arbeiten an. Darin kann man zur Evaluierung und Abrundung aller Tätigkeiten kommen, für die das Kind in dieser Woche Verantwortlichkeit auf sich genommen hat.“(Skiera, E. 1985 S.78)
3 Veränderte Rolle der Lehrperson
Jenaplan-Pädagogik vollzieht sich vor allem in den Herzen der Lehrerinnen und Lehrer selbst. Folglich sind sie für "ihre" Kinder da (und nicht zuerst für Schulrat, Rektor, Lehrplan, Eltern), hören auf sie, sehen nach ihnen, verstehen und tolerieren (ohne alles zu akzeptieren), setzen sich für sie ein und wenden Zeit und Arbeit für sie auf. ((vgl. Seitz, Hauptmann, Hezdel, & Neumann, o.J., S.138)
Der Jena-Plan betont vor allem die Bedeutung des Menschen, der Kinder unterrichtet und erzieht, als Begleiter, als Helfer und als Vorbild. (vgl. Seitz, Hauptmann, Hezdel, & Neumann, o.J., S.111). Ganz im Gegensatz zum traditionellen Bild der Lehrperson, welche als „Wissende/r“ den „unwissenden“ Schülern und Schülerinnen sämtliches Wissen vermittelt setzt der Jena-Plan daran, dass die Kinder sich selbst oder mit Hilfe anderer ihre Fragen beantworten und selbständig lernen. (vgl. Largo, 2010, S.133, 134)
Die KPH Graz zeigt in ihrem Praxisbeispiel einen möglichen Ansatz. Die Lehrpersonen stellen das Thema Wasser vor (pädagogische Situation). Im Anschluss zeigen sie einige Experimente zum Thema und lassen die Kinder ihre Fragen stellen. Diese Fragen werden in Gruppen eingeteilt zum Beispiel Tiere im Wasser. Alle Kinder die diesbezüglich eine Frage haben bilden eine Arbeitsgruppe und arbeiten selbst an der Beantwortung ihrer Fragen. (vgl. Youtube, KPH Graz, 3:00)
Dem Jena-Plan zu Folge hat die Lehrperson auch dafür zu sorgen, dass nun dieser Lernprozess in förderlicher Weise in Gang kommen und zu Ende gebracht werden kann. Sie hat sich zur Verfügung zu stellen. D. h. sie sollte passendes und angemessenes Material liefern, Methoden erlauben oder vermitteln (oftmals finden Schüler selbst unvorhergesehene, erstaunliche Methoden), Schüler in ihrem individuell zu vollziehenden Lernvorgang begleiten, ihnen helfen, korrigieren, ermutigen. Dieser individuelle Lernvorgang ist nicht an individualisierte Lernformen gebunden. Wesentliches Merkmal dieser Aktivität ist die Ergriffenheit des Schülers - vom Gegenstand, von der Arbeit, vom Ergebnis, von sich selbst. (vgl. Seitz, Hauptmann, Hezdel, & Neumann, o.J., S.124)
Ein Praxisbeispiel der KPH Graz zeig wie Lehrpersonen diesem Anspruch gerecht werden können. Sie zeigen den Kindern wie man Plakate und Bücher gestalten kann und schauen gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen über das Zwischenprodukt (Ergebnis der Ausarbeitung). Dann wird es endgültig gestaltet und die Kinder präsentieren ihr Endprodukt im Kreis. (vgl. Youtube, KPH Graz, 2:36) Daraus erschließt sich die Rolle der Lehrperson als Beobachter. Jedoch auch als Dokumentar dieser Beobachtungen und des Entwicklungsstands des Kindes.
Demgemäß ist eine weitere Aufgabe der Lehrperson eine positive Lernatmosphäre zu schaffen. Dies geschieht durchnverschiedenste Faktoren wie beispielsweise Interessen zu erkennen, sich mit den Kindern über ihre Erfolge freuen, Kinder in ihrem Handeln zu unterstützen, die Eltern einzubinden und mit den Kindern gemeinsam zu reflektieren. Hierbei ist es unumgänglich das Kind als Individuum wahr zu nehmen.
Die Jena-Plan Pädagogik funktioniert selbstverständlich in der Praxis nicht ab dem ersten Tag. Sie muss langsam eingeführt werden z.B. zunächst mehrmals wöchentlich im beschriebenen Sinn arbeiten, damit sich die Schüler und Schülerinnen an den Ablauf gewöhnen können. Auch arbeiten die Kinder nicht sofort selbständig und selbsttätig. Die Methoden und wie gearbeitet werden kann müssen von der Lehrperson sensibel eingeführt werden.
Es ist besonders wichtig den Kindern hier Zeit zu geben. Auch wenn es zunächst wirkt als würden die Kinder nichts tun, so haben sie jedoch Freude dabei und werden nach gegebener Zeit anfangen selbständig und selbsttätig Fragen zu stellen, an diesen zu arbeiten und somit auch lernen.
„Wir erhoffen uns für unsere Kinder, dass sie in Geborgenheit und Sicherheit zu sozial kompetenten Menschen heranwachsen, dass sie sich neugierig und selbständig ihre Welt erschließen dürfen (…)“ (Largo, 2010, S.7)
Dieses Ziel kann durch die Umsetzung der Jena-Plan Pädagogik ein Stück näher rücken. Jedoch ist dies abhängig von der Einstellung und der Umsetzung der Lehrperson, wie diese Arbeit zeigen soll. Ich persönlich bin nach dieser Auseinandersetzung vom Konzept des Jena-Plans überzeugt, jedoch muss es gut umgesetzt werden damit sich die Schüler und Schülerinnen zu selbständigen, selbsttätigen, Initiative zeigenden, kritisch denkenden Individuen entwickeln können
4 Literaturverzeichnis
Herker, S.(o.J.). Das Potential der Jenaplan-Pädagogik im Hinblick auf aktuelle Schulerwartungen bzw. Bildungsanforderungen.
http://www.jenaplan.at/fileadmin/buchJenaplanPaedagogik2017/Potential_der_Jenaplanpaedagogik.pdf(20.November 2017)
Largo, R. H. (2010). Lernen geht anders, Bildung und Erziehung vom Kind her denken, München/ Berlin: Piper Verlag GmbH
Seitz, O., Hauptmann, H., Hezdel, I.& Neumann, R.M. (o.J.). Zehn Schritte zum/zur Jenaplanlehrer/in
Skiera, E. (1985). Schule ohne Klassen – Gemeinsam lernen und leben das Beispiel Jenaplan. Heinsberg: Agentur Dieck
Hospitation aus zweiter Hand:
KPH Graz (2016). JENAPLAN Pädagogik. KPH Graz - Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=CK7xmpnHiNc)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Jena-Plan und wie definiert er Tätigkeiten für Kinder?
Im Jena-Plan werden Tätigkeiten von Kindern in einer kindgerechten rhythmischen Folge über Tag und Woche (auch über das Jahr) hinweg angeordnet. Dies soll eine günstige Voraussetzung für Aufmerksamkeit, Interesse und Erfolg des Kindes bilden.
Welches Ziel verfolgt der Jena-Plan?
Das Ziel ist die Weltorientierung und die Fähigkeit, sich in variablen Situationen mit einmal gemachten Erfahrungen, angeeigneten Fähigkeiten und Fertigkeiten zurechtzufinden. Dies soll den Anforderungen eines Zeitalters sich ständig verdoppelnder Wissensfakten an die Bildungsinstitution Schule gerecht werden.
Wie unterscheidet sich der Wochenplan nach Jena-Plan von traditionellen Wochenplänen?
Im Gegensatz zu traditionellen Wochenplänen, die oft wenige, fachgetrennte Aufgaben in schriftlicher Form vorgeben und nur geringe Eigenständigkeit bei der Bearbeitung zulassen, zielt der Jena-Plan Wochenplan darauf ab, unterschiedlichen Aktivitäten nach lernhygienischen und pädagogischen Kriterien und Interessen nachzugehen, die Spannung erzeugen und zu echten Fragen führen. Es wird Wert darauf gelegt, dass der Unterricht stärker auf die Interessen der Schüler ausgerichtet ist.
Welche Leitgedanken prägen den Jena-Plan?
Zu den Leitgedanken gehören Wochenpläne statt Stundenpläne (rhythmisches Freiarbeiten), Unterricht in Stammgruppen statt Jahrgangsklassen, attraktive Arbeitsmittel, Präsentation von Arbeitsergebnissen, Beurteilung (ohne Noten), intensive Einbeziehung der Eltern ins Schulgeschehen sowie Feiern und Schulwohnstube.
Wie wird der Wochenplan im Jena-Plan konkret umgesetzt?
Der Wochenplan gibt an, wie durch Gesprächs-, Spiel-, Arbeits- und Feiersituationen nach einer rhythmischen Ordnung gestrebt wird, wobei der Plan flexibel gehandhabt wird. Der Montagmorgen beginnt mit Feier und Gespräch, und es gibt Blockperioden (ca. 100 Minuten) für freies Arbeiten, in denen die Kinder selbst bestimmen, was, wie, wo und mit wem sie arbeiten möchten. Der Freitagmittag endet ebenfalls mit Gespräch und Feier.
Wie verändert sich die Rolle der Lehrperson im Jena-Plan?
Die Lehrperson im Jena-Plan agiert als Begleiter, Helfer und Vorbild. Sie ist für "ihre" Kinder da, hört ihnen zu, sieht nach ihnen, versteht und toleriert, setzt sich für sie ein und wendet Zeit und Arbeit für sie auf. Sie liefert passendes Material, vermittelt Methoden und begleitet die Schüler in ihrem Lernprozess.
Welche Aufgaben hat die Lehrperson im Jena-Plan-Unterricht?
Die Lehrperson hat die Aufgabe, einen förderlichen Lernprozess in Gang zu bringen und zu Ende zu bringen, sich zur Verfügung zu stellen, passendes Material zu liefern, Methoden zu erlauben oder zu vermitteln, Schüler in ihrem Lernvorgang zu begleiten, ihnen zu helfen, zu korrigieren und zu ermutigen. Außerdem schafft sie eine positive Lernatmosphäre und dokumentiert den Entwicklungsstand des Kindes.
Wie kann die Umsetzung des Jena-Plans in der Praxis erfolgen?
Die Jena-Plan Pädagogik muss langsam eingeführt werden, z.B. zunächst mehrmals wöchentlich im beschriebenen Sinn arbeiten, damit sich die Schüler und Schülerinnen an den Ablauf gewöhnen können. Auch arbeiten die Kinder nicht sofort selbständig und selbsttätig. Die Methoden und wie gearbeitet werden kann müssen von der Lehrperson sensibel eingeführt werden.
Was ist das übergeordnete Ziel der Jena-Plan-Pädagogik?
Das Ziel ist, dass Kinder in Geborgenheit und Sicherheit zu sozial kompetenten Menschen heranwachsen und sich neugierig und selbständig ihre Welt erschließen dürfen.
- Quote paper
- Sophie Stiehler (Author), 2018, Auswirkungen des Jena-Plans auf die Rolle der Lehrperson, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/423911