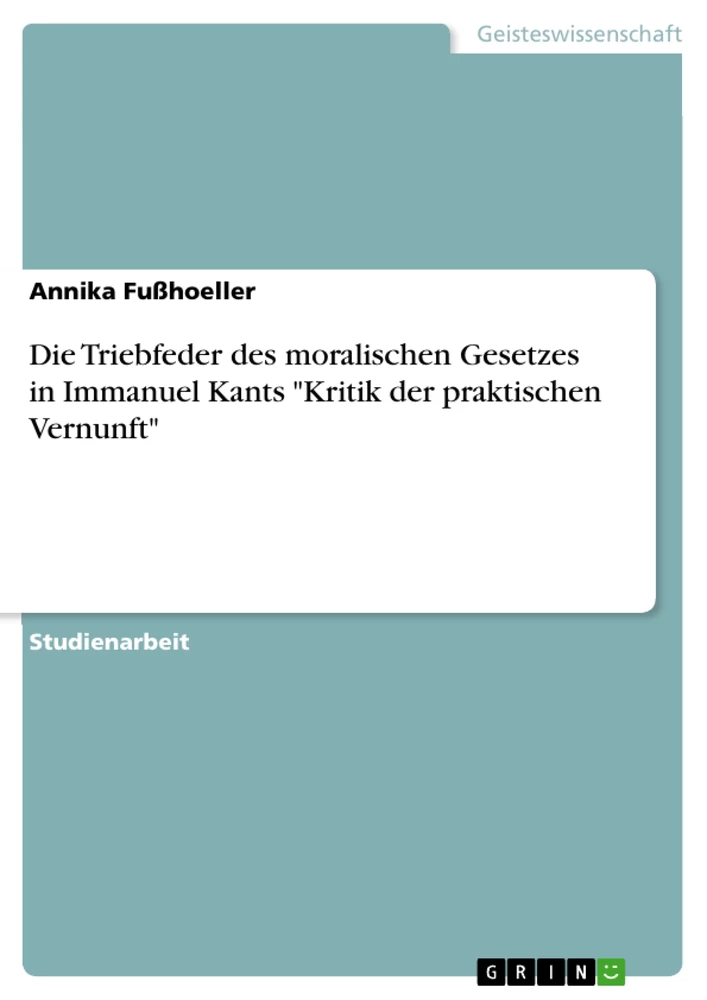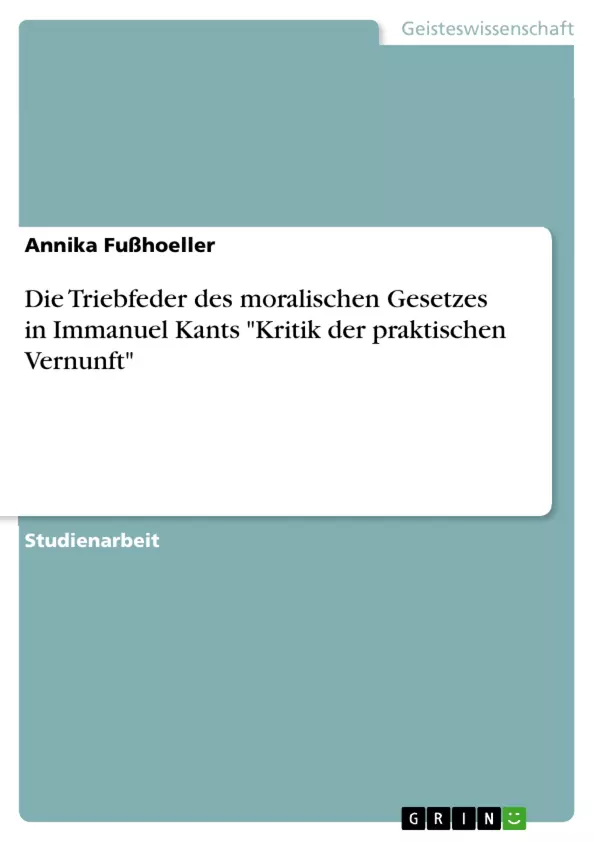Die Moralphilosophie beschäftigt sich seit jeher mit den Motivationsgründen guten Handelns und der Frage, wieso das tatsächliche Verhalten der Menschen zuweilen ihren eigens gesetzten moralischen Prinzipien und Vorstellungen widerspricht. Die vernunftbasierte Akzeptanz der Gültigkeit eines Gesetzes resultiert folglich nicht in dessen uneingeschränkter Ausführung in der Praxis.
In dem Werk ,,Kritik der praktischen Vernunft“ beschäftigt sich Kant unter anderem mit diesen genannten Fragen, indem er den Kern moralischen Handelns definiert und erläutert, wie Motivationsgründe zu solchen Handlungen führen können. Wie hierbei Handlungen aus reiner Vernunft heraus entstehen können erläutert das Kapitel ,,Von den Triebfedern der reinen praktischen Vernunft“. Denn die Vernunft kann nur gesetzgebend sein, wenn sie ,,als reine Vernunft praktisch“ ist.
Des Weiteren verdeutlicht Kant in diesem Absatz, worin sich moralische von unmoralischen Handlungen unterscheiden. Diese Definition ist von besonderer Bedeutung, da das grundlegende Ziel dieses Kant’schen Werkes darin besteht, die Existenz reiner praktischer Vernunft zu beweisen. Mit dieser Argumentation begründet der Philosoph gleichzeitig, wie rationale Erwägungen Einfluss auf das Handeln der Menschen nehmen können und so die rein von der Vernunft gelenkte Bestimmung des Willens durch ein formales Prinzip möglich wird. Im Folgenden möchte ich diese für die Philosophiegeschichte maßgeblichen Gedanken Immanuel Kants ausführen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Triebfeder und das moralische Gesetz
- Das Gefühl der Achtung und das moralische Gesetz
- Die Wirkung der „Triebfeder“
- Die Pflicht moralisch zu handeln
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Immanuel Kants „Kritik der praktischen Vernunft“ und analysiert die von Kant definierten Motivationsgründe moralischen Handelns. Der Fokus liegt auf der Klärung des Verhältnisses zwischen subjektiven „Triebfedern“ und dem moralischen Gesetz. Die Arbeit zielt darauf ab, Kants Argumentation im dritten Hauptstück „Von den Triebfedern der praktischen Vernunft“ darzulegen und zu verstehen, wie subjektive Motivationen mit dem übergeordneten moralischen Gesetz in Einklang gebracht werden können.
- Kants Definition von moralischem Handeln
- Der Begriff der „Triebfeder“ bei Kant und dessen Unterscheidung von Neigungen und Vernunft
- Das Verhältnis zwischen „Triebfeder“, moralischem Gesetz und Achtung
- Die Frage, inwiefern Achtung und das moralische Gesetz als „Triebfedern“ wirken
- Die Unterscheidung zwischen Moralität und Legalität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: die Untersuchung der Motivationsgründe moralischen Handelns bei Kant und die Diskrepanz zwischen der Akzeptanz moralischen Prinzips und dessen Umsetzung in der Praxis. Sie führt in Kants „Kritik der praktischen Vernunft“ ein und hebt die Bedeutung der „reinen praktischen Vernunft“ und des „Kategorischen Imperativs“ hervor. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die Analyse des dritten Hauptstücks „Von den Triebfedern der praktischen Vernunft“ an.
Die Triebfeder und das moralische Gesetz: Dieses Kapitel analysiert Kants Definition von moralischem Handeln als unmittelbare Willensbestimmung durch das moralische Gesetz. Es unterscheidet zwischen „Moralität“ (Handlung aus reinem Pflichtbewusstsein) und „Legalität“ (Handlung aus anderen Motiven, die zwar dem Gesetz entsprechen, aber nicht moralisch sind). Der Begriff der „Triebfeder“ wird als subjektiver Bestimmungsgrund des Willens eingeführt, wobei zwischen vernunftfernen Trieben und auf dem moralischen Gesetz beruhenden Bedürfnissen unterschieden wird. Die Diskussion beleuchtet, wie subjektive Motivationsgründe das Handeln beeinflussen und wie diese mit dem moralischen Gesetz in Verbindung stehen.
Schlüsselwörter
Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Moralität, Legalität, Triebfeder, moralisches Gesetz, Achtung, reine praktische Vernunft, Kategorischer Imperativ, Willensbestimmung, Handlungsgründe, Motivation.
Häufig gestellte Fragen zu Kants "Kritik der praktischen Vernunft"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Immanuel Kants „Kritik der praktischen Vernunft“ mit dem Schwerpunkt auf den Motivationsgründen moralischen Handelns. Sie untersucht das Verhältnis zwischen subjektiven „Triebfedern“ und dem moralischen Gesetz, insbesondere wie Kant subjektive Motivationen mit dem übergeordneten moralischen Gesetz in Einklang bringt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Kants Definition von moralischem Handeln, den Begriff der „Triebfeder“ (und dessen Unterscheidung von Neigungen und Vernunft), das Verhältnis zwischen „Triebfeder“, moralischem Gesetz und Achtung, die Frage, inwiefern Achtung und das moralische Gesetz als „Triebfedern“ wirken, und die Unterscheidung zwischen Moralität und Legalität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Triebfeder und das moralische Gesetz, ein Kapitel über das Gefühl der Achtung und das moralische Gesetz, ein Kapitel über die Wirkung der „Triebfeder“ (einschließlich der Pflicht moralisch zu handeln) und einen Schluss. Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung vor und führt in Kants Werk ein. Das Kapitel über die Triebfeder und das moralische Gesetz analysiert Kants Definition von moralischem Handeln und den Begriff der „Triebfeder“. Weitere Kapitel behandeln die Rolle der Achtung und die praktische Umsetzung des moralischen Gesetzes.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Moralität, Legalität, Triebfeder, moralisches Gesetz, Achtung, reine praktische Vernunft, Kategorischer Imperativ, Willensbestimmung, Handlungsgründe, Motivation.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, Kants Argumentation im dritten Hauptstück „Von den Triebfedern der praktischen Vernunft“ darzulegen und zu verstehen, wie subjektive Motivationen mit dem übergeordneten moralischen Gesetz in Einklang gebracht werden können.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit erläutert. Es folgen Kapitel, die die zentralen Konzepte von Kants Theorie systematisch behandeln, abschließend folgt ein Schluss.
Was ist der Unterschied zwischen Moralität und Legalität nach Kant?
Moralität bezeichnet bei Kant Handeln aus reinem Pflichtbewusstsein, während Legalität Handlungen beschreibt, die zwar dem Gesetz entsprechen, aber aus anderen Motiven als dem reinen Pflichtgefühl erfolgen.
Welche Rolle spielt die "Triebfeder" in Kants Theorie?
Die „Triebfeder“ bezeichnet den subjektiven Bestimmungsgrund des Willens. Kant unterscheidet dabei zwischen vernunftfernen Trieben und auf dem moralischen Gesetz beruhenden Bedürfnissen. Die Arbeit untersucht, wie diese subjektiven Motivationsgründe das Handeln beeinflussen und wie sie mit dem moralischen Gesetz in Verbindung stehen.
Welche Rolle spielt die Achtung in Kants Ethik?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Achtung im Kontext des moralischen Gesetzes und analysiert, inwiefern Achtung als „Triebfeder“ für moralisches Handeln wirken kann.
- Quote paper
- Annika Fußhoeller (Author), 2017, Die Triebfeder des moralischen Gesetzes in Immanuel Kants "Kritik der praktischen Vernunft", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/423968