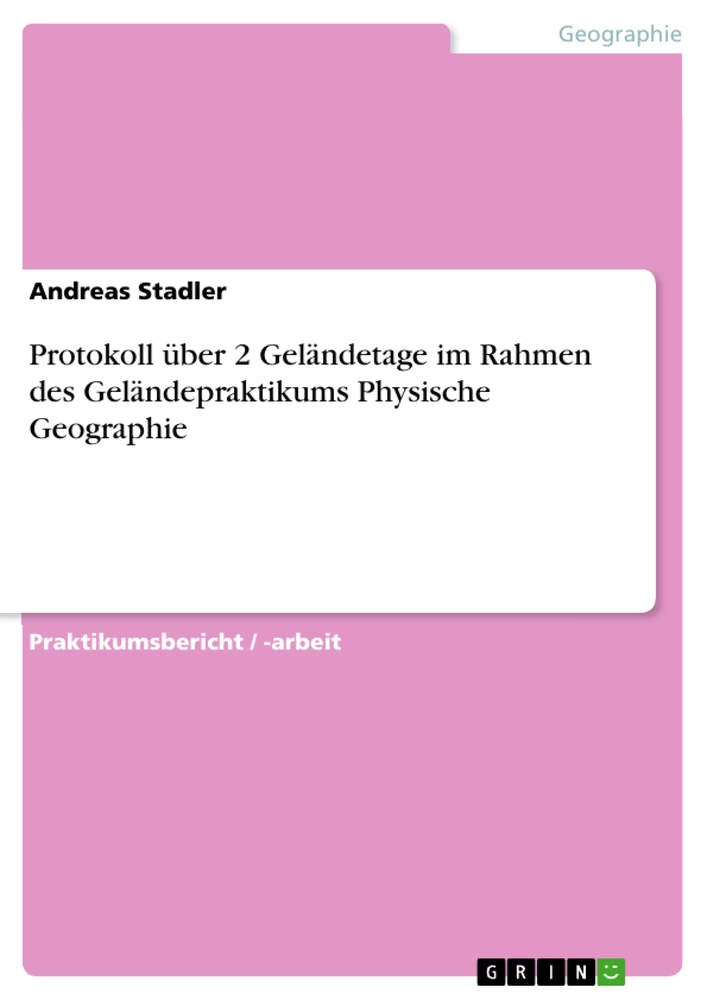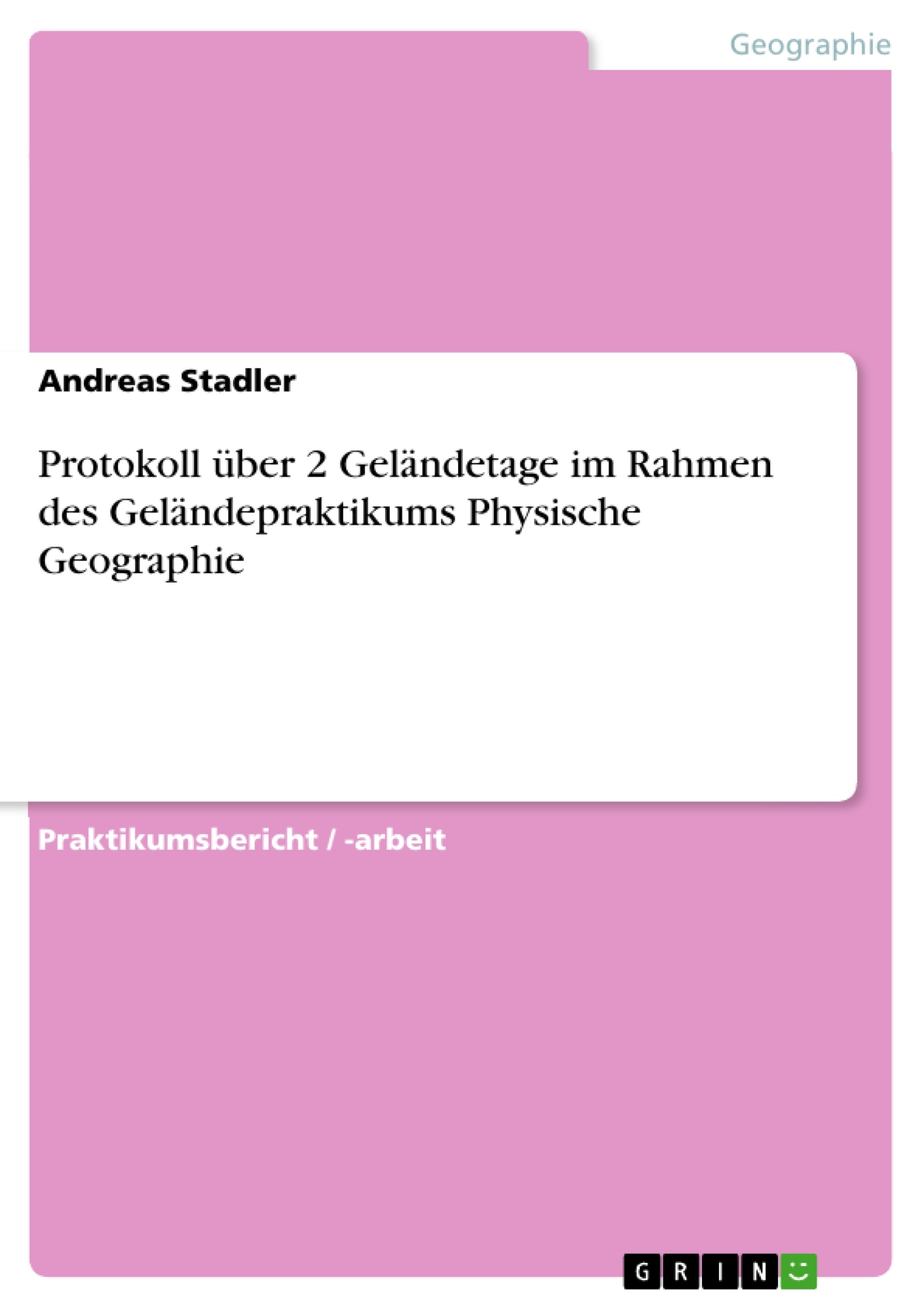Das Naturschutzgebiet Sandheiden und Dünen bei Sandweier befindet sich südlich von Rastatt auf dem Gebiet des Landkreises Rastatt und des Stadtkreises BadenBaden. Es hat eine Fläche von 240,7 ha und man findet dort die bedeutendsten Sanddünen in Baden-Württemberg. Das Naturschutzgebiet ist Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“. Der Standort befindet sich auf der Niederterrasse des Oberrheingrabens.
Im Rahmen des Geländepraktikums wurden die Methoden Geoelektrische Tomographie (Geoelektrik) und die Bohrstocksondierung erlernt.
Inhaltsverzeichnis
- Standort Naturschutzgebiet Sandheiden und Dünen bei Sandweier
- Methode Geoelektrische Tomographie
- Methode Bohrstocksondierung (Pürckhauer Methode)
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Protokoll befasst sich mit zwei Geländetagen im Rahmen des Geländepraktikums Physische Geographie, die im Naturschutzgebiet Sandheiden und Dünen bei Sandweier durchgeführt wurden. Es werden die Methoden Geoelektrische Tomographie und Bohrstocksondierung angewendet, um die geologische Struktur des Standorts zu untersuchen.
- Geologische Entstehung des Oberrheingrabens
- Sedimentation und Landschaftsentwicklung
- Äolische Prozesse und Dünenbildung
- Anwendung der Methoden Geoelektrische Tomographie und Bohrstocksondierung
- Geomorphologische Besonderheiten des Naturschutzgebietes
Zusammenfassung der Kapitel
Standort Naturschutzgebiet Sandheiden und Dünen bei Sandweier
Dieses Kapitel beschreibt die geografische Lage des Naturschutzgebietes Sandheiden und Dünen bei Sandweier im Oberrheingraben und erläutert die geologische Entstehung des Gebiets. Besonderes Augenmerk liegt auf der Entstehung der Sanddünen, die durch äolische Prozesse während der Würmeiszeit entstanden sind.
Methode Geoelektrische Tomographie
Dieses Kapitel behandelt die Methode der Geoelektrischen Tomographie, die im Rahmen des Geländepraktikums angewendet wurde. Es werden die Funktionsweise der Methode, die Messanordnung und die Interpretation der Ergebnisse beschrieben.
Methode Bohrstocksondierung (Pürckhauer Methode)
Dieses Kapitel fokussiert auf die Methode der Bohrstocksondierung nach Pürckhauer, die zur Bestimmung der Bodendichte eingesetzt wurde. Die Funktionsweise der Methode und die Interpretation der Ergebnisse werden detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Oberrheingraben, Sanddünen, Naturschutzgebiet, Geoelektrische Tomographie, Bohrstocksondierung, Bodendichte, Pleistozän, Würmeiszeit, äolische Prozesse, Niederterrasse, Sedimentation.
Häufig gestellte Fragen
Wo liegt das Naturschutzgebiet Sandheiden und Dünen bei Sandweier?
Es befindet sich südlich von Rastatt auf dem Gebiet des Landkreises Rastatt und des Stadtkreises Baden-Baden, gelegen auf der Niederterrasse des Oberrheingrabens.
Wie sind die Sanddünen in diesem Gebiet entstanden?
Die Dünen bildeten sich durch äolische Prozesse (Windverwehung) während der Würmeiszeit im Pleistozän.
Was ist Geoelektrische Tomographie?
Dies ist eine geophysikalische Methode zur Untersuchung des Untergrunds, bei der die elektrische Leitfähigkeit des Bodens gemessen wird, um geologische Strukturen sichtbar zu machen.
Was versteht man unter der Pürckhauer-Methode?
Die Pürckhauer-Methode ist ein Verfahren der Bohrstocksondierung, das zur Bestimmung der Bodendichte und zur Entnahme von Bodenproben in lockeren Sedimenten eingesetzt wird.
Was ist das Ziel des Geländepraktikums Physische Geographie?
Ziel ist das Erlernen und Anwenden von Feldmethoden zur Untersuchung der geomorphologischen Entwicklung und Sedimentation in spezifischen Landschaften wie dem Oberrheingraben.
- Arbeit zitieren
- Andreas Stadler (Autor:in), 2016, Protokoll über 2 Geländetage im Rahmen des Geländepraktikums Physische Geographie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/423980