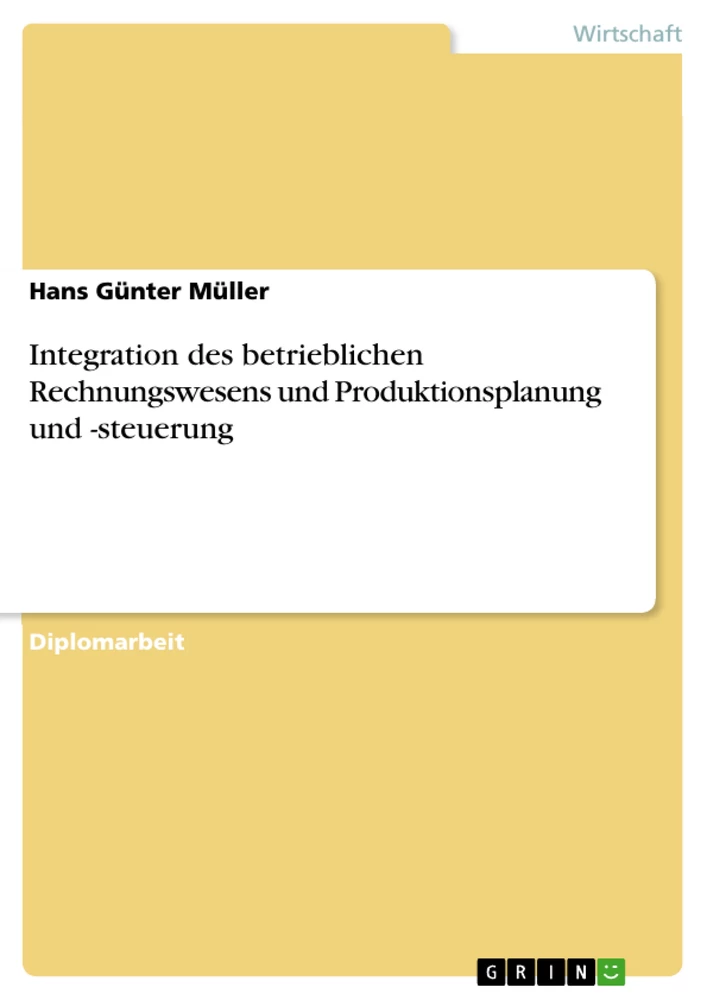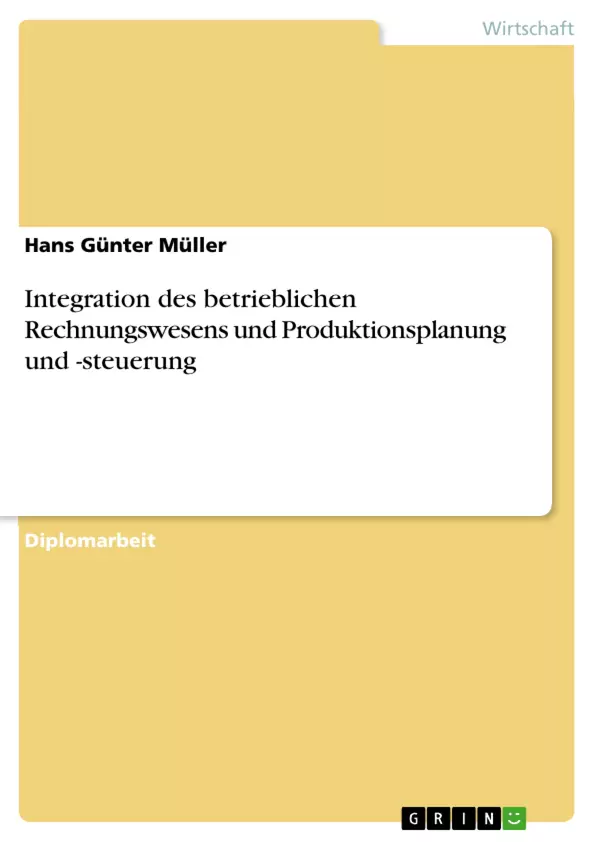1. Einleitung
Die Arbeiten in Unternehmen werden arbeitsteilig vollzogen (mit Ausnahme der Zwei-Augen-Unternehmen). Hierdurch haben sich verschiedene Unternehmensbereiche entwickelt die den
betrieblichen Leistungsprozeß betrachten, planen und analysieren. Während der Bereich der Fertigung in der Produktionplanung und -steuerung (PPS) in Gütermengeneinheiten und Zeitbeanspruchungen
betrachtet wird, bildet das Rechnungswesen den Leistungsprozeß in Geldeinheiten aus interner (Kostenrechnung) und externer Sicht (Finanzbuchhaltung und Finanzplanung) ab. In der Theoriebildung wurde die Kostenrechnung konsequent auf die Mengengerüste der Produktionstheorie aufgebaut. Es wird zu zeigen sein, wie diese Abhängigkeiten in die Informationsabhängigkeiten der unternehmerischen Teilbereiche einfließt und wie die Systemgestaltungen dies berücksichtigen.
Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll auf Basis von allgemeinen Systembetrachtungen (Kapitel 2) und einer Darstellung der betrieblichen Teilbereiche, PPS und Rechnungswesen (Kapitel 3), die
Gemeinsamkeiten und Abhängigkeiten der Bereiche dargestellt werden (Kapitel 4). Aus den vielschichtigen Abhängigkeiten von betrieblichen Teilsystemen ergeben sich unterschiedliche Aspekte
einer Integration, beispielsweise DV-technische und organisatorische. Zum Abschluß soll der aktuelle Stand der Entwicklung und die Einflüsse hierauf grob umrissen werden (Kapitel 5). Anhand von Beispielen werden verschiedene Lösungswege, wie sie die angebotene Software vorsieht, vorgestellt. Die Kostenträgerrechnung eines Systems wird detailliert dargestellt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 0. VORWORT
- 1. EINLEITUNG
- 2. SYSTEMTHEORETISCHE GRUNDLAGEN
- 2.1. SYSTEMHIERARCHIEN
- 2.2. ARTEN VON SYSTEMEN
- 2.3. REGELVERHALTEN VON SYSTEMEN
- 2.4. FEHLERQUELLEN IN SYSTEMEN
- 3. TEILSYSTEME IM BETRIEB
- 3.1. PRODUKTIONSPLANUNG UND -STEUERUNG (PPS)
- 3.1.1. Produktionsprogrammplanung
- 3.1.2. Mengenplanung
- 3.1.3. Termin- und Kapazitätsplanung
- 3.1.4. Auftragsveranlassung
- 3.1.5. Auftragsüberwachung - BDE
- 3.2. TECHNISCHE STEUERUNG DER PRODUKTION
- 3.3. DAS BETRIEBLICHE RECHNUNGSWESEN
- 3.3.1. Kostenrechnung
- 3.3.1.1. Kostenartenrechnung
- 3.3.1.2. Kostenstellenrechnung
- 3.3.1.3. Kostenträgerrechnung
- 3.3.1.4. Kostenträgerzeitrechnung
- 3.3.2. Finanzbuchhaltung
- 3.3.3. Finanzplanung
- 3.3.1. Kostenrechnung
- 3.1. PRODUKTIONSPLANUNG UND -STEUERUNG (PPS)
- 4. INTEGRATION DER SYSTEME
- 4.1. ARTEN DER INTEGRATION
- 4.1.1. Der Mensch als Integrationselement
- 4.1.2. DV-technische Integration
- 4.1.2.1. Bridge-Programme
- 4.1.2.2. Übergabedateien
- 4.1.2.3. Gemeinsame Datei- und Datenbanksysteme
- 4.1.2.4. Programmintegration
- 4.1.2.5. Expertensysteme
- 4.1.3. Wertung der Integrationsalternativen
- 4.2. INTEGRATION DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESEN
- 4.2.1. Integration der Kostenrechnung
- 4.2.1.1. Integration der Kostenartenrechnung in PPS
- 4.2.1.1.1. Materialkosten (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)
- 4.2.1.1.2. Löhne und Gehälter
- 4.2.1.1.3. Instandhaltung - Instandsetzung
- 4.2.1.1.4. Sonstige Kosten
- 4.2.1.2. Integration der Kostenstellenrechnung in PPS
- 4.2.1.3. Integration der Kostenträgerrechnung in PPS
- 4.2.1.4. Integration der Kostenträgerzeitrechnung in PPS
- 4.2.1.5. Regelungseinfluß der Kostenrechnung auf die Produktion
- 4.2.1.5.1. Regelverhalten der Kostenstellenrechnung auf die Produktion
- 4.2.1.5.2. Regelverhalten der Kostenträgerrechnung auf die Produktion
- 4.2.1.1. Integration der Kostenartenrechnung in PPS
- 4.2.2. Integration der Finanzbuchhaltung
- 4.2.2.1. Zugänge von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
- 4.2.2.2. Einlagerung von Halb- und Fertigerzeugnissen
- 4.2.2.3. Umsatzerlöse durch Fertigerzeugnisse
- 4.2.3. Integration der Finanzplanung
- 4.2.3.1. Integration der Liquiditätsplanung
- 4.2.3.2. Integration der Kapitalbedarfsrechnung
- 4.3. ZUSAMMENFASSENDE INPUT-OUTPUT ANALYSE DER MODULE
- 4.4. EINFLUẞ DER TECHNISCHEN STEUERUNG DER PRODUKTION AUF DIE INTEGRATION
- 4.5. ORGANISATORISCHE ABHÄNGIGKEITEN DER INTEGRATION
- 4.6. EINFLUB DER INTEGRATION AUF DAS RECHNUNGSWESEN
- 4.7. INTEGRATION DER PLANUNGSPROZESSE
- 4.8. EINFLÜSSE AUS DER ZWISCHENBETRIEBLICHEN INTEGRATION
- 4.9. PRAKTISCHE PROBLEME
- 4.2.1. Integration der Kostenrechnung
- 5. PRAKTISCHE REALISIERUNGEN DER INTEGRATION
- 5.1. PS-SYSTEM DER PS-SYSTEMTECHNIK (SCS)
- 5.1.1. Die Kostenträgerrechnung im PS-System
- 5.2. KORAC-KOSTENRECHNUNGSSYSTEM DER ACI
- 5.3. VAX-PROFI
- 5.4. SYSTEM R/2 VON SAP
- 5.5. MFG/PRO DER QAD
- 5.5.1. Kostenträgerrechnung
- 5.5.2. Schnittstelle Verkaufsrechnungen
- 5.1. PS-SYSTEM DER PS-SYSTEMTECHNIK (SCS)
- 6. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Integration des betrieblichen Rechnungswesens und der Produktionsplanung und -steuerung (PPS) in Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Abhängigkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen diesen Bereichen und der Untersuchung verschiedener Ansätze zur Integration, insbesondere im Hinblick auf die Informationsvernetzung und die systemtheoretischen Grundlagen.
- Systemtheoretische Grundlagen der Integration
- Darstellung der Teilbereiche PPS und Rechnungswesen
- Analyse der Abhängigkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen PPS und Rechnungswesen
- Untersuchung verschiedener Integrationsansätze, z.B. DV-technische und organisatorische
- Bewertung der Integrationsalternativen und praktische Realisierungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2: Systemtheoretische Grundlagen Dieses Kapitel behandelt die systemtheoretischen Grundlagen der Integration, indem es Konzepte wie Systemhierarchien, Arten von Systemen, Regelverhalten und Fehlerquellen beleuchtet.
- Kapitel 3: Teilsysteme im Betrieb Dieses Kapitel beschreibt die Teilbereiche der Produktionsplanung und -steuerung (PPS) und des betrieblichen Rechnungswesens im Detail. Die einzelnen Module dieser Teilsysteme werden erläutert, z.B. Produktionsprogrammplanung, Mengenplanung, Kostenartenrechnung, Finanzbuchhaltung und Finanzplanung.
- Kapitel 4: Integration der Systeme Das Herzstück der Arbeit liegt in diesem Kapitel. Es analysiert die Arten der Integration zwischen den Teilsystemen und untersucht verschiedene Integrationsansätze, darunter DV-technische Integration (z.B. Bridge-Programme, gemeinsame Datei- und Datenbanksysteme) und organisatorische Integration.
- Kapitel 5: Praktische Realisierungen der Integration Das Kapitel beleuchtet verschiedene praktische Realisierungen der Integration anhand von Beispielen, wie dem PS-System, dem KORAC-Kostensystem, VAX-PROFI und SAP-Systemen. Es wird auf die spezifische Ausgestaltung der Kostenträgerrechnung in diesen Systemen eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit fokussiert auf die Integration von PPS und betrieblichem Rechnungswesen, wobei Themen wie Systemtheorie, Informationsvernetzung, DV-technische und organisatorische Integration, Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung im Vordergrund stehen. Die Arbeit befasst sich mit praktischen Realisierungen der Integration anhand von verschiedenen Softwarelösungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen PPS und Rechnungswesen zusammen?
Während die Produktionsplanung (PPS) in Mengen und Zeit plant, bildet das Rechnungswesen diese Prozesse in Geldeinheiten ab; beide basieren auf den gleichen Mengengerüsten.
Welche Arten der DV-technischen Integration gibt es?
Dazu gehören Bridge-Programme, Übergabedateien, gemeinsame Datenbanksysteme und die vollständige Programmintegration (z.B. in SAP R/2).
Wie beeinflusst die Kostenrechnung die Produktion?
Die Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung üben ein Regelverhalten auf die Produktion aus, indem sie Effizienzabweichungen aufzeigen und Steuerungsimpulse geben.
Welche Rolle spielt die Finanzplanung für die PPS?
Die Integration der Liquiditätsplanung und Kapitalbedarfsrechnung stellt sicher, dass Produktionspläne finanziell durchführbar sind.
Was sind praktische Probleme bei der Systemintegration?
Herausforderungen liegen oft in unterschiedlichen Datenstrukturen, organisatorischen Abhängigkeiten und dem hohen Koordinationsaufwand zwischen Fertigung und Verwaltung.
- 4.1. ARTEN DER INTEGRATION
- Quote paper
- Hans Günter Müller (Author), 2000, Integration des betrieblichen Rechnungswesens und Produktionsplanung und -steuerung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424