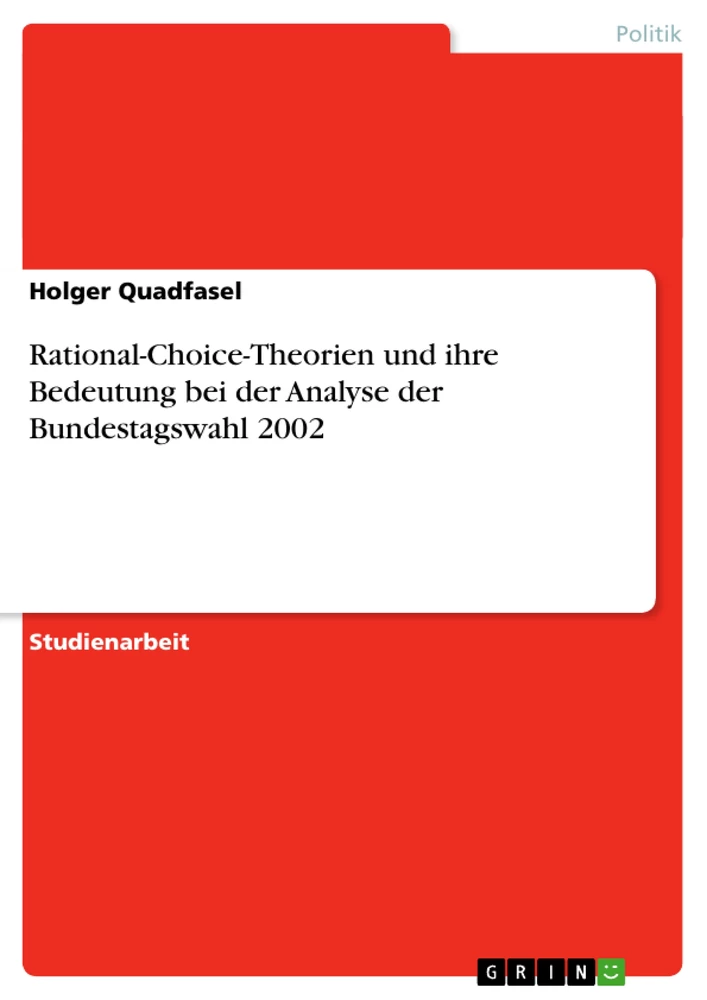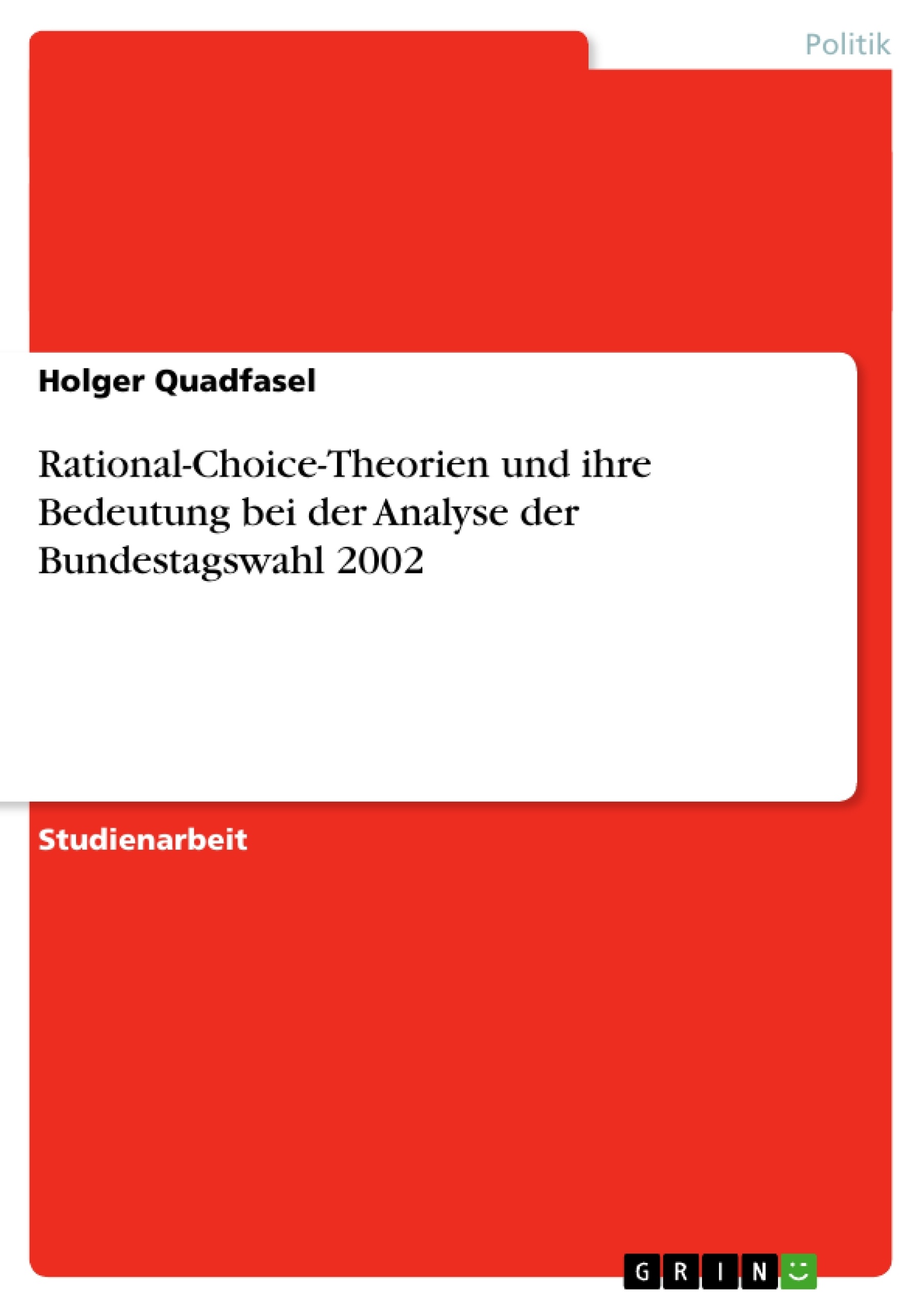Bei der Bundestagswahl 2002 wurde die alte Regierung mit einem äußerst knappen Vorsprung vor den konkurrierenden Parteien im Amt bestätigt.
Was war diesem Ergebnis nicht alles vorausgegangen: Die Jahrhundertflut in Ostdeutschland und ihre dramatischen Folgen, der drohende Irakkrieg, die beiden Fernsehduelle, die antsemitische Diskussion um die FDP sowie der Machtkampf der beiden Kanzlerkandidaten: Bestimmt wurde der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2002 zu einem Großteil von Personalisierung der Wahlkampagne, Inszenierung durch die Medien und vielmehr durch eine Dramatisierung als eine sachliche Darstellung der politischen Inhalte. Damit lag diese Strategie ganz im Trend der „Amerikanisierung“, welche in den letzten Jahren immer stärker in die deutschen Wahlkämpfe Einzug gehalten hat. Ziel war es dabei vor allem, Meinungen zu polarisieren, um so die noch unentschlossenen Wähler emotional für die eigene Partei zu gewinnen.
Diesen gefühlsorientiert handelnden Menschen steht der „rationale Wähler“ gegenüber, der im Vorhinein exakt einen Plan über die Vorteile und Nachteile seiner Wahlentscheidung aufstellt und auf diese Weise niemals spontan aus einer Gefühlskomponente heraus handelt: Ganz im Gegenteil ist sein Handeln stets bewusst auf ein politisches Ziel ausgerichtet.
Doch besitzt das Konzept des rationalen Wählers, welches bereits im Jahr 1957 von Anthony Downs entwickelt und seit den 80er Jahren in der Wahlforschung immer wieder zur Erklärung von Wahlverhalten herangezogen wurde, überhaupt noch eine Relevanz für die Analysen des Ergebnisses der Bundestagswahl 2002? Wird in den Nachbetrachtungen der Wahl berücksichtigt, inwieweit sich die Wähler an politischen Sachfragen orientiert oder sie eher spontan gewählt haben? War das Ergebnis der Bundestagswahl lediglich ein reiner Zufall und somit verursacht von Wählern, die aus dem Affekt heraus ihre Stimme abgegeben haben? Oder verbergen sich dahinter genau abgewogene Wählermeinungen?
Von Interesse ist darüber hinaus, wie die wissenschaftliche Theorie und die Praxis miteinander in Verbindung stehen: Denn was passiert, wenn das Modell von Downs mit der Realität einer politischen Wahl konfrontiert wird? Handelt der Wähler rational, wenn er wählt? Handelt er irrational? Und: Kann rationales Wählen in der Praxis überhaupt von irrationalem Wählen unterschieden werden?
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, diese Fragen zu erörtern und zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Rational-Choice-Theorien
- 2.1. Die Grundlagen von Rational-Choice-Modellen
- 2.1.1. Der Ursprung und die Idee von Rational-Choice
- 2.1.2. Der Begriff der Rationalität
- 2.1.3. Das zugrunde liegende Menschenbild
- 2.1.3.1. Der Homo Ökonomicus
- 2.1.3.2. Kritik und Konkurrenzmodelle
- 2.2. Modelle rationaler Wahlhandlungen
- 2.2.1. Warum ausgerechnet Downs?
- 2.2.2. Das Modell des rationalen Wählers
- 2.2.2.1. Die Grundannahmen
- 2.2.2.2. Der rationale Wähler im Zweiparteiensystem
- 2.2.2.3. Der rationale Wähler im Mehrparteiensystem
- 2.2.2.4. Das Problem der Informationskosten
- 2.2.2.5. Das Wahlparadoxon
- 2.2.3. Das,,RREEMM“-Akteursmodell
- 3. Die Bedeutung von Rational-Choice-Theorien im Rahmen von Analysen der Bundestagswahl 2002
- 3.1. Das Wahlergebnis und seine Interpretationen
- 3.2. Die Rolle von Rational-Choice-Theorien innerhalb der Wahlanalysen
- 3.2.1. Zufallssieg oder Leistungssieg?
- 3.2.2. Die Berücksichtigung des rationalen Wählers
- 3.2.3. Der Versuch einer Erklärung
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Relevanz von Rational-Choice-Theorien für die Analyse der Bundestagswahl 2002. Sie zielt darauf ab, die theoretischen Grundlagen von Rational-Choice-Modellen darzustellen und deren Anwendungsmöglichkeiten bei politischen Wahlen zu beleuchten. Dabei wird insbesondere auf Anthony Downs' Modell des rationalen Wählers eingegangen und dessen Bedeutung für die Erklärung des Wahlverhaltens im Rahmen einer politischen Wahl analysiert.
- Die Grundlagen von Rational-Choice-Theorien und ihre zentralen Annahmen
- Das Modell des rationalen Wählers nach Anthony Downs
- Die Bedeutung von Rational-Choice-Theorien für die Analyse der Bundestagswahl 2002
- Die Rolle des rationalen Wählers im Kontext des Wahlergebnisses von 2002
- Die Relevanz von Rational-Choice-Modellen für die politische Entscheidungsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema der Bundestagswahl 2002 ein und stellt die Frage nach der Relevanz des rationalen Wählers im Kontext des Wahlergebnisses. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen von Rational-Choice-Theorien, wobei der Fokus auf der Definition von Rationalität, dem zugrunde liegenden Menschenbild des Homo Ökonomicus und auf Downs' Modell des rationalen Wählers liegt. Kapitel 3 untersucht die Anwendung von Rational-Choice-Theorien auf die Analyse der Bundestagswahl 2002, indem es das Wahlergebnis beleuchtet, die Rolle des rationalen Wählers diskutiert und einen Erklärungsversuch für das Ergebnis liefert.
Schlüsselwörter
Rational-Choice-Theorien, rationaler Wähler, Homo Ökonomicus, Bundestagswahl 2002, Wahlverhalten, Wahlanalyse, politische Entscheidungsfindung, Downs' Modell, RREEMM-Modell
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Rational-Choice-Theorie in der Wahlforschung?
Sie geht davon aus, dass Wähler rationale Akteure sind, die ihre Entscheidung auf Basis einer Kosten-Nutzen-Abwägung treffen, um ihren persönlichen Vorteil zu maximieren.
Wer entwickelte das Modell des rationalen Wählers?
Das grundlegende Modell wurde 1957 von Anthony Downs entwickelt und ist seitdem ein zentraler Bestandteil der Politikwissenschaft.
War der rationale Wähler bei der Bundestagswahl 2002 entscheidend?
Die Arbeit untersucht, ob das knappe Ergebnis auf rationalen Abwägungen zu Sachfragen basierte oder eher durch emotionale Inszenierung und Personalisierung (Amerikanisierung) beeinflusst wurde.
Was ist das „Wahlparadoxon“?
Das Paradoxon beschreibt die Tatsache, dass für einen rein rationalen Akteur die Kosten des Wählens (Zeit, Info) oft höher sind als der Nutzen der einzelnen Stimme, und er konsequenterweise nicht wählen gehen dürfte.
Was versteht man unter dem „Homo Ökonomicus“?
Es ist das Menschenbild eines rein zweckrational handelnden Akteurs, das den Rational-Choice-Modellen zugrunde liegt, aber oft als zu einseitig kritisiert wird.
- Quote paper
- Holger Quadfasel (Author), 2003, Rational-Choice-Theorien und ihre Bedeutung bei der Analyse der Bundestagswahl 2002, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42404