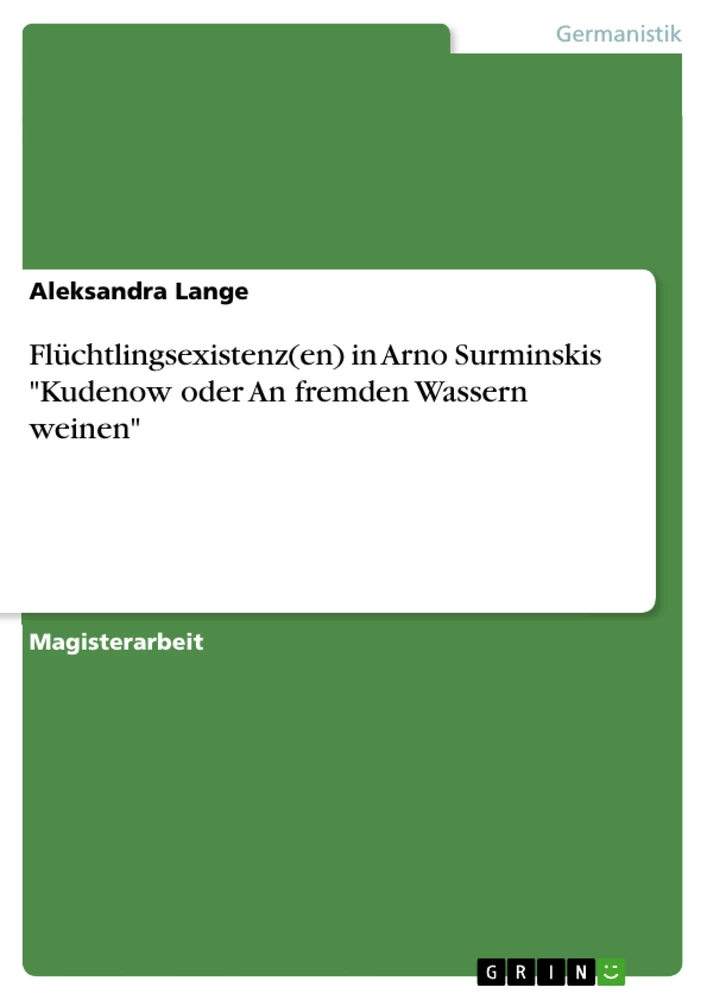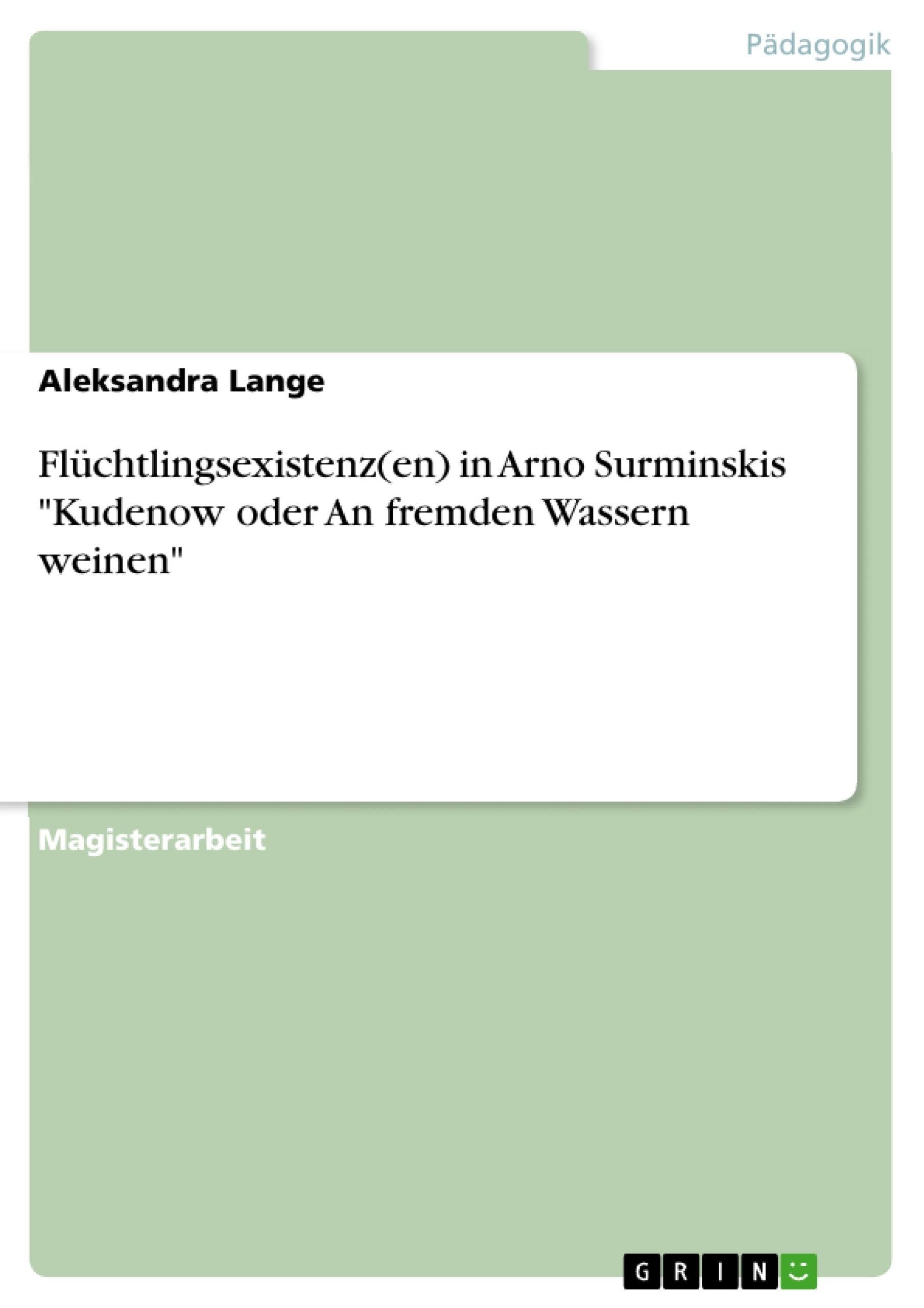Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf das Thema: „Flüchtlingsexistenz(en) in Arno Surminskis Kudenow oder An fremden Wassern weinen“.
Der Roman handelt von Lebensumständen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland herrschen. Deutsche Flüchtlinge lassen sich in Kudenow nieder, wo sie jeden Tag einen Kampf um das Überleben führen und den Auseinandersetzungen mit den Einheimischen ausgesetzt werden. Das Ziel der Arbeit basiert also auf der Analyse einer schweren Lage deutscher Flüchtlinge, die zweifelsohne ihren physischen und psychischen Zustand beeinflusst. Dabei stellt sich die Frage nach der Integration in die neue Gesellschaft. In diesem Sinne werden am Beispiel von einigen Flüchtlingsexistenzen das alltägliche Leben und die sich damit verbundenen Probleme und Konflikte in der Nachkriegszeit dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Zielbestimmung
- Flüchtlingsexistenz...
- Flucht und ihre Motive
- Emotionale Zone.....
- Zum Raumdiskurs
- Zur Theorie des Zwischenraumes..
- Zustand der Heimatlosigkeit...........
- Zum Gedächtnisdiskurs....
- Gedächtnis im Spannungsfeld von Erinnern und Vergessen.......
- (Re)Konstruktion des individuellen und kollektiven Gedächtnis...
- Zum Inhalt des Romans Kudenow oder An fremden Wassern weinen.….….…........
- Zur Erzählperspektive
- Kudenow als sozialer Raum …………………..\li>
- Rangordnung unter den Bewohnern
- Der tägliche Existenzkampf.…………….….….………….
- Figurenkonstellationen..
- Zur Opposition, Flüchtling - Einheimischer“.
- Bruder-Schwester-Verhältnis: Kurt und Ella Marenke
- Mutter Marenke als Spielball der Geschichte...........
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Lebensumstände deutscher Flüchtlinge in Arno Surminskis Roman „Kudenow oder An fremden Wassern weinen". Der Roman beleuchtet die schwierige Situation von Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, die in Kudenow eine neue Heimat finden wollen. Die Arbeit analysiert die sozialen, emotionalen und räumlichen Herausforderungen, denen die Flüchtlinge im Nachkriegsdeutschland begegnen.
- Die Ursachen und Folgen der Flucht
- Die emotionale Belastung von Flüchtlingen
- Der Raumdiskurs und das Konzept des Zwischenraumes
- Das Verhältnis von Einheimischen und Flüchtlingen
- Die Bedeutung des Gedächtnisses in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Motive und Folgen der Flucht. Dabei werden die Push- und Pull-Faktoren, die zur Vertreibung der Deutschen führten, beleuchtet. Im Anschluss wird die emotionale Zone von Flüchtlingen in den Fokus gerückt, die in ihrer neuen Umgebung mit Unsicherheit, Verlust und Trauer konfrontiert sind.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Raumdiskurs und dem Konzept des Zwischenraumes. Der soziale Raum von Kudenow wird als Ort der Konfrontation und der Ungleichheit zwischen Einheimischen und Flüchtlingen dargestellt. Die Arbeit untersucht zudem das Konzept des Gedächtnisses und seine Rolle in der Verarbeitung der Vergangenheit.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Figuren und ihre Beziehungen zueinander analysiert. Die Opposition zwischen Flüchtlingen und Einheimischen wird deutlich, ebenso wie die komplexen Beziehungen innerhalb der Flüchtlingsgemeinschaft. Die Arbeit beleuchtet dabei die Rolle des Gedächtnisses in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und die Herausforderungen der Integration in die neue Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Flüchtlingsexistenz, Vertreibung, Nachkriegsdeutschland, Raumdiskurs, Zwischenraum, Gedächtnis, Integration, Einheimische, Flüchtlinge, Kudenow, Arno Surminski
Häufig gestellte Fragen
Wovon handelt Arno Surminskis Roman „Kudenow“?
Der Roman thematisiert das Schicksal deutscher Flüchtlinge, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Ort Kudenow niederlassen und dort um ihr Überleben und die Integration kämpfen.
Was ist der „Raumdiskurs“ in dieser Analyse?
Er untersucht die Beziehung zwischen den Flüchtlingen und ihrer neuen, oft feindseligen Umgebung sowie das Gefühl der Heimatlosigkeit im „Zwischenraum“.
Wie wird das Verhältnis zwischen Einheimischen und Flüchtlingen dargestellt?
Es ist geprägt von Konflikten, Vorurteilen und einer sozialen Rangordnung, in der die Flüchtlinge oft am unteren Ende stehen.
Welche Rolle spielt das Gedächtnis im Roman?
Die Arbeit analysiert das Spannungsfeld zwischen dem Erinnern an die verlorene Heimat und der Notwendigkeit des Vergessens, um in der neuen Realität zu überleben.
Wer sind die zentralen Figuren der Familie Marenke?
Im Fokus stehen Kurt und Ella Marenke sowie ihre Mutter, die als „Spielball der Geschichte“ die Härte der Vertreibung erlebt.
- Arbeit zitieren
- Aleksandra Lange (Autor:in), 2017, Flüchtlingsexistenz(en) in Arno Surminskis "Kudenow oder An fremden Wassern weinen", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424110