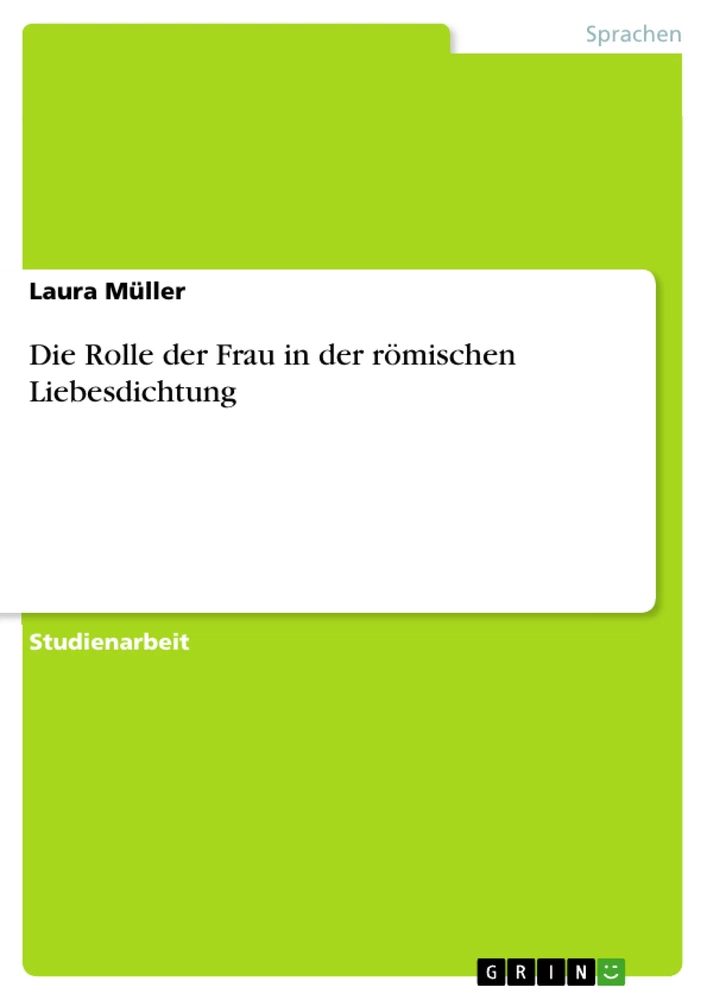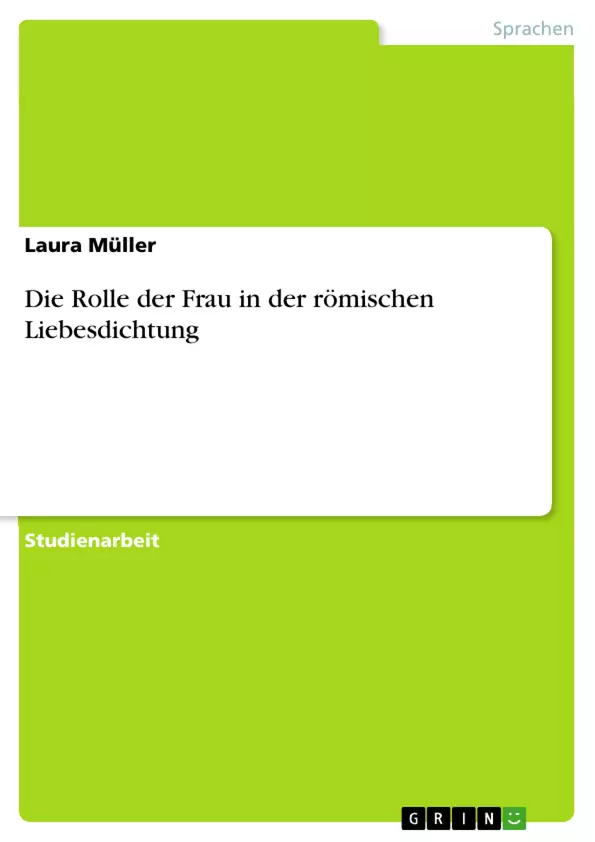Die römischen Liebeselegien stammen aus der Zeit, die 27 v. Chr. mit der Herrschaft von Kaiser Augustus begann und insgesamt 250 Jahre andauerte: Die Zeit des Augusteischen Friedens („Pax Augusta“), die durch eine innere Ruhe im römischen Staat bestimmt war. Hinter dem römischen Staat lagen viele Bürgerkriege und Unruhen. Durch den neuen Kaiser Augustus wurde eine neue Verwaltungsstruktur aufgebaut. Augustus war der Großneffe von Gaius Iulius Cäsar und ist hier zu Lande vor allen Dingen durch die biblische Weihnachtsgeschichte im Hinblick auf die Volkszählung bekannt.
Corinna, Cynthia und Delia sind Namen, die für die römischen Elegiker aus der Augusteischen Epoche Bände sprechen. Die Frauen sind für die Dichter Anfang und Ende und durch diese entstanden die sogenannten römischen Elegien, die nicht nur im Lateinunterricht noch bis heute Einfluss ausüben.
Der Themenschwerpunkt liegt dabei auf dem Aspekt der Liebe und den damit verbundenen subjektiven Erfahrungen des Dichters. Diese Elegien kamen durch die Musen zustande, die die Inspiration gaben, die Gedanken zu Papier zu bringen. In dieser Arbeit soll die Rolle der Frau in der römischen Liebeslyrik thematisiert und das Auswirken ihres Verhaltens in Hinblick auf den Geliebten untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtlicher Hintergrund
- Grundhaltung elegischer Dichtung
- Die Rolle der Frau in den römischen Liebeselegien
- Ovid
- Properz
- Tibull
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Rolle der Frau in der römischen Liebeslyrik und untersucht, wie ihr Verhalten sich auf den Geliebten auswirkt. Sie beleuchtet den geschichtlichen Kontext der Elegien und analysiert die Grundzüge und Leitmotive dieser literarischen Form. Im Fokus stehen Auszüge aus Elegien von Ovid, Properz und Tibull, die auf Latein und Deutsch präsentiert werden, um den Typus Frau zu charakterisieren und ihre Bedeutung in der Gedichtsschreibung zu definieren.
- Der Einfluss der Frau auf den Geliebten in der römischen Liebeslyrik
- Die Rolle von Corinna, Cynthia und Delia als Inspiration für die römischen Elegiker
- Die Grundzüge und Leitmotive der elegischen Dichtung
- Die Darstellung der Frau in den Elegien von Ovid, Properz und Tibull
- Die Bedeutung der Frau in der Gedichtsschreibung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Arbeit stellt die römischen Elegiker und ihre musischen Inspirationen Corinna, Cynthia und Delia vor. Sie erläutert den Themenschwerpunkt der Liebe und die subjektiven Erfahrungen des Dichters. Die Einleitung gibt einen Überblick über die Ziele und den Aufbau der Arbeit.2. Geschichtlicher Hintergrund
Dieses Kapitel setzt die römischen Liebeselegien in den historischen Kontext der Zeit des Augusteischen Friedens (27 v. Chr. - 14 n. Chr.). Es beschreibt die politische und gesellschaftliche Situation in Rom unter Kaiser Augustus und seinen Einfluss auf die Entwicklung der Literatur.3. Grundhaltung elegischer Dichtung
Das Kapitel beleuchtet die Grundzüge und Leitmotive der elegischen Dichtung. Es werden zentrale Elemente wie das „foedus aeternum“ (die Liebe als Dauerzustand) und die „militia amoris“ (die Liebe als Kriegsdienst) erläutert und mit Beispielen aus den Werken von Ovid, Properz und Tibull veranschaulicht.Schlüsselwörter
Römische Liebeslyrik, Elegien, Corinna, Cynthia, Delia, Ovid, Properz, Tibull, „foedus aeternum“, „militia amoris“, Augusteischer Frieden, Kaiser Augustus, Frauenrolle, Liebeserfahrungen, Gedichtanalyse.Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Frauen in der römischen Liebeselegie?
Frauen wie Corinna, Cynthia und Delia fungieren als Musen und zentraler Mittelpunkt der Gedichte; sie sind Auslöser für die subjektiven Liebeserfahrungen der Dichter.
Was bedeutet der Begriff "militia amoris"?
Es ist ein Leitmotiv, das die Liebe als eine Art "Kriegsdienst" darstellt, in dem der Liebende um die Gunst der Frau kämpfen muss.
Wer sind die wichtigsten römischen Elegiker?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Werke von Ovid, Properz und Tibull aus der Augusteischen Epoche.
Was ist das "foedus aeternum"?
Es bezeichnet den Wunsch nach einem "ewigen Bund" oder einer lebenslangen Treueverpflichtung in der Liebe, die oft im Kontrast zur Realität steht.
Wie beeinflusste Kaiser Augustus die Dichtung?
Die Zeit des "Pax Augusta" bot die innere Ruhe für die Entfaltung der Literatur, auch wenn die Elegiker oft private Themen über staatliche Belange stellten.
- Arbeit zitieren
- Laura Müller (Autor:in), 2016, Die Rolle der Frau in der römischen Liebesdichtung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424200