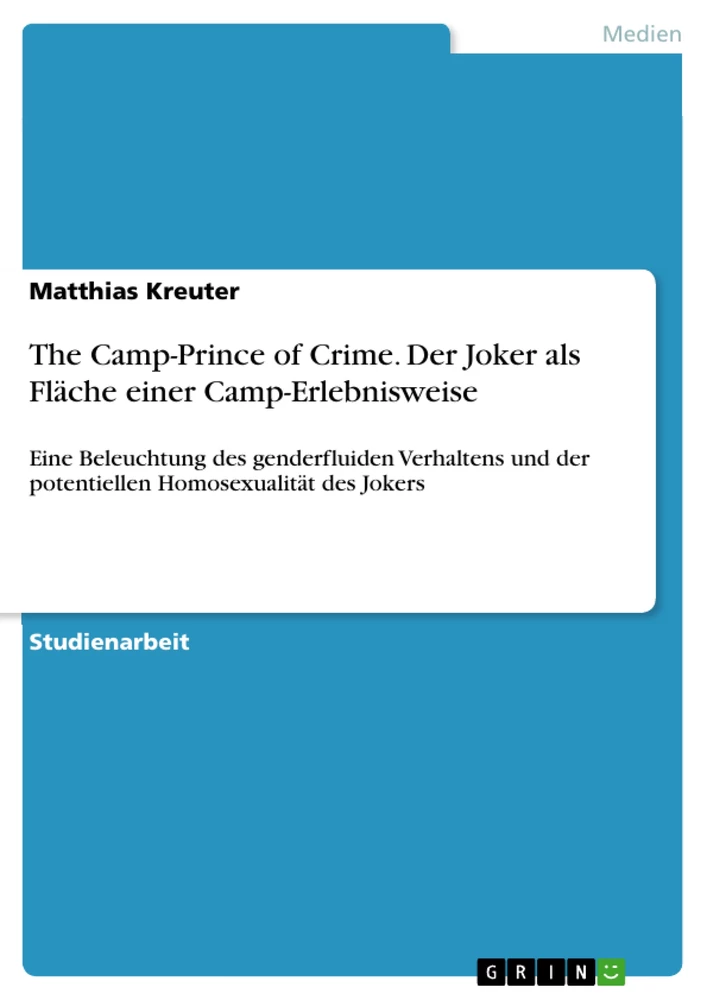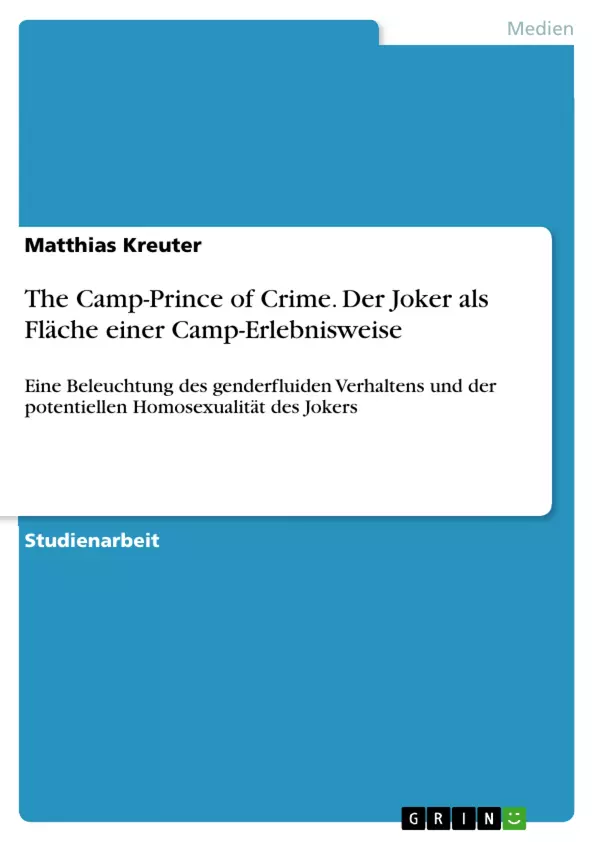Die einzigartige Beziehung zwischen Camp und dem Superhelden-Genre wurde mit der 1966 erstmals ausgestrahlten TV-Serie Batman begründet. Erst zwei Jahre zuvor hatte Susan Sontag mit ihrem Aufsatz "Notes on 'Camp'" (1964) den Begriff Camp im ästhetischen Diskurs stark gemacht und erste theoretische Parameter etabliert.
Über die Jahrzehnte sollte nicht nur der Camp-Begriff überleben, sondern mit dem Erfolg der deutlich durch seinen Camp-Stil gekennzeichneten Serie auch die allgemeine Annahme, Camp und Superhelden in Film und Fernsehen seien unzertrennlich miteinander verknüpft. Seit Beginn des neuen Superhelden-Booms Anfang der 2000er, spätestens aber mit dem ernsteren Anstrich, den das Genre durch Christopher Nolans Batman-Filme erhielt, hat sich letzteres relativiert. Die Suche nach den Stellen, an denen Camp in diesem Genre überlebt hat, führt einen zwangsläufig zu einer seiner theatralischsten Figuren: der Joker.
Diese Arbeit widmet sich der Frage, inwieweit Camp eine zentrale Eigenschaft des Jokers ist und so durch den Joker innerhalb des Superhelden-Genres ermöglicht und gefördert wird. In diesem Zusammenhang werden auch Fragen nach dem genderfluiden Verhalten des Jokers und seiner potenziellen Homosexualität beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Camp eine Begriffsannäherung
- Erste Definitionsversuche nach Susan Sontag
- Kritik an Sontag die politische Komponente des Camp
- Camp im Superhelden-Genre
- Zwischenfazit und neue Prämisse
- Ein Charakterisierungsversuch des Jokers als Camp-Person
- Der Joker als Pop-Camp
- Der Joker als queer Camp
- Der Joker in Christopher Nolans The Dark Knight
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Camp im Superhelden-Genre, insbesondere am Beispiel des Jokers. Sie analysiert Camp als ästhetische Erlebnisweise und zeigt auf, wie der Joker diese Charakteristik in Christopher Nolans The Dark Knight (2008) verkörpert.
- Definition und Entwicklung des Camp-Begriffs
- Camp als ästhetisches Prinzip und dessen subversive Potenziale
- Analyse des Jokers als Camp-Person und seine Darstellung in The Dark Knight
- Die Verbindung zwischen Camp und dem Superhelden-Genre
- Die Rolle von Theatralität und Gender in der Camp-Ästhetik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in die Verbindung zwischen Camp und dem Superhelden-Genre ein und stellt die These auf, dass der Joker eine zentrale Camp-Figur im Genre verkörpert.
- Camp eine Begriffsannäherung: Dieses Kapitel beleuchtet den Camp-Begriff aus unterschiedlichen Perspektiven, insbesondere die frühen Definitionen von Susan Sontag und die Diskussion um die politische Dimension von Camp.
- Ein Charakterisierungsversuch des Jokers als Camp-Person: Hier werden die Merkmale des Jokers analysiert, um zu zeigen, inwiefern er die Merkmale von Pop-Camp und queer Camp verkörpert.
- Der Joker in Christopher Nolans The Dark Knight: Dieses Kapitel untersucht die Interpretation des Jokers in Nolans Film und zeigt auf, inwiefern seine Darstellung Camp-Elemente beinhaltet.
Schlüsselwörter
Camp, Superhelden-Genre, Joker, Christopher Nolan, The Dark Knight, Ästhetik, Künstlichkeit, Theatralität, Gender, Subversion, Pop-Kultur, Queer-Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff 'Camp' in der Ästhetik?
Camp bezeichnet eine ästhetische Erlebnisweise, die durch Künstlichkeit, Theatralität und eine ironische Distanz gekennzeichnet ist, wie sie Susan Sontag 1964 definierte.
Warum gilt der Joker als Camp-Figur?
Der Joker verkörpert durch sein theatralisches Auftreten, seine Künstlichkeit und sein teils genderfluides Verhalten zentrale Merkmale von Pop-Camp und Queer-Camp.
Wie verhält sich Camp zum Superhelden-Genre?
Die Verbindung wurde durch die Batman-TV-Serie von 1966 geprägt. Die Arbeit untersucht, wie Camp trotz moderner, ernsterer Verfilmungen in Charakteren wie dem Joker überlebt.
Wird der Joker in Christopher Nolans 'The Dark Knight' als Camp analysiert?
Ja, die Arbeit untersucht, inwieweit Heath Ledgers Darstellung des Jokers trotz des realistischen Stils des Films Camp-Elemente und subversive Potenziale enthält.
Spielen Gender-Aspekte eine Rolle bei der Charakterisierung?
Ja, die Untersuchung beleuchtet das genderfluide Verhalten des Jokers und Fragen nach potenzieller Homosexualität im Kontext der Camp-Ästhetik.
- Quote paper
- Matthias Kreuter (Author), 2016, The Camp-Prince of Crime. Der Joker als Fläche einer Camp-Erlebnisweise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424266