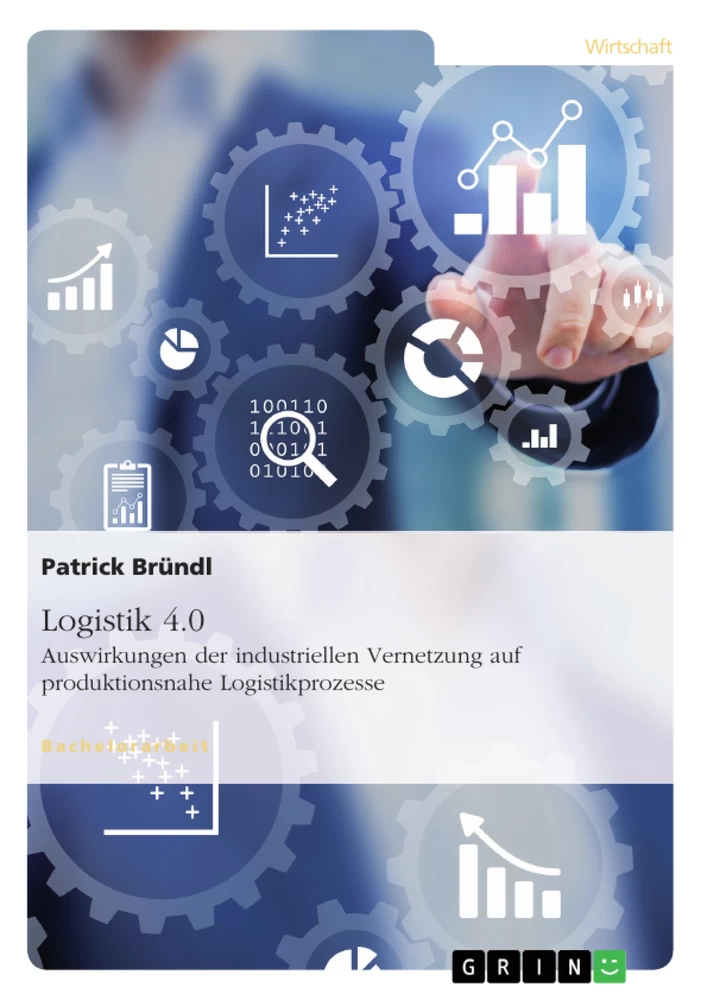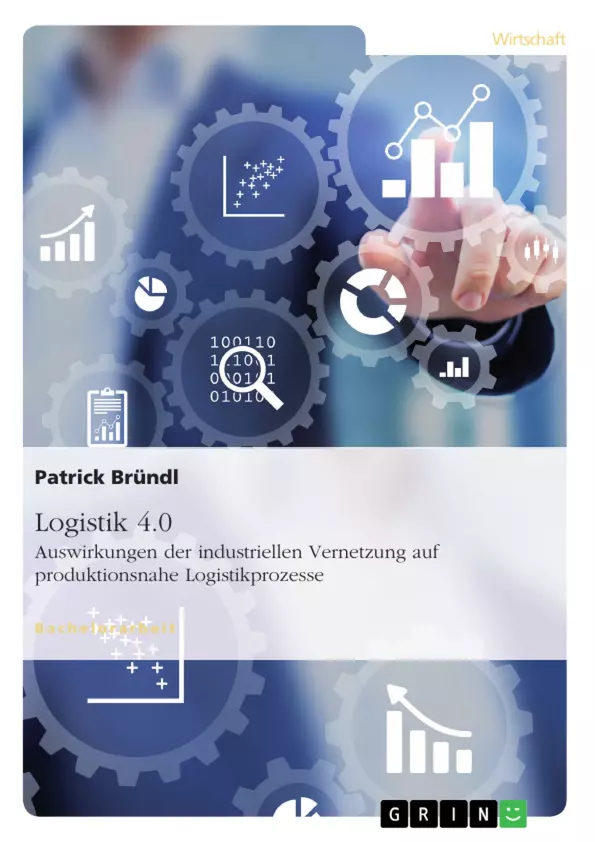Die im Rahmen der Industrie 4.0 entwickelten Konzepte finden in einem Großteil der Industriebetriebe weltweit noch keine bzw. geringe praktische Anwendung. Auch die Forschung, insbesondere im Bereich der Anwendung industrieller Vernetzung auf logistische Prozesse, befindet sich in einem noch frühen Stadium. Daher setzt sich diese Arbeit das Ziel den aktuellen Stand der Forschung im Bereich der Logistik 4.0 systematisch abzubilden, bestehende Ansätze zu verknüpfen sowie Forschungslücken aufzuzeigen.
Im zweiten Kapitel werden hierzu die theoretischen Grundlagen und Definitionen, die im Zusammenhang mit den Themengebieten Industrie 4.0 und Logistik stehen, erläutert. Hierbei werden insbesondere auch die technischen Grundlagen für den Wandel zur Logistik 4.0 kurz erklärt, um somit eine Basis für die späteren Auswertungsergebnisse zu schaffen. In Kapitel 3 wird die verwendete Methodik dieser Arbeit vorgestellt, wobei neben der Erläuterung des Suchvorgangs der Schwerpunkt in der Beschreibung der limitierenden Faktoren und der Methodik der Literaturauswertung liegt. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse präsentiert und die gestellten Forschungsfragen diskutiert. Abschließend folgt ein Fazit, welches neben einer kurzen Zusammenfassung der Arbeit auch deren Limitationen sowie den weiteren Forschungsbedarf im Themengebiet Logistik 4.0 aufzeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Gang der Untersuchung
- Theoretische Grundlagen
- Logistik
- Logistik 4.0
- Industrie 4.0
- Radio-Frequency Identification
- Cloud Computing
- Multiagentensysteme
- Methodik
- Auswahl des betrachteten Zeitraumes
- Auswahl der Datenbanken
- Auswahl der Publikationsarten
- Auswahl der Artikel
- Klassifizierung der Artikel
- Auswertung der Klassifizierung
- Auswertung der Ergebnisse
- Interne Logistik
- Informationssysteme
- Materialtransport
- Materiallagerung
- Prozessänderungen
- Unternehmensübergreifende Logistik
- Horizontale Integration
- Externer Transport
- Auswirkungen auf Mitarbeiter
- Arbeitsbedingungen
- Arbeitsmarkt
- Diskussion der Ergebnisse
- Themenbereiche
- Zeitablauf
- Geographisches Profil
- Fazit
- Zusammenfassung
- Limitationen und weiterer Forschungsbedarf
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der industriellen Vernetzung auf produktionsnahe Logistikprozesse im Kontext von Logistik 4.0. Ziel ist es, die aktuellen Forschungs- und Anwendungsgebiete in diesem Bereich zu identifizieren und zu analysieren.
- Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien in der Logistik
- Optimierung von Materialfluss und Lagerhaltung
- Einfluss von Industrie 4.0 auf interne und externe Logistikprozesse
- Automatisierung und Digitalisierung in der Produktionslogistik
- Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen und Arbeitsmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und die Zielsetzung der Untersuchung darlegt. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zu Logistik, Logistik 4.0, Industrie 4.0 und weiteren relevanten Technologien erläutert. Im dritten Kapitel wird die Methodik der Untersuchung beschrieben, die auf einer systematischen Literaturauswahl und -analyse basiert. Das vierte Kapitel widmet sich der Auswertung der Ergebnisse, wobei die Auswirkungen der industriellen Vernetzung auf verschiedene Bereiche der Logistik betrachtet werden. Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse diskutiert, wobei insbesondere die Themenbereiche, der Zeitablauf und das geographische Profil der Forschung betrachtet werden. Das sechste Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und stellt Limitationen und weiteren Forschungsbedarf heraus.
Schlüsselwörter
Logistik 4.0, Industrie 4.0, Vernetzung, Produktionslogistik, Informations- und Kommunikationstechnologien, Materialfluss, Lagerhaltung, Automatisierung, Digitalisierung, Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Logistik 4.0?
Logistik 4.0 bezeichnet die Anwendung von Industrie 4.0-Konzepten (Vernetzung, Digitalisierung) auf logistische Prozesse zur Optimierung von Materialflüssen.
Welche Technologien sind die Basis für Logistik 4.0?
Zentrale Technologien sind RFID (Radio-Frequency Identification), Cloud Computing und Multiagentensysteme.
Wie verändert industrielle Vernetzung die interne Logistik?
Sie ermöglicht automatisierte Materialtransporte, intelligente Lagerhaltung und Echtzeit-Informationssysteme innerhalb der Produktion.
Welche Auswirkungen hat Logistik 4.0 auf die Mitarbeiter?
Die Arbeitsbedingungen wandeln sich durch digitale Assistenzsysteme; gleichzeitig entstehen neue Anforderungen am Arbeitsmarkt durch die fortschreitende Automatisierung.
Was bedeutet horizontale Integration in der Logistik?
Es beschreibt die unternehmensübergreifende Vernetzung der Logistikketten zwischen verschiedenen Partnern entlang der Supply Chain.
- Citar trabajo
- Patrick Bründl (Autor), 2017, Logistik 4.0. Auswirkungen der industriellen Vernetzung auf produktionsnahe Logistikprozesse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424298