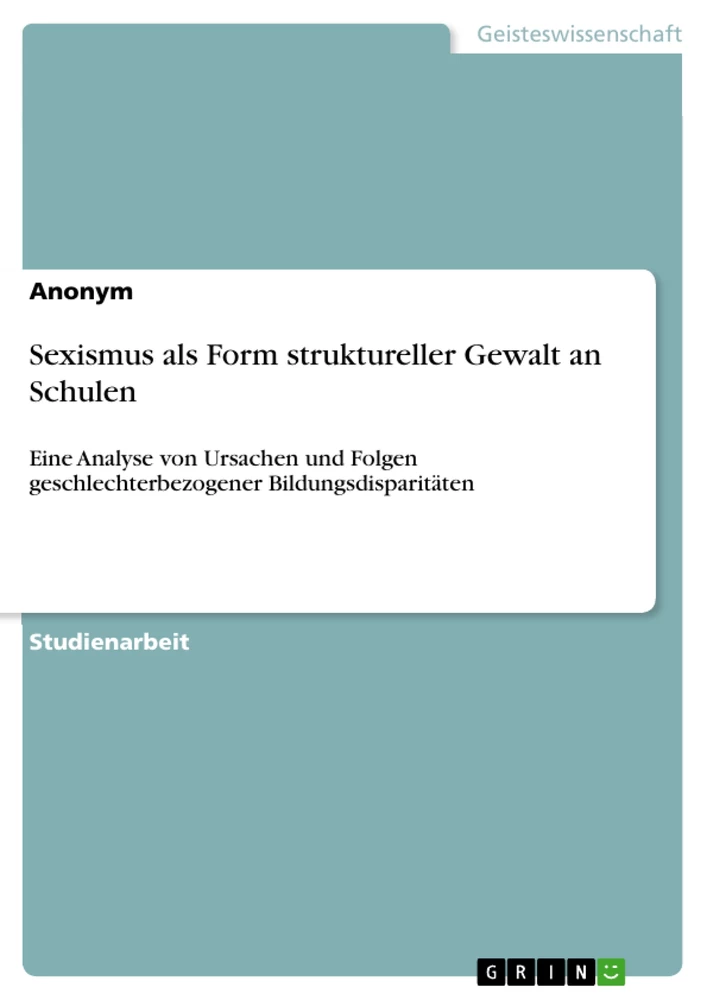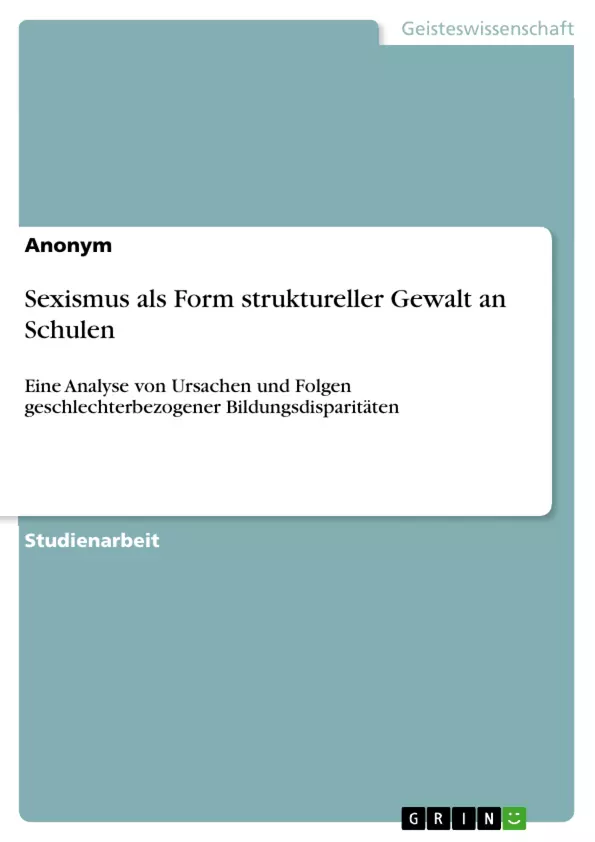Sexismus tritt in allen Bereichen unseres Lebens auf. Ob Werbung, die Rollenklischees bedient, die noch immer großen Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen, welche sich auch negativ auf die Altersarmut von Frauen auswirken oder gar sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Jeder wird früher oder später – ob bewusst oder unbewusst – mit Sexismus konfrontiert. Auch die Schule ist von der Problematik nicht ausgeschlossen.
Das Deutsche Institut für Internationale pädagogische Forschung legte den Gesamtbericht "PISA 2009 - Bilanz nach einem Jahrzehnt" vor. Das Deutsche Bildungssystem habe sich zwar insgesamt deutlich verbessert, jedoch seien geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede nach wie vor deutlich. Mädchen zeigen höhere Leistungen im Lesen, wogegen Jungen im mathematischen Bereich glänzen konnten (Gender und Schule, 2018). Diese Leistungs- und Interessenunterschiede wirken sich auch auf die spätere Berufswahl aus. Einige Ausbildungsberufe, die bei Frauen in den Top 10 liegen, wie Friseur*in, Zahn-/medizinische*r Fachangestellte*r oder Verwaltungsfachangestellte*r liegen bei Männern zwischen dem 31. Und 134. Rang der beliebtesten Ausbildungsberufe (Beicht, 2014). Um dem entgegenzuwirken entstanden Initiativen wie die Girls‘ Day und später auch Boys‘ Day Aktionstage um den Schülern einen Einblick in Berufe zu bieten, die nicht den Geschlechterklischees entsprechen (girls-day.de, 2018).
Das deutsche Bildungssystem setzt sich also bereits mit der Thematik des Sexismus und Lösungsansätzen auseinander. Doch was genau ist Sexismus und welche Rolle spielt Geschlechterbezogene Diskriminierung an Schulen? Welche Folgen haben Geschlechterstereotype für Schüler*innen und wie kann dem entgegengewirkt werden?
Die Frage, wie sich Sexismus äußert, welche Auswirkungen das auf Schulen hat und wie damit umgegangen werden kann, soll in der folgenden Arbeit thematisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Relevanz von Sexismus heute
- Sexismus als Form struktureller Gewalt
- Geschlechterstereotype und deren Folgen
- Entstehung von Genderrollen
- Folgen von Geschlechterstereotypen
- Äußerung von Sexismus im Alltag
- Sexismus an Schulen
- Differentielle Bildungsbeteiligung von Jungen und Mädchen
- Geschlechterdifferenzierte Schulleistungen
- Sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze
- Möglichkeiten zum Umgang mit Sexismus an Schulen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bedeutung von Sexismus als Form struktureller Gewalt an Schulen. Sie untersucht die Ursachen und Folgen von geschlechterbezogenen Bildungsdisparitäten, insbesondere die Auswirkungen von Geschlechterstereotypen. Die Arbeit beleuchtet, wie sich Sexismus im Alltag äußert, wie er sich in schulischen Kontexten manifestiert und welche Möglichkeiten es gibt, um dem entgegenzuwirken.
- Sexismus als Form struktureller Gewalt
- Geschlechterstereotype und deren Auswirkungen auf die Bildungsbeteiligung
- Sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze für Geschlechterdisparitäten in der Bildung
- Der Einfluss von Sexismus auf Schulleistungen und Berufswahl
- Möglichkeiten zur Prävention und Bekämpfung von Sexismus an Schulen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Relevanz von Sexismus heute
Dieses Kapitel stellt die Relevanz von Sexismus in unserer Gesellschaft dar und zeigt auf, wie er sich in verschiedenen Lebensbereichen manifestiert, z. B. in der Werbung, den Einkommensdifferenzen zwischen Männern und Frauen und sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz. Es wird gezeigt, wie auch das deutsche Bildungssystem sich mit der Problematik des Sexismus und Lösungsansätzen auseinandersetzt, beispielsweise durch Initiativen wie den Girls' Day und den Boys' Day.
2 Sexismus als Form struktureller Gewalt
Dieses Kapitel definiert Sexismus als eine Form der Diskriminierung, die auf das Geschlecht von Personen abzielt. Es wird erläutert, wie Sexismus sich im Alltag äußert, und die Auswirkungen von Geschlechterstereotypen auf die Gesellschaft und einzelne Personen werden diskutiert.
2.1 Geschlechterstereotype und deren Folgen
Dieser Abschnitt behandelt die Entstehung von Geschlechterrollen und deren Folgen. Das biosoziale Rollenmodell von Eagly & Wood (1999) wird vorgestellt, das die Entstehung von Geschlechterstereotypen durch die Beobachtung der Tätigkeiten des jeweiligen Geschlechts in einer Gesellschaft erklärt. Die Auswirkungen von Geschlechterstereotypen auf das Selbstbild und die Leistungen von Kindern werden erläutert.
3 Sexismus an Schulen
Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von Sexismus auf den schulischen Kontext. Es beleuchtet die differentielle Bildungsbeteiligung von Jungen und Mädchen, die geschlechterdifferenzierten Schulleistungen und die sozialwissenschaftlichen Erklärungsansätze für diese Unterschiede. Außerdem werden Möglichkeiten zum Umgang mit Sexismus an Schulen diskutiert.
Schlüsselwörter
Sexismus, strukturelle Gewalt, Geschlechterstereotype, Bildungsdisparitäten, Genderrollen, Bildungsbeteiligung, Schulleistungen, sozialwissenschaftliche Erklärungsansätze, Präventionsmaßnahmen, Antidiskriminierung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Sexismus als Form struktureller Gewalt an Schulen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424382