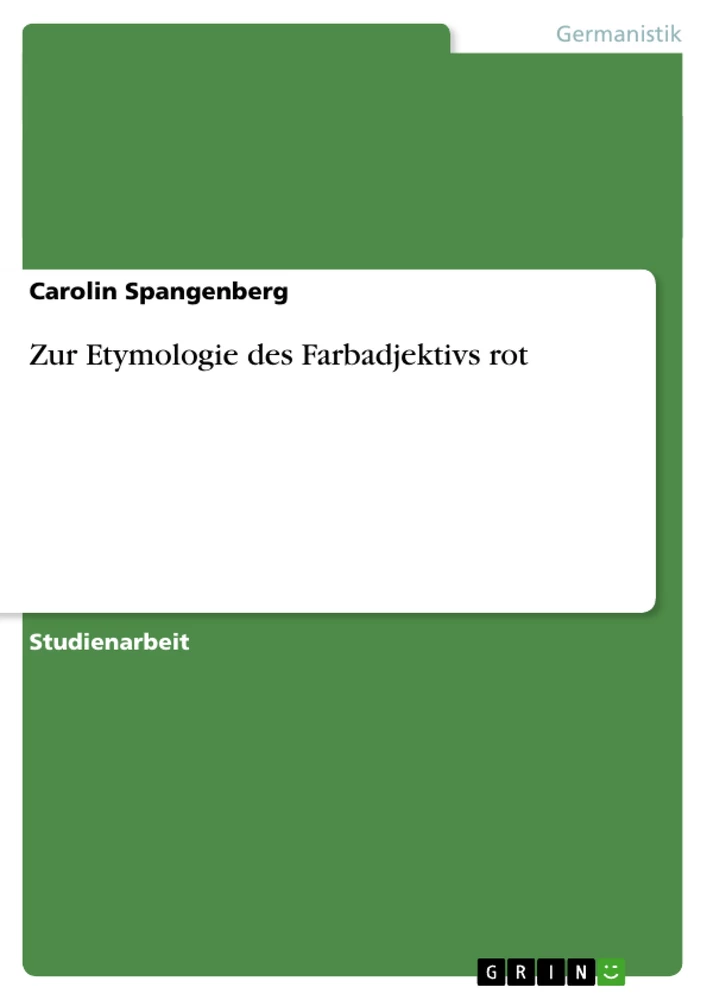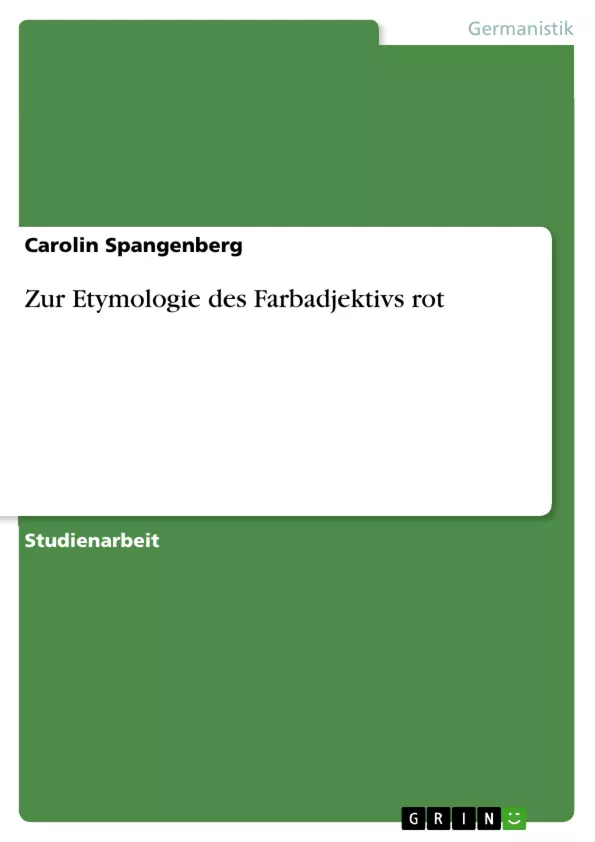Einleitung
Auf einer Internetseite fand ich zum Thema Farbbedeutung rot die folgenden Aphorismen, die man aus heutiger Sicht in Verbindung mit rot setzt. „Rot steht für die Liebe, Körperbewusstsein, Selbstvertrauen, Furchtlosigkeit, Kraft, Durchhaltevermögen, Sinnlichkeit, Triebhaftigkeit, Leidenschaft, Wut, Hass, Selbständigkeit, Lebenslust, Macht und Eroberung.“1 In der vorliegenden Arbeit möchte ich versuchen das Farbadjektiv rot etymologisch zu untersuchen. Dabei versuche ich herauszufinden, ob die oben genannten Assoziationen zu rot in Verbindung stehen mit der geschichtlichen Entwicklung und Bedeutung dieser Farbe. Somit ist es also nicht nur wichtig, sich der lexikalischen und semantischen Darstellungen anzunehmen sondern auch die Kulturgeschichte diese Farbadjektivs zu betrachten. Darüber hinaus gilt die Aufmerksamkeit auch den Phraseologismen, den typischen Wortverbindungen und charakteristischen Redensarten, die mit rot in Zusammenhang gebracht werden. Denn mit Hilfe der Intention dieser Phaseologismen kann man auch die Wortbedeutung und Wortgeschichte der Farbe rot verständlich und logisch darstellen beziehungsweise belegen. Beginnen möchte ich mit der etymologischen Betrachtung des Begriffes Farbe, um aufzuzeigen wie das Wort entstanden ist und wie sich die Bedeutung, des uns heute bekannten Oberbegriffes für alle Farben, im Laufe der Zeit verändert hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Etymologische Betrachtung zum Begriff Farbe
- Etymologie des Farbadjektivs rot
- Lexikalische und semantische Darstellung der Wortgeschichte
- Kulturgeschichtliche Bedeutung der Farbe Rot
- Die traditionelle Wirkung
- Die psychologische und symbolische Wirkung
- Farbphraseologische Verbindungen mit dem Adjektiv rot
- Teilsweise idiomatisierte adnominale Farbphraseologismen
- Vollständig idiomatisierte adnominale Farbphraseologismen
- Nicht-adnominale Farbphraseologismen
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Etymologie des Farbadjektivs „rot“, berücksichtigt dabei kulturgeschichtliche Aspekte und farbphraseologische Verbindungen. Ziel ist es, die historische Entwicklung und Bedeutung der Farbe Rot zu erforschen und herauszufinden, inwieweit heutige Assoziationen mit der historischen Entwicklung zusammenhängen.
- Etymologische Entwicklung des Wortes „rot“
- Kulturgeschichtliche Bedeutung der Farbe Rot
- Semantische Entwicklung und Wandel der Bedeutung von „rot“
- Analyse von farbphraseologischen Verbindungen mit „rot“
- Vergleich mit verwandten Wörtern in anderen indogermanischen Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt die Forschungsfrage: Inwiefern hängen heutige Assoziationen mit der Farbe Rot mit ihrer historischen Entwicklung zusammen? Sie erwähnt Assoziationen wie Liebe, Wut, Macht etc. und kündigt den methodischen Ansatz an, der lexikalische, semantische und kulturgeschichtliche Aspekte sowie Phraseologismen umfasst.
Etymologische Betrachtung zum Begriff Farbe: Dieses Kapitel beleuchtet die etymologische Entwicklung des Wortes „Farbe“ selbst. Es zeigt die Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Ursprungs auf und präsentiert verschiedene Theorien, die von einer indogermanischen Wurzel bis hin zu einem arabischen Lehnwort reichen. Es wird hervorgehoben, dass die Bedeutung von „Farbe“ sich im Laufe der Zeit vom ursprünglichen Fokus auf Aussehen und Form hin zu einer wissenschaftlicheren Betrachtung von Pigmenten und Eigenschaften gewandelt hat.
Etymologie des Farbadjektivs rot: Dieses Kapitel ist der Kern der Arbeit. Der Abschnitt zur lexikalischen und semantischen Darstellung der Wortgeschichte verfolgt die Entwicklung des Wortes „rot“ von althochdeutschen und mittelhochdeutschen Belegen bis zu seinen indogermanischen Wurzeln. Es wird die weitverbreitete Verwendung in indogermanischen Sprachen und die vielfältigen Bedeutungsnuancen, inklusive der bildlichen Verwendung von „rot“ als Synonym für „falsch“ oder „listig“, herausgestellt. Der Abschnitt zur kulturgeschichtlichen Bedeutung diskutiert die traditionelle und psychologische/symbolische Wirkung der Farbe Rot. Der letzte Teil befasst sich mit farbphraseologischen Verbindungen, unterteilt in teilweise und vollständig idiomatisierte sowie nicht-adnominale Verbindungen. Dies dient dazu, die Bedeutung und Wortgeschichte von „rot“ durch die Analyse von typischen Wortverbindungen zu belegen.
Schlüsselwörter
Etymologie, Farbadjektiv, Rot, Wortgeschichte, Kulturgeschichte, Semantik, Phraseologie, Indogermanisch, Farbassoziationen, Wortbedeutung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Etymologie des Farbadjektivs „rot“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der etymologischen Untersuchung des Farbadjektivs „rot“. Sie analysiert die historische Entwicklung des Wortes, seine kulturgeschichtliche Bedeutung und seine Verwendung in farbphraseologischen Verbindungen. Ein zentrales Thema ist der Zusammenhang zwischen der historischen Entwicklung und den heutigen Assoziationen mit der Farbe Rot.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine etymologische Betrachtung des Wortes „Farbe“ selbst, eine detaillierte Untersuchung der etymologischen Entwicklung des Wortes „rot“ von seinen indogermanischen Wurzeln bis zu den heutigen Verwendungsweisen, die kulturgeschichtliche Bedeutung der Farbe Rot (traditionelle und psychologische/symbolische Wirkung), und eine Analyse von farbphraseologischen Verbindungen mit „rot“, differenziert nach verschiedenen Typen (teilweise und vollständig idiomatisierte sowie nicht-adnominale Verbindungen). Vergleiche mit verwandten Wörtern in anderen indogermanischen Sprachen werden ebenfalls angestellt.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern hängen heutige Assoziationen mit der Farbe Rot mit ihrer historischen Entwicklung zusammen?
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine interdisziplinäre Methode, die lexikalische, semantische und kulturgeschichtliche Ansätze sowie die Analyse von Phraseologismen kombiniert. Sie stützt sich auf die Auswertung historischer Sprachdaten und die Interpretation kulturgeschichtlicher Zusammenhänge.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur etymologischen Betrachtung des Begriffs „Farbe“, ein zentrales Kapitel zur Etymologie des Farbadjektivs „rot“ (einschließlich lexikalisch-semantischer Darstellung der Wortgeschichte, kulturgeschichtlicher Bedeutung und farbphraseologischer Verbindungen), und Schlussbemerkungen. Die Kapitelzusammenfassungen geben detaillierte Einblicke in den jeweiligen Inhalt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Etymologie, Farbadjektiv, Rot, Wortgeschichte, Kulturgeschichte, Semantik, Phraseologie, Indogermanisch, Farbassoziationen, Wortbedeutung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die historische Entwicklung und Bedeutung der Farbe Rot zu erforschen und den Zusammenhang zwischen ihrer historischen Entwicklung und den heutigen Assoziationen aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Carolin Spangenberg (Autor:in), 2004, Zur Etymologie des Farbadjektivs rot, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42471