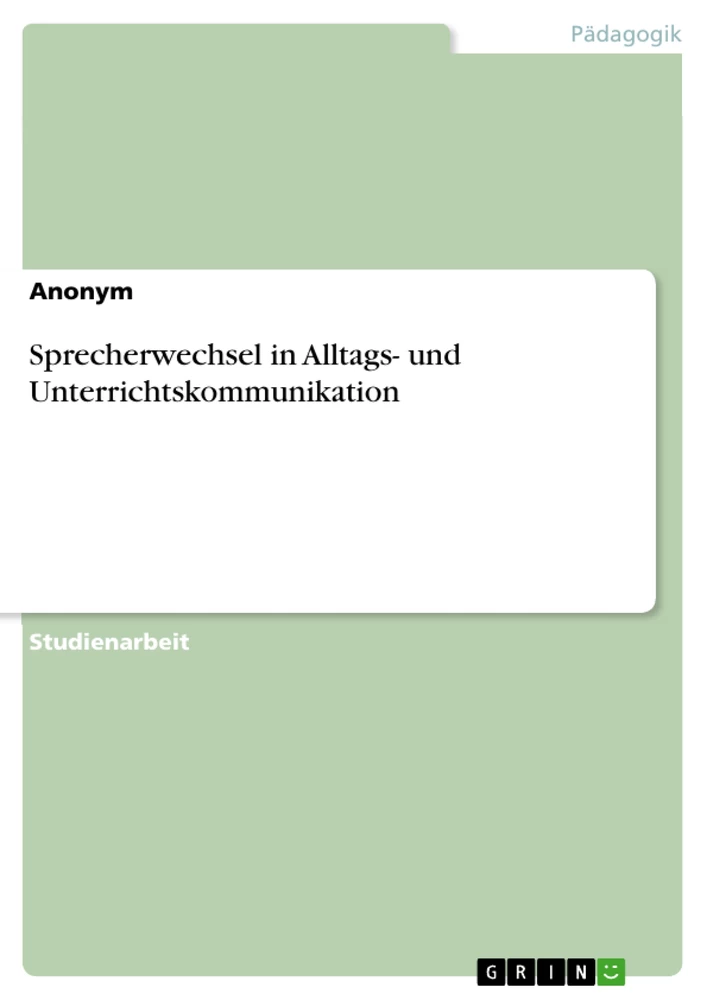Zu einem Gespräch bzw. einem Dialog braucht man mindestens zwei Gesprächsteilnehmer. Sie müssen für das Gelingen einer Kommunikation in zwei Rollen schlüpfen. Diese sind die Rolle des Hörers und die Rolle des Sprechers. Zudem müssen sie in der Lage sein, diese Rollen auch untereinander zu tauschen. Damit dies einwandfrei stattfinden kann, wurden verschiedene Arten des Sprecherwechsels festgelegt.
Auf diese Sprecherwechsel wird zu Beginn der Arbeit eingegangen. Der Fokus der Arbeit liegt in einem Vergleich des Sprecherwechsels in der Unterrichtssituation sowie im Alltag. Dazu wird zunächst die Makrostruktur beider Formen erläutert und voneinander differenziert. Darauf aufbauend wird auf die verschiedenen Formen des Sprecherwechsels im Alltag und im Unterricht eingegangen und die jeweilige Sprecheraktivität und Höreraktivität analysiert. Im Fazit wird dann direkt verglichen und die signifikantesten Unterschiede werden nochmals aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Alltagskommunikation
- Anfangsphase
- Gesprächsmitte
- Beendigungsphase
- Unterrichtskommunikation
- Eröffnungsphase
- Instruktionsphase
- Abschlussphase
- Der Sprecherwechsel
- Fremdwahl - Selbstwahl
- Formen des Sprecherwechsels
- Formen des Sprecherwechsels im Alltag
- Sprecheraktivität
- Höreraktivität
- Formen des Sprecherwechsels im Unterricht
- Sprecheraktivität
- Höreraktivität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Sprecherwechsel in der Alltags- und Unterrichtskommunikation. Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Ablauf und der Organisation des Sprecherwechsels in beiden Kontexten herauszuarbeiten.
- Makrostruktur von Alltags- und Unterrichtsgesprächen
- Formen des Sprecherwechsels in der Alltagskommunikation
- Formen des Sprecherwechsels in der Unterrichtskommunikation
- Sprecheraktivität und Höreraktivität im Sprecherwechsel
- Vergleich der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Alltags- und Unterrichtskommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Kommunikation in unserer Gesellschaft dar und führt in die Thematik des Sprecherwechsels ein. Sie betont die komplexen Aspekte der Kommunikation und die Bedeutung von Rollenwechseln im Gespräch.
Alltagskommunikation
Dieses Kapitel beschreibt die Makrostruktur eines Alltagsgesprächs, die in drei Phasen gegliedert ist: Anfangsphase, Gesprächsmitte und Beendigungsphase. Jede Phase wird anhand ihrer Merkmale und Besonderheiten erläutert.
Unterrichtskommunikation
Das Kapitel behandelt die Makrostruktur eines Unterrichtsgesprächs, das ebenfalls in drei Phasen unterteilt ist: Eröffnungsphase, Instruktionsphase und Abschlussphase. Die einzelnen Phasen werden im Hinblick auf ihre Funktion und die jeweiligen kommunikativen Besonderheiten analysiert.
Der Sprecherwechsel
Dieses Kapitel definiert die grundlegenden Begriffe "Turn" und "Turn-taking" im Zusammenhang mit dem Sprecherwechsel. Es legt die Grundlage für die weitere Analyse der verschiedenen Formen des Sprecherwechsels.
Formen des Sprecherwechsels im Alltag
Hier werden verschiedene Formen des Sprecherwechsels im Alltag anhand von Sprecheraktivität und Höreraktivität untersucht. Es werden konkrete Beispiele und Situationen aufgezeigt.
Formen des Sprecherwechsels im Unterricht
Dieses Kapitel untersucht die Formen des Sprecherwechsels im Unterricht, indem es die Sprecheraktivität und Höreraktivität in diesem Kontext analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Sprecherwechsels in Alltags- und Unterrichtskommunikation. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind daher Kommunikation, Sprecherwechsel, Turn-taking, Makrostruktur, Anfangsphase, Gesprächsmitte, Beendigungsphase, Eröffnungsphase, Instruktionsphase, Abschlussphase, Sprecheraktivität und Höreraktivität.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Sprecherwechsel in Alltags- und Unterrichtskommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424786