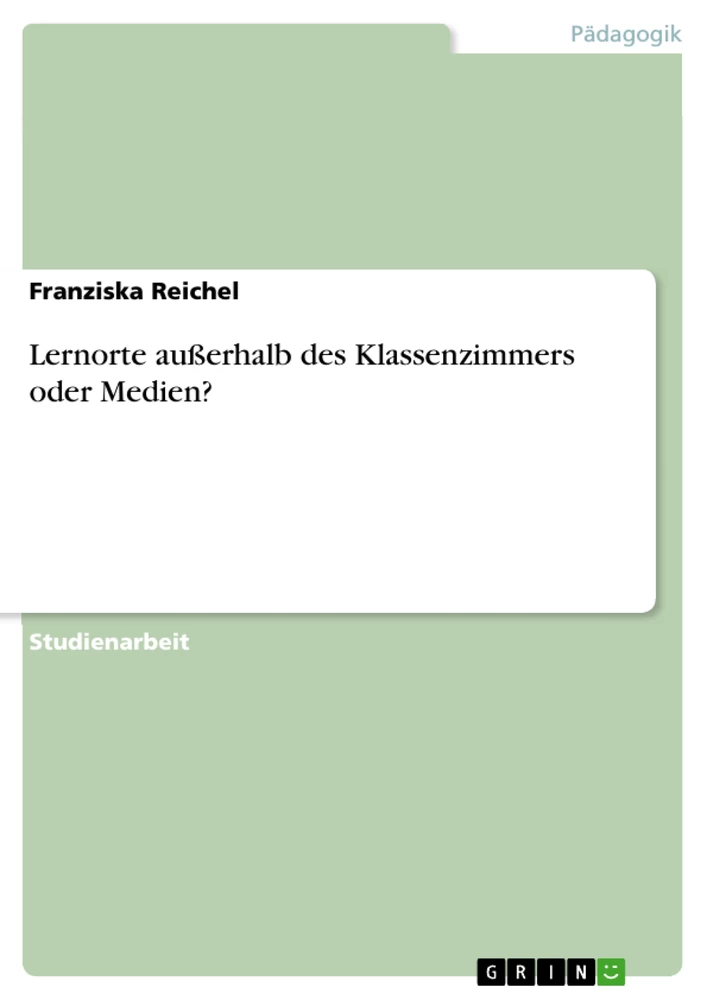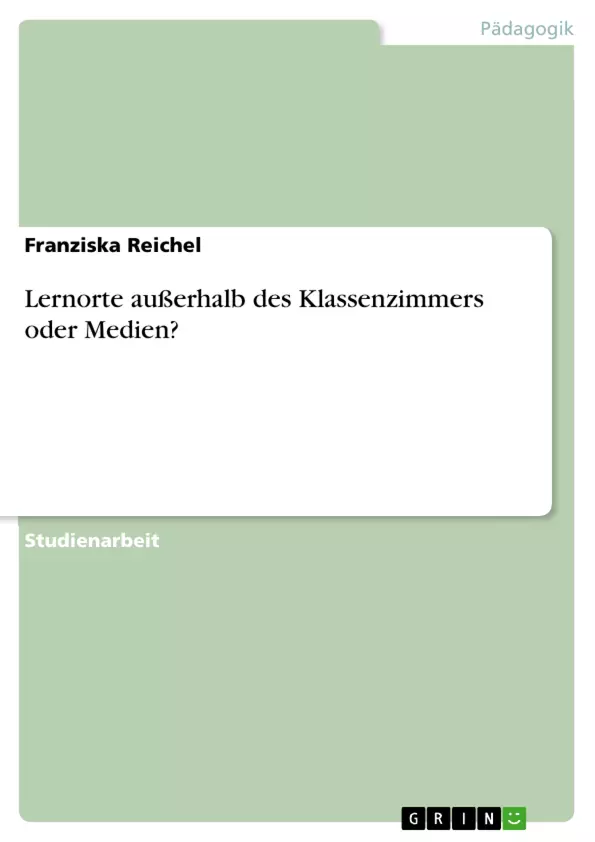Erkenntnistheoretische Aspekt (Konstruktivismus)
Der Begriff ‚Konstruktion′ wird vom lateinischen ‚constructa′ abgeleitet und bedeutet ‚gedanklicher Entwurf′, ‚Plan′, ‚Entwicklung′.
Konstruktivisten behaupten, es gibt keine allgemein endgültige Wahrheit bzw. Wirklichkeit. Jeder konstruiert seine Eigene. Das heißt, das Lernen des Schülers ist ein eigenständiger Konstruktionsprozess. Hiller und Popp unterscheiden eine Wirklichkeit erster Ordnung von einer Wirklichkeit zweiter Ordnung.
Unter Wirklichkeit erster Ordnung verstehen wir die Wirklichkeit, die objektiv feststell- und nachprüfbar ist (Tatsachen). Zum Beispiel: Im Supermarkt gibt es Sonderangebote.
Unter Wirklichkeit zweiter Ordnung verstehen wir die Wirklichkeit, die wir konstruieren, die andere aber auch ganze anders konstruieren können. Es ist die Wirklichkeit der Deutungen und subjektiven Bedeutungen. Zum Beispiel: Der Supermarkt als Einkaufsfalle.
Um den Begriff eines Gegenstandes wirklich zu verstehen, muss der Sinn des Gegenstandes erfasst worden sein. "Anschauen ist eine Tätigkeit". Um etwas wahrzunehmen, muss man etwas wissen und Fragen haben, sonst bleibt der Sinneskontakt oberflächlich und ohne wirklichen Erkenntnisgewinn. Das heißt, Sehen hängt vom Vorwissen des Betrachters ab.
1.) Wenn der Lehrer dem Schüler etwas vor die Augen stellt, sollte er das Vorwissen der Kinder prüfen, überlegen, welche Informationen vorab nötig sind. Schüler haben unterschiedliches Vorwissen und deshalb nehmen sie auch unterschiedlich wahr.
2.) Aus diesem Grund ist es wichtig, vorab einen persönlichen Bezug zum betrachteten Gegenstand aufzubauen. Man muss den Kindern ein Motiv liefern, sich mit etwas anschaulich auseinanderzusetzen.
Anschauen ist also ein aktiver Vorgang. Dies erfordert Anstrengung (genaues Hinsehen, Fragen stellen, Antworten finden). Kinder brauchen Motivation, Interesse, Neugier und Anstrengungsbereitschaft.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Erkenntnistheoretische Aspekt (Konstruktivismus)
- 2. Lernorte außerhalb des Klassenzimmers
- 2.1. Der Lehrplan für die Grundschule in Bayern 2000.
- 2.2. Lernorte und Lernstandorte.
- 2.3. Lernorte - Wozu?.
- 2.3.1. Aus reformpädagogischer Sicht...
- 2.3.2. Aus heutiger schulpädagogischer Sicht.
- 2.4. Durchführung eines Unterrichtsganges.
- 2.4.1. Lernorte - Wann?
- 2.4.2. Der methodische Dreischritt.
- 3. Medien..
- 3.1. Was sind Medien?
- 3.2. Ziele eines Medieneinsatzes
- 3.3. Funktionen der Medien.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung von Lernorten außerhalb des Klassenzimmers im Bildungsprozess der Grundschule. Dabei wird insbesondere der Konstruktivismus als erkenntnistheoretischer Rahmen herangezogen und die Relevanz von außerschulischen Lernorten für die Förderung von Wissen, Verständnis, Interesse, sozialem Verhalten und Werthaltungen beleuchtet.
- Konstruktivistische Lerntheorie
- Lernorte außerhalb des Klassenzimmers und ihre Bedeutung
- Der Lehrplan für die Grundschule in Bayern 2000 im Kontext außerschulischer Lernorte
- Reformpädagogische Ansätze und ihre Relevanz für die Gestaltung von Lernorten
- Methoden und Praxisbeispiele für den Einsatz von außerschulischen Lernorten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den konstruktivistischen Ansatz als erkenntnistheoretischen Rahmen für das Verständnis von Lernen. Es werden die Konzepte von "Wirklichkeit erster Ordnung" und "Wirklichkeit zweiter Ordnung" erläutert und die Bedeutung von Vorwissen und aktiver Wahrnehmung für den Lernprozess hervorgehoben.
Kapitel 2 widmet sich der Diskussion von Lernorten außerhalb des Klassenzimmers. Es wird der Lehrplan für die Grundschule in Bayern 2000 vorgestellt, der die Bedeutung von außerschulischen Lernorten betont und sie als Mittel zur Förderung von Interesse, Motivation und sozialem Verhalten einsetzt. Die Unterscheidung zwischen Lernorten und Lernstandorten sowie ihre Bedeutung in der Reformpädagogik werden ebenfalls beleuchtet.
Die Kapitel 2.3.1 und 2.3.2 analysieren die Vorteile von Lernorten aus reformpädagogischer und heutiger schulpädagogischer Sicht. Es wird die Bedeutung von handlungsorientiertem Unterricht, Erfahrungs- und Erkenntnisbildung sowie die Rolle von außerschulischen Lernorten bei der Entwicklung von gesundem Körper und Geist hervorgehoben.
Kapitel 2.4 befasst sich mit der konkreten Durchführung von Unterrichtsgängen an außerschulischen Lernorten. Es werden Fragen des Zeitmanagements und die Anwendung des methodischen Dreischritts (Planung, Durchführung, Evaluation) im Kontext außerschulischer Lernorte diskutiert.
Schlüsselwörter
Konstruktivismus, Lernorte, außerschulische Lernorte, Grundschule, Lehrplan, Reformpädagogik, Handlungsorientierter Unterricht, Erfahrungsbildung, Erkenntnisbildung, Methodischer Dreischritt, Unterrichtsgänge.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Konstruktivismus im Kontext des Lernens?
Lernen wird als eigenständiger Konstruktionsprozess des Schülers gesehen, bei dem Wissen auf Basis von Vorerfahrungen aktiv aufgebaut wird.
Warum sind Lernorte außerhalb des Klassenzimmers wichtig?
Sie ermöglichen handlungsorientierten Unterricht, fördern das Interesse und bieten reale Erfahrungen, die im Klassenzimmer nicht möglich sind.
Was ist der "methodische Dreischritt" bei Unterrichtsgängen?
Er besteht aus der sorgfältigen Planung, der Durchführung vor Ort und der anschließenden Evaluation im Unterricht.
Welche Rolle spielen Medien im Vergleich zu außerschulischen Lernorten?
Medien dienen als Unterstützung, können aber den direkten Sinneskontakt und die Primärerfahrung an einem realen Lernort nicht vollständig ersetzen.
Was unterscheidet Wirklichkeit erster und zweiter Ordnung?
Erstere umfasst objektiv nachprüfbare Tatsachen, Letztere die subjektiven Deutungen und Bedeutungen, die wir diesen Tatsachen geben.
- Quote paper
- Franziska Reichel (Author), 2002, Lernorte außerhalb des Klassenzimmers oder Medien?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4248