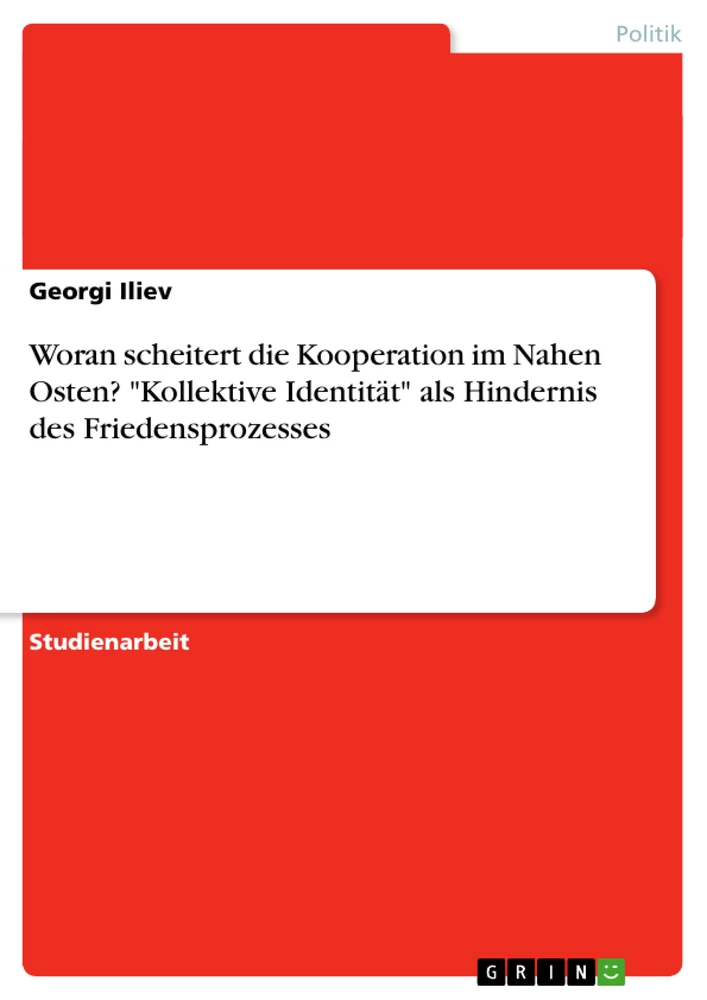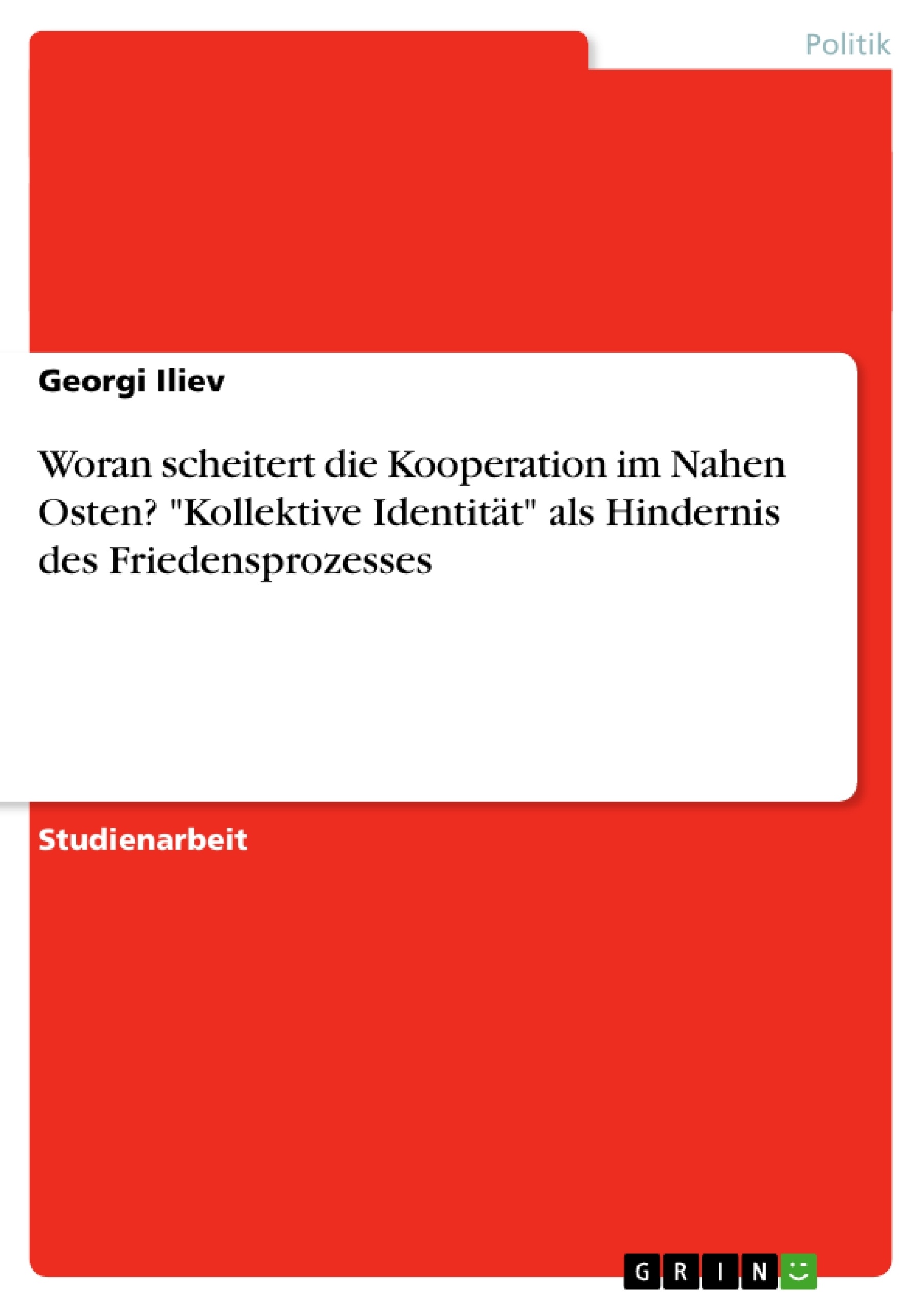Einleitung
Im Nahostkonflikt stehen sich nicht nur zwei Völker oder Kulturen gegenüber, sondern vor allem zwei kollektive Identitäten. „Kollektive Identität“ stellt keine natürliche Kategorie dar, sondern ein imaginäres Gebilde. Die Konstruktion von kollektiven Identitäten führt zur Herausbildung von bestimmten Denkschemata und Verhaltensmustern, die innerhalb des Kollektivs allgemein akzeptiert sind und als Grundlage für gesellschaftliche Normen und Werte, aber auch Mythen und kollektive Erinnerungen dienen. Sie werden durch Sozialisationsprozesse vom Volk aufgenommen und formen eine massenpsychologische Disposition, deren Heranziehung für das Zurechtkommen mit dem permanenten Konfliktzustand obligatorisch wird. Das jahrzehntelange Festhalten an solche Ressentiments konstituiert kollektive Identität als eine besonders starre Konstruktion. Angesichts einer fehlenden Vertrauensbasis zwischen Palästinenser und Israelis ist ein „Ausbrechen“ aus diesen festen und tief verwurzelten Strukturen infolge des Friedensprozesses nicht möglich. Um der Fragestellung nach den Auswirkungen der Konstruktion von „kollektiven Identitäten“ auf den Friedensprozesses gerecht werden zu können, werde ich mich im ersten Abschnitt dieser Arbeit mit den theoretischen Grundlagen dieses Konzeptes befassen. In diesem Komplex werde ich mich auf die Instrumentalisierung der Vergangenheit und auf Selbst- und Fremdzuschreibungen als zentrale Leitgedanken konzentrieren, um zu einer Arbeitsdefinition für den zweiten Teil dieser Arbeit zu gelangen.
Dieser beschäftigt sich dann mit der Analyse der konstituierenden Faktoren zur Konstruktion der „kollektiven Identitäten“ der palästinensischen und israelischen Gesellschaft. Mein Erkenntnisinteresse gilt im dritten Teil dieser Arbeit der Entstehung und Verfestigung von Feindbildern. Dabei werde ich auf die Hauptprämissen der Kognitionspsychologie eingehen, um die psychologischen Aspekte anzuzeichnen, die die Entstehung und Verhärtung von Feindbildern bedingen. Anschließend werde ich die Wahrnehmungsmuster analysieren, die für den israelisch- palästinensischen Konflikt relevant sind. Da ich von der Überzeugung ausgehe, dass es ein dialektisches Verhältnis zwischen kollektiver Identität und Entwicklung des Friedensprozesses besteht, werde ich in einem Schlusskapitel auf die Folgen der Konstruktion von kollektiven Identitäten hinweisen, die das Scheitern des Friedensprozesses begründen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kollektive Identität- begriffliche Klärung
- Zur Konstruktion von kollektiven Identitäten
- Palästinensische Identität
- Identitätsstiftende Themen in der palästinensischen Identität
- Die Intifada
- Israelische Identität
- Die Gründung Israels
- Die Shoah
- Palästinensische Identität
- Die politische Bedeutung von Feindbildern
- Entstehung und Verhärtung von Feindbildern
- Identitätsstiftende Bedeutung von Feindbildern
- Worst-Case-Denken
- Schwarz-Weiß-Denken
- Dehumanisierung des Feindes
- Kollektive Identitäten und der Friedensprozess im Nahen Osten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Einfluss von „kollektiven Identitäten“ auf den Friedensprozess im Nahen Osten. Sie konzentriert sich dabei auf die Konstruktion und Verfestigung dieser Identitäten, insbesondere im Kontext der palästinensischen und israelischen Gesellschaften.
- Die begriffliche Klärung von „kollektiver Identität“ und ihre Konstruktion durch Erinnerungen, Selbst- und Fremdzuschreibungen.
- Die Analyse der Identitätsstiftenden Themen in der palästinensischen und israelischen Identität, mit einem besonderen Fokus auf die „nakbah“ und die Gründung Israels.
- Die Untersuchung der Entstehung und Verhärtung von Feindbildern und deren psychologischen Grundlagen.
- Die Auswirkungen der Konstruktion von „kollektiven Identitäten“ auf den Friedensprozess im Nahen Osten.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Woran scheitert die Kooperation im Nahen Osten? Dabei wird „Kollektive Identität“ als ein wesentliches Hindernis im Friedensprozess identifiziert.
- Kollektive Identität - begriffliche Klärung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von „kollektiver Identität“ und deren Konstruktion durch kollektives Gedächtnis, Selbst- und Fremdzuschreibungen.
- Zur Konstruktion von kollektiven Identitäten: Dieses Kapitel analysiert die konstituierenden Faktoren der „kollektiven Identitäten“ der palästinensischen und israelischen Gesellschaften. Dabei werden die Rolle der „nakbah“, der Gründung Israels und der Shoah im Hinblick auf die Entstehung von Identitätsstiftenden Themen untersucht.
- Die politische Bedeutung von Feindbildern: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung und Verhärtung von Feindbildern im Kontext des israelisch-palästinensischen Konflikts. Dabei werden die psychologischen Aspekte dieser Prozesse sowie die Wahrnehmungs muster, die für den Konflikt relevant sind, analysiert.
- Kollektive Identitäten und der Friedensprozess im Nahen Osten: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Konstruktion von „kollektiven Identitäten“ auf den Friedensprozess im Nahen Osten.
Schlüsselwörter
Kollektive Identität, Friedensprozess, Naher Osten, Palästinensische Identität, Israelische Identität, Feindbilder, Konstruktion von Identität, Selbst- und Fremdzuschreibungen, kollektives Gedächtnis, "nakbah", Gründung Israels, Shoah, Worst-Case-Denken, Schwarz-Weiß-Denken, Dehumanisierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird "kollektive Identität" als Hindernis für den Frieden im Nahen Osten gesehen?
Kollektive Identitäten im Nahostkonflikt sind oft starr konstruiert und basieren auf tief verwurzelten Feindbildern und gegensätzlichen historischen Narrativen, was eine Vertrauensbasis für Verhandlungen verhindert.
Was bedeutet "kollektive Identität" in diesem Zusammenhang?
Es handelt sich um ein imaginäres Gebilde, das durch Mythen, kollektive Erinnerungen und Sozialisationsprozesse geformt wird und als Grundlage für gesellschaftliche Normen dient.
Welche Ereignisse prägen die palästinensische Identität?
Zentral sind die "Nakbah" (die Katastrophe von 1948) sowie die Erfahrungen der Intifada, die als identitätsstiftende Themen fungieren.
Welche Faktoren sind entscheidend für die israelische Identität?
Wichtige Säulen sind die Gründung des Staates Israel sowie das kollektive Gedenken an die Shoah (Holocaust).
Wie entstehen Feindbilder laut der Kognitionspsychologie?
Feindbilder entstehen durch psychologische Mechanismen wie Schwarz-Weiß-Denken, Worst-Case-Denken und die Dehumanisierung des Gegenübers, um die eigene Gruppe abzugrenzen.
Kann man aus diesen Identitätsstrukturen leicht "ausbrechen"?
Aufgrund der jahrzehntelangen Verfestigung und der massenpsychologischen Disposition gilt ein Ausbrechen aus diesen Strukturen als extrem schwierig, solange keine neue Vertrauensbasis existiert.
- Quote paper
- Georgi Iliev (Author), 2003, Woran scheitert die Kooperation im Nahen Osten? "Kollektive Identität" als Hindernis des Friedensprozesses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42480