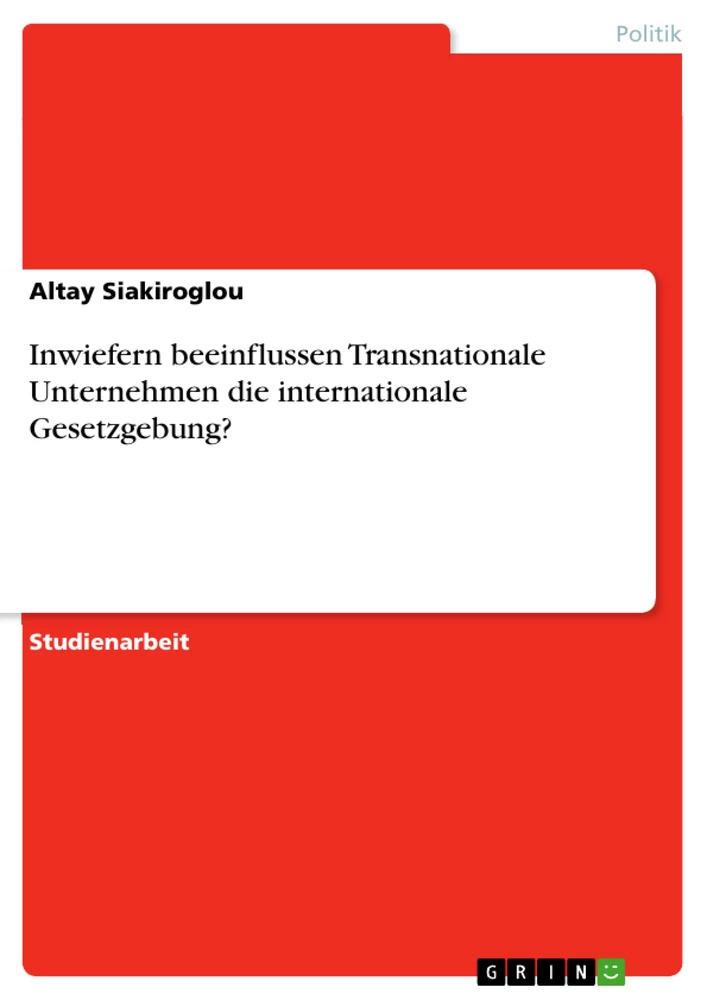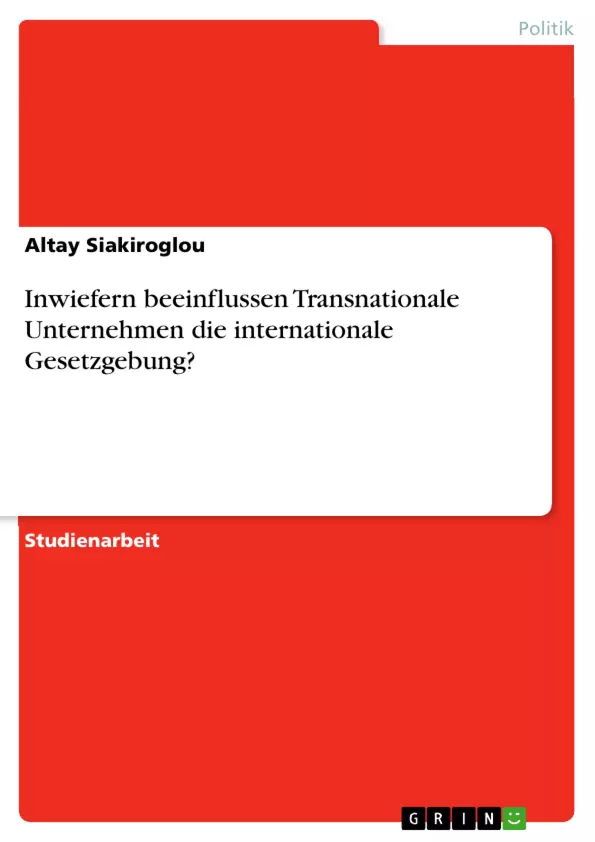Die Weltpolitik untersteht seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere zu Beginn des 21. Jahrhunderts in allen Bereichen einem Globalisierungsprozess. Die Globalisierungsprozesse stehen im Einklang mit dem Aufstieg internationaler Organisationen und nichtstaatlichen Akteuren in der internationalen Politik, wodurch die Weltpolitik, vor allem in den letzten Jahrzehnten, zunehmend multilateral geworden ist. Im Zuge der steigenden Steuerungsprobleme der Nationalstaaten werden nichtstaatliche Akteure in die Steuerungs- bzw. Governanceprozesse eingebunden, die die Nationalstaaten in bestimmten Politikfeldern unterstützen sollen. Sukzessive wurde und wird den nichtstaatlichen Akteuren immer mehr Mitbestimmungsrechte in unterschiedlichen Politikfeldern gewährt. Zu den nichtstaatlichen Akteuren gehören u.a. private Akteure, wie z.B. Transnationale Unternehmen (TNU), die inzwischen die internationale Politik mitbestimmen und mitgestalten. Die TNU`s haben ihre Position als einflussreicher Akteur im Laufe der Jahre weiter verstärkt und sind gegenwärtig ein wesentlicher Bestandteil der internationalen Politik. Dementsprechend sind die TNU´s in nahezu allen wichtigen politischen Entscheidungsprozessen direkt oder indirekt beteiligt. Sie nehmen – vor allem – aufgrund ihrer ökonomischen Bedeutsamkeit auch Einfluss auf die Festlegung bestimmter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen für den internationalen Handel.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1. Transnationale Unternehmen
- 2.2. Governance
- 3. Transnationales Regieren
- 4. Facetten der Macht der TNU's
- 4.1. Instrumentelle Macht
- 4.2. Strukturelle Macht
- 4.3. Diskursive Macht
- 5. Private Authority
- 6. Verrechtlichung
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss transnationaler Unternehmen (TNU's) auf die internationale Gesetzgebung. Sie beleuchtet die Einbindung der TNU's in internationale Politikprozesse im Kontext des transnationalen Regierens und analysiert die verschiedenen Machtfacetten dieser Akteure. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von "Private Authority" und der Rolle der Verrechtlichung im Zusammenhang mit dem Einfluss der TNU's.
- Transnationales Regieren und die Rolle der TNU's
- Machtfaktoren transnationaler Unternehmen
- Legitimität und Autorität privater Akteure in der internationalen Politik
- Verrechtlichung und der Einfluss von TNU's auf die Gesetzgebung
- Governance-Strukturen und die Interaktion zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des zunehmenden Einflusses transnationaler Unternehmen (TNU's) auf die internationale Politik ein. Sie beschreibt den Kontext der Globalisierung und den Aufstieg nichtstaatlicher Akteure, wobei die wachsende Bedeutung der TNU's im multilateralen System hervorgehoben wird. Die Arbeit fokussiert sich auf die Frage nach dem Einfluss der TNU's auf die internationale Gesetzgebung und skizziert den methodischen Ansatz der Untersuchung.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe, wie "Transnationale Unternehmen" und "Governance". Es definiert TNU's als Unternehmen mit Präsenz in mindestens drei Staaten, die dezentral geführt werden und ein hohes Maß an Autonomie genießen. Die Ambivalenz ihrer Rolle in der internationalen Politik wird betont: einerseits Expertise und Know-how, andererseits fehlende politische Legitimität. Der Begriff "Governance" wird im Kontext der Steuerungsskepsis der Systemtheorie erläutert und verschiedene Governance-Formen, insbesondere "governance without government", werden vorgestellt.
3. Transnationales Regieren: Dieses Kapitel analysiert das Konzept des transnationalen Regierens, das die Kooperation von öffentlichen und privaten Akteuren in der internationalen Politik beschreibt. Es wird die Rolle privater Akteure, insbesondere TNU's, als Entscheidungsträger und deren Einfluss auf die weltpolitischen Geschehnisse beleuchtet. Der Fokus liegt auf den "new modes of governance", die sich durch akteurszentrierte Dimension und unhierarchische Steuerungsmodi auszeichnen, und den daraus resultierenden Vorteilen für private Akteure.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Transnationaler Einfluss auf die internationale Gesetzgebung
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text untersucht den Einfluss transnationaler Unternehmen (TNU's) auf die internationale Gesetzgebung. Er beleuchtet die Einbindung der TNU's in internationale Politikprozesse im Kontext des transnationalen Regierens und analysiert deren verschiedene Machtfacetten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von "Private Authority" und der Rolle der Verrechtlichung im Zusammenhang mit dem Einfluss der TNU's.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind: Transnationales Regieren und die Rolle der TNU's; Machtfaktoren transnationaler Unternehmen; Legitimität und Autorität privater Akteure in der internationalen Politik; Verrechtlichung und der Einfluss von TNU's auf die Gesetzgebung; Governance-Strukturen und die Interaktion zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren.
Wie definiert der Text "Transnationale Unternehmen" und "Governance"?
Transnationale Unternehmen werden als Unternehmen mit Präsenz in mindestens drei Staaten definiert, die dezentral geführt werden und ein hohes Maß an Autonomie genießen. "Governance" wird im Kontext der Steuerungsskepsis der Systemtheorie erläutert, wobei verschiedene Governance-Formen, insbesondere "governance without government", vorgestellt werden.
Was versteht der Text unter transnationalem Regieren?
Transnationales Regieren beschreibt die Kooperation von öffentlichen und privaten Akteuren in der internationalen Politik. Der Text beleuchtet die Rolle privater Akteure, insbesondere TNU's, als Entscheidungsträger und deren Einfluss auf weltpolitische Geschehnisse, mit Fokus auf "new modes of governance".
Welche Machtfacetten transnationaler Unternehmen werden analysiert?
Der Text analysiert die instrumentelle, strukturelle und diskursive Macht transnationaler Unternehmen.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in diesen?
Der Text umfasst Kapitel zu Einleitung, Begriffsdefinitionen (TNU's und Governance), Transnationalem Regieren, den Machtfacetten der TNU's, Private Authority, Verrechtlichung und einem Fazit. Jedes Kapitel vertieft einen Aspekt des Einflusses von TNU's auf die internationale Gesetzgebung.
Welche Rolle spielt "Private Authority" im Text?
"Private Authority" ist ein zentraler Begriff, der die Autorität und den Einfluss privater Akteure, insbesondere TNU's, in der internationalen Politik beschreibt und analysiert wird.
Welche Bedeutung hat die Verrechtlichung im Kontext des Textes?
Die Verrechtlichung wird als ein wichtiger Mechanismus untersucht, durch den der Einfluss von TNU's auf die internationale Gesetzgebung gestaltet und beeinflusst wird.
- Arbeit zitieren
- Altay Siakiroglou (Autor:in), 2017, Inwiefern beeinflussen Transnationale Unternehmen die internationale Gesetzgebung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424916