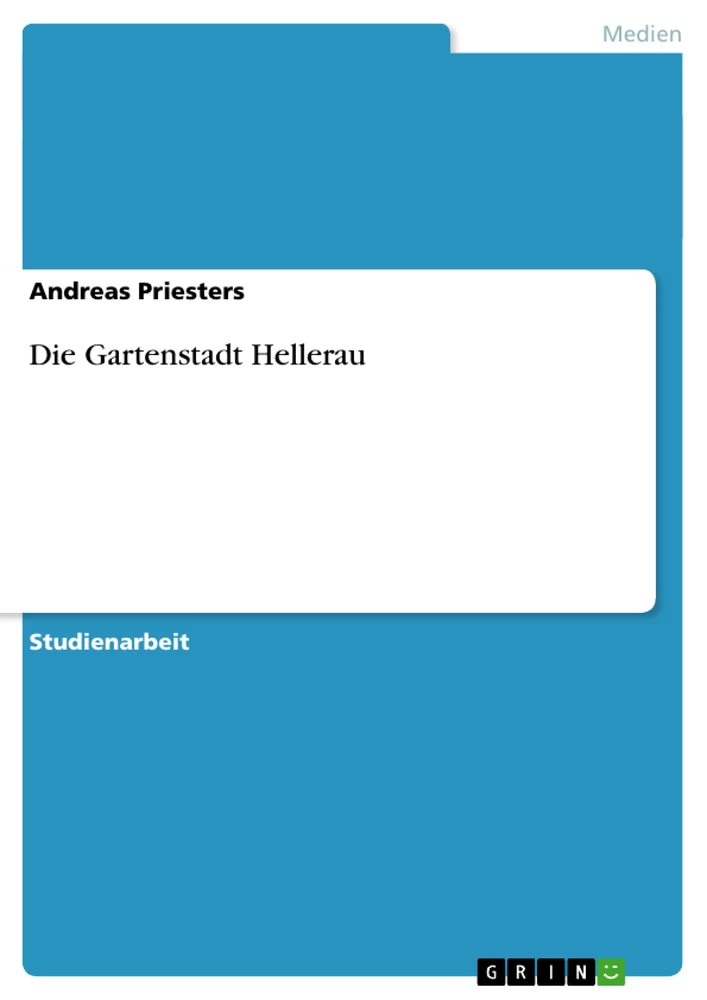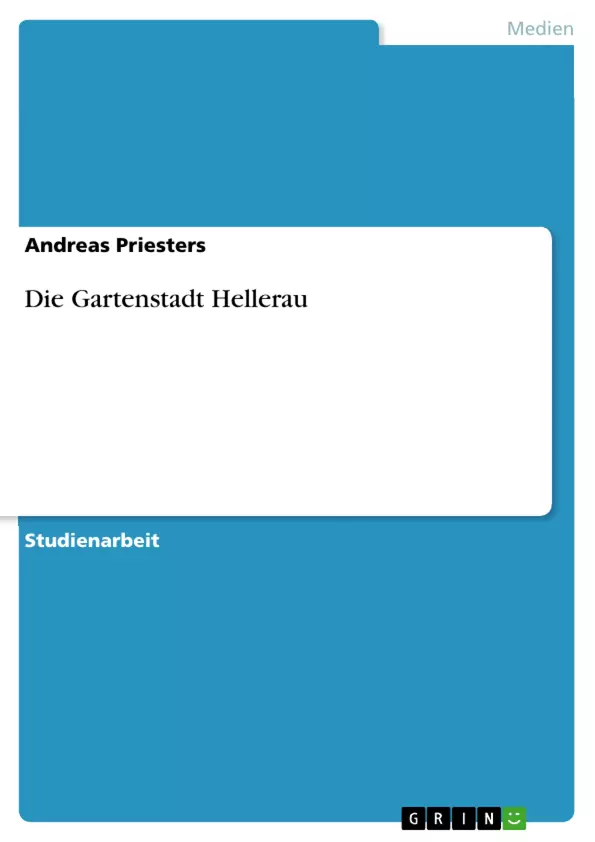Im Zeitraum gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die durch starkes industrielles und kapitalistisches Wachstum geprägt ist, treten verschiedene Personen ins Rampenlicht der öffentlichen Diskussion, die vor allem die schon länger vorherrschenden Missstände in den überfüllten Städten als inakzeptabel betrachten. Aus ihrer Sicht ist diese Fehlentwicklung, die sozialer, gesundheitlicher, stadtplanerischer oder ähnlicher Art ist, zu reformieren. Aus der Überlegung, das für Körper, Geist und Seele ungesunde zeitgenössische Stadtbild durch ein neues Siedlungsgebilde abzulösen, entsteht die Idee der Gartenstadt. Wie bereits das einleitende Zitat Clara Viebigs verdeutlicht, war man der Meinung, die Nation, bzw. die Wirtschaft, die Leistungsfähigkeit der Arbeiter und Soldaten, die Lebensfreude und allgemeine Gesundheit aller Bürger, würde durch die Großstadt geschwächt und könnte nur auf dem Land, in der Natur o.ä. wieder gestärkt werden.
Der erste Teil meiner Ausführung befasst sich demnach mit der urbanen und sozialen Ausgangssituation um die Jahrhundertwende und die Reaktion der deutschen Reformer auf die englische Vorlage durch Ebenezer Howard mit der Gründung der Deutschen Gartenstadtgesellschaft.
Der zweite Teil behandelt die erste in Deutschland verwirklichte Gartenstadt Hellerau bei Dresden. Hierbei soll neben der Entstehung, Planung und Architektur auch ein Augenmerk auf die organisatorische Struktur und den reformerischen Geist in dieser Siedlung gelegt werden. Zudem ist es der Versuch die Frage, ob Hellerau eine Gartenstadt im ordentlichen Sinne ist, zumindest teilweise zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Die Utopie Gartenstadt
- 1.1 Die Situation um 1900 und Howards Utopie
- 1.2 Der Gartenstadtgedanke in Deutschland
- 1.3 Die Deutsche Gartenstadtgesellschaft und Ihre Ziele
- 2. Hellerau - Gartenstadt oder Gartenvorstadt?
- 2.1 Vorbilder und Vergleiche
- 2.2 Hellerau im geschichtlichen Überblick
- 2.3 Die Baugenossenschaft und andere Organisationsstrukturen
- 2.4 Bauvorschriften in Hellerau
- 2.5 Gesamtplan
- 2.6 Städtebauliche Schwerpunkte:
- 2.6.1 Der Wohnungsbau
- 2.6.2 Deutsche Werkstätten
- 2.6.3 Marktplatz
- 2.6.4 Bildungsanstalt für rhythmische Erziehung
- 3. Fazit
- 4. Literatur- und Quellenverzeichnis
- 5. Abbildungsnachweis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Gartenstadt Hellerau vor dem Hintergrund der sozialen und urbanen Probleme um 1900. Ziel ist es, die Utopie der Gartenstadtbewegung zu beleuchten und deren Umsetzung in Hellerau zu analysieren. Dabei wird insbesondere auf die städtebaulichen Aspekte, die organisatorischen Strukturen und die Frage nach der eigentlichen Einstufung Hellerau als Gartenstadt oder Gartenvorstadt eingegangen.
- Soziale und urbane Missstände um 1900
- Der Gartenstadtgedanke nach Ebenezer Howard und seine Adaption in Deutschland
- Planung und Architektur der Gartenstadt Hellerau
- Organisationsstrukturen und der reformerische Geist in Hellerau
- Hellerau als Gartenstadt: eine kritische Auseinandersetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt den historischen Kontext der Gartenstadtbewegung, die als Reaktion auf die Missstände der Großstädte um die Jahrhundertwende entstand. Es werden die sozialen, gesundheitlichen und stadtplanerischen Probleme hervorgehoben, die zur Entwicklung des Gartenstadtkonzepts führten, und es wird ein Überblick über die Struktur der Arbeit gegeben, die sich zunächst mit der allgemeinen Utopie der Gartenstadt und anschließend mit der konkreten Umsetzung in Hellerau befasst.
1. Die Utopie Gartenstadt: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung des Gartenstadtgedankens im England des späten 19. Jahrhunderts. Es werden die sozialen und städtebaulichen Missstände wie Wohnungsnot, schlechte Verkehrsbedingungen, Luftverschmutzung und die Folgen der Bodenspekulation detailliert dargestellt. Die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Stadtbevölkerung werden anhand von Beispielen belegt. Das Kapitel skizziert Ebenezer Howards Vision einer idealen Stadt und zeigt auf, wie seine Ideen die Grundlage für die Gartenstadtbewegung bildeten.
2. Hellerau - Gartenstadt oder Gartenvorstadt?: Dieses Kapitel widmet sich der Gartenstadt Hellerau bei Dresden. Es beleuchtet die historischen Vorbilder und Vergleiche zu anderen Gartenstadtprojekten, die Entstehung und den geschichtlichen Überblick der Siedlung. Es analysiert die Baugenossenschaft und andere Organisationsstrukturen, die Bauvorschriften und den Gesamtplan der Siedlung. Die städtebaulichen Schwerpunkte werden anhand des Wohnungsbaus, der Deutschen Werkstätten, des Marktplatzes und der Bildungsanstalt für rhythmische Erziehung im Detail dargestellt. Es wird die Frage nach der genauen Klassifizierung Hellerau als Gartenstadt oder Gartenvorstadt diskutiert.
Schlüsselwörter
Gartenstadt, Hellerau, Ebenezer Howard, Stadtplanung, soziale Reform, Wohnungsbau, Deutsche Gartenstadtgesellschaft, Städtebau, Jahrhundertwende, soziale Missstände, Urbanisierung, Baugenossenschaft, Deutsche Werkstätten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Hellerau - Gartenstadt oder Gartenvorstadt?"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Gartenstadt Hellerau. Sie beleuchtet die Utopie der Gartenstadtbewegung, analysiert deren Umsetzung in Hellerau und befasst sich mit städtebaulichen Aspekten, organisatorischen Strukturen und der Frage, ob Hellerau als Gartenstadt oder Gartenvorstadt einzustufen ist. Die Arbeit beinhaltet ein Vorwort, Kapitel zur Utopie der Gartenstadt, zu Hellerau selbst, ein Fazit, Literatur- und Quellenverzeichnis sowie einen Abbildungsnachweis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die sozialen und urbanen Missstände um 1900, den Gartenstadtgedanken nach Ebenezer Howard und seine Adaption in Deutschland, die Planung und Architektur von Hellerau, die dortigen Organisationsstrukturen und den reformerischen Geist, sowie eine kritische Auseinandersetzung mit der Einordnung Hellerau als Gartenstadt.
Was wird im Kapitel "Die Utopie Gartenstadt" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Entstehung des Gartenstadtgedankens in England. Es beschreibt detailliert die sozialen und städtebaulichen Missstände wie Wohnungsnot, schlechte Verkehrsbedingungen und Luftverschmutzung und zeigt die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Stadtbevölkerung. Es skizziert Ebenezer Howards Vision einer idealen Stadt und deren Einfluss auf die Gartenstadtbewegung.
Worüber handelt das Kapitel zu Hellerau?
Das Kapitel über Hellerau beleuchtet historische Vorbilder und Vergleiche zu anderen Gartenstadtprojekten, die Entstehung und den geschichtlichen Überblick der Siedlung. Es analysiert die Baugenossenschaft und andere Organisationsstrukturen, Bauvorschriften und den Gesamtplan. Die städtebaulichen Schwerpunkte (Wohnungsbau, Deutsche Werkstätten, Marktplatz, Bildungsanstalt) werden im Detail dargestellt. Die Frage nach der genauen Klassifizierung Hellerau als Gartenstadt oder Gartenvorstadt wird diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Gartenstadt, Hellerau, Ebenezer Howard, Stadtplanung, soziale Reform, Wohnungsbau, Deutsche Gartenstadtgesellschaft, Städtebau, Jahrhundertwende, soziale Missstände, Urbanisierung, Baugenossenschaft, Deutsche Werkstätten.
Gibt es ein Inhaltsverzeichnis?
Ja, die Arbeit enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit Vorwort, Kapiteln zur Utopie der Gartenstadt und Hellerau, einem Fazit, Literatur- und Quellenverzeichnis sowie einem Abbildungsnachweis. Die Kapitel sind weiter unterteilt in Unterkapitel.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung der Gartenstadt Hellerau vor dem Hintergrund der sozialen und urbanen Probleme um 1900. Ziel ist die Beleuchtung der Utopie der Gartenstadtbewegung und die Analyse deren Umsetzung in Hellerau, insbesondere der städtebaulichen Aspekte, der Organisationsstrukturen und der Einordnung Hellerau als Gartenstadt oder Gartenvorstadt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt: ein Vorwort, ein Kapitel über die allgemeine Utopie der Gartenstadt, ein Kapitel über die spezifische Umsetzung in Hellerau, ein Fazit, ein Literatur- und Quellenverzeichnis sowie ein Abbildungsnachweis. Jedes Kapitel enthält relevante Unterkapitel.
- Quote paper
- Andreas Priesters (Author), 2003, Die Gartenstadt Hellerau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42498