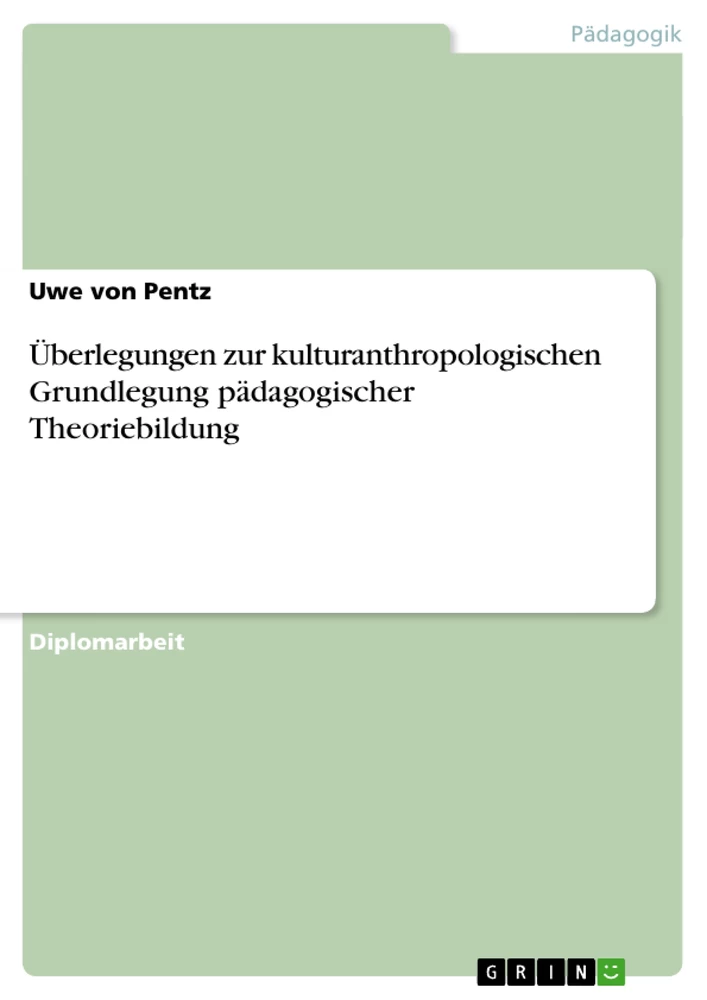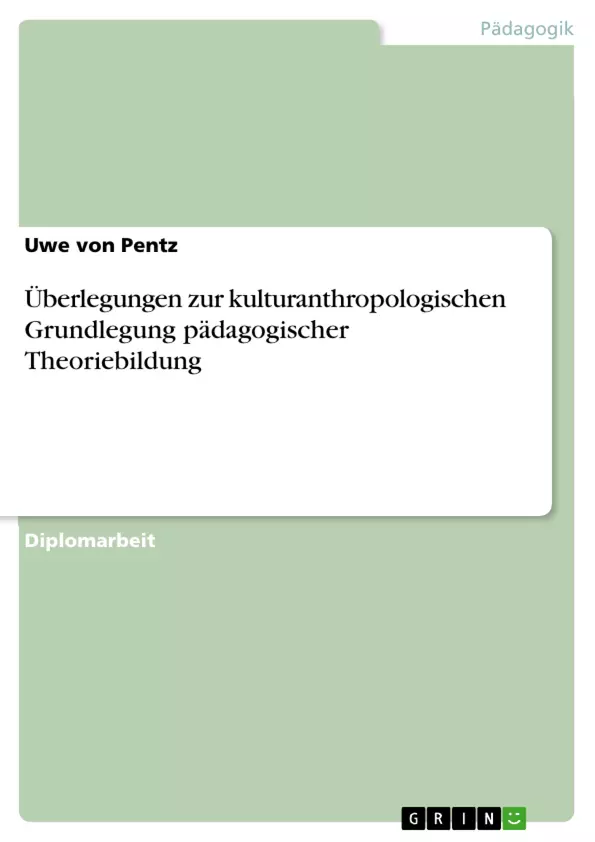Diese Arbeit besteht aus 2 Teilen: einem wissenschaftlich-theoretischen schwarzen Teil und einem persönlichen-praxisbezogenen blauen Teil, die sich ergänzen (sollen). In schwarzer Schrift versuche ich allgemeine theoretische Grundlagen, Sichtweisen und Begriffe zu entwickeln.
In blauer Schrift versuche ich mit den Begriffen und Denkweisen der skizzierten Theoriegebäude eine sinnvolle Beschreibung meiner persönlichen pädagogischen Praxis mit einem hirnkranken Mann zu entwickeln. Dabei zeigt sich, wie schwierig es ist mit den Begriffen allgemeiner Theorien der Einzigartigkeit konkreter Entwicklungszusammenhänge gerecht zu werden.
Im 2. Kapitel nähere ich mich zunächst mithilfe zweier älterer Texte von Wilhelm Dilthey und Ernst Krieck dem Gegenstand der Pädagogik bzw. Erziehung an. Dabei zeigt sich das erste Spannungsfeld in dem menschliche Entwicklungstätigkeit geschieht: der/die Einzelne und die Gesellschaft. Beide Seiten bestimmen die Struktur unserer pädagogischen Arbeit. Außerdem beschäftige ich mich aufgrund der Nazi- Vergangenheit von Ernst Krieck mit der Frage, inwieweit pädagogisches Wissen um Strukturen menschlicher Entwicklung überhaupt zu dem pädagogischen Wollen der Entwicklung freier Menschen führen kann.
Im 3. Kapitel beginne ich nun dieses Spannungsfeld von Kultur und Einzelnem näher zu untersuchen. Zuerst zeige ich mit Norbert Elias, dass Persönlichkeitsentwicklung und Kulturentwicklung in einem gegenseitigen Bedingungszusammenhang stehen, dass dieses beiden Seiten menschlicher Entwicklung eine Gegensatz-Einheit bilden. Es wird klar, dass eine Wissenschaft der Pädagogik diesen Kulturzusammenhang berücksichtigen muss. Anschließend suche ich mit Michel Foucault nach den Mechanismen, die diesen Zusammenhang zwischen der persönlichen Entwicklungstätigkeit des Einzelnen (dem `klassischen´ Gegenstand der Pädagogik) und der Kulturentwicklung strukturieren...
Im 4. Kapitel geht es deswegen um die grundsätzlichen Möglichkeiten und Grenzen menschlicher Erkenntnis. Hier schreibe ich, ohne einer speziellen Theorie zu folgen, recht frei meine Überlegungen nieder...
Im 5. Kapitel schließlich skizziere ich die pädagogische Tätigkeitsverfassung von Erich Westphal, die viele der vorangegangenen Überlegungen berücksichtigt....
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Die Überlegungen zur Vielfalt
- Kapitel 1: Einleitung
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Gliederung & Arbeitsweise
- Kapitel 2: Historische Betrachtungen
- 2.1 W. Dilthey: „Über die Möglichkeit einer allgemeingültigen pädagogischen Wissenschaft“
- 2.1.1 Warum Ethik keine Grundlage sein kann
- 2.1.2 Der Zweck des Seelenlebens ist die Entwicklung
- 2.1.3 Aufgaben an eine allgemeine Wissenschaft der Pädagogik
- 2.2 Ernst Krieck: „Philosophie der Erziehung“
- 2.2.1 Kritik der Zielstellungen und des Individualismus
- 2.2.2 Kritik des Intellektualismus und des Psychologismus
- 2.2.3 Kritik des Evolutionismus
- 2.2.4 Zusammenfassung der Gedanken Kriecks
- 2.3 Was hat es mit Ernst Krieck auf sich?
- 2.3.1 Kriecks Laufbahn und ergänzende Informationen aus dem Netz
- 2.3.2 Kann Wissenschaft allein uns zu guten Pädagogen machen?
- 2.4 Zusammenfassung
- 2.1 W. Dilthey: „Über die Möglichkeit einer allgemeingültigen pädagogischen Wissenschaft“
- Kapitel 3: Soziologie oder: Wir entwickeln uns gemeinsam
- 3.1 N. Elias:,,Über den Prozess der Zivilisation"
- 3.1.1 Die verschachtelte Prozesshaftigkeit
- 3.1.2 Die Logik und die Richtung des Prozesses der Zivilisation
- 3.1.3 Die Monopolinstitute der Gewalt als Ausdruck der Differenzierung
- 3.1.4 Die gespeicherte Gewalt und ihre Wirkungen
- 3.1.5 Die fundamentale Geschichtlichkeit und die Verflochtenheit
- 3.1.6 Der Urgrund der Angst
- 3.2 M. Foucault: „Der Wille zum Wissen - Sexualität und Wahrheit 1“
- 3.2.1 Der Diskurs beginnt zu gären
- 3.2.2 Eine neue Form der Macht - erste Annäherungen
- 3.2.3 Eine neue Form der Wahrheit
- 3.2.4 Die Macht ist überall und wirkt strategisch
- 3.2.5 Die Dispositive der Macht
- 3.3 Erste Grundlagen einer allgemeinen pädagogischen Theorie
- 3.1 N. Elias:,,Über den Prozess der Zivilisation"
- Kapitel 4: Erkenntnistheorie oder: Probleme des Wissens
- 4.1 Über die Komplexität und die Grenzen von Theorie
- 4.1.1 Die Formenvielfalt innerhalb des Prozesses der Zivilisation
- 4.1.2 Die Unendlichkeit und die Einheit
- 4.1.3 Doch das Leben ist konkret und stellt Bedingungen
- 4.1.4 Der Doppelcharakter der Erkenntnis
- 4.2 Das Problem der Sprache
- 4.2.1 Die Postmoderne macht es deutlich
- 4.2.2 Erster Kontakt durch die Mimesis
- 4.2.3 Gemeinsam wird es durch die Sprache
- 4.4 Zusammenfassung
- 4.1 Über die Komplexität und die Grenzen von Theorie
- Kapitel 5: Ansatz einer pädagogischen Tätigkeitsverfassung
- 5.1 Bewegen als Lebensweise oder: das Muster, das verbindet
- 5.2 Eine Matrix der menschlichen Entwicklung – der menschlichen Form
- 5.2.1 Die morphologische Seh-Weise
- 5.2.2 Bi-polare Gegensatz-Einheiten, um die Bewegung zu logifizieren
- 5.3 Über das Verstehen-lernen
- 5.3.1 Pädagogik als Kunst der Wahrnehmung von Entwicklungsmöglichkeiten
- 5.3.2 Doch die alten Muster wirken oder: wenn die Kultur am Boden liegt
- 5.3.3 Von Abhängigkeiten und Selbstständigkeit
- 5.3.4 Die theoretische Beschreibung der Verwandlungswirklichkeit
- 5.4 Über das Entwickeln-können
- 5.4.1 Wahrnehmen und Bewegen
- 5.4.2 Entwickeln-können heißt Sich-überwinden-müssen
- 5.4.3 Was motiviert uns zur Entwicklung?
- 5.4.4 Was ist dann pädagogische Arbeit?
- 5.4.5 Präventive Pädagogik und pädagogische Entwicklungsförderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der kulturanthropologischen Grundlegung pädagogischer Theoriebildung. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die menschliche Entwicklungstätigkeit und die vielseitigen Möglichkeiten menschlichen Daseins zu entwickeln, indem verschiedene Perspektiven aus soziologischer, erkenntnistheoretischer und philosophischer Sicht beleuchtet werden.
- Die Struktur menschlicher Entwicklungstätigkeit als zentrales Thema
- Der Einfluss von Kultur und Gesellschaft auf die menschliche Entwicklung
- Die Rolle von Sprache und Erkenntnis im Prozess der Entwicklung
- Die Bedeutung von Bewegen und Verstehen-lernen für die menschliche Entwicklung
- Die Verbindung von Theorie und Praxis in der pädagogischen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Fragestellung und die Gliederung der Arbeit erläutert. Kapitel 2 beschäftigt sich mit historischen Betrachtungen, die sich mit der Frage nach der Möglichkeit einer allgemeingültigen pädagogischen Wissenschaft befassen. Der Fokus liegt dabei auf den Denkern W. Dilthey und Ernst Krieck.
Kapitel 3 widmet sich dem Einfluss der Soziologie auf die pädagogische Theoriebildung. Dabei werden N. Elias' Theorien zum Prozess der Zivilisation und M. Foucaults Ideen zur Macht und Wahrheit analysiert.
Kapitel 4 befasst sich mit Erkenntnistheoretischen Fragen, die sich mit der Komplexität und den Grenzen von Theorie und mit dem Problem der Sprache befassen.
In Kapitel 5 wird ein Ansatz einer pädagogischen Tätigkeitsverfassung vorgestellt. Das Konzept der Lebensweise „Bewegen" wird als verbindendes Muster der menschlichen Entwicklung dargestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: kulturanthropologische Grundlegung, pädagogische Theoriebildung, menschliche Entwicklungstätigkeit, Zivilisationsprozess, Macht, Wahrheit, Erkenntnis, Sprache, Bewegen, Verstehen-lernen, pädagogische Tätigkeitsverfassung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer kulturanthropologischen Pädagogik?
Sie zielt darauf ab, pädagogische Theoriebildung auf dem Verständnis der menschlichen Entwicklung im Spannungsfeld zwischen Individuum und Kultur zu begründen.
Welche Rolle spielt Norbert Elias in dieser Arbeit?
Mit Elias wird verdeutlicht, dass Persönlichkeitsentwicklung und Kulturentwicklung (Zivilisationsprozess) untrennbar miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig bedingen.
Wie beeinflusst Michel Foucault die pädagogische Theorie?
Foucaults Theorien zu Macht und Wissen helfen dabei, die Mechanismen zu verstehen, die die persönliche Entwicklung des Einzelnen innerhalb kultureller Strukturen formen.
Was bedeutet „Bewegen“ als Lebensweise nach Erich Westphal?
Es beschreibt ein Muster menschlicher Entwicklung, bei dem pädagogische Arbeit als Kunst verstanden wird, Entwicklungsmöglichkeiten wahrzunehmen und zu fördern.
Warum wird die NS-Vergangenheit von Ernst Krieck thematisiert?
Die Arbeit hinterfragt kritisch, inwieweit rein strukturelles Wissen über menschliche Entwicklung missbraucht werden kann und wie pädagogisches Wollen stattdessen zur Freiheit führen sollte.
- Quote paper
- Uwe von Pentz (Author), 2003, Überlegungen zur kulturanthropologischen Grundlegung pädagogischer Theoriebildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42499