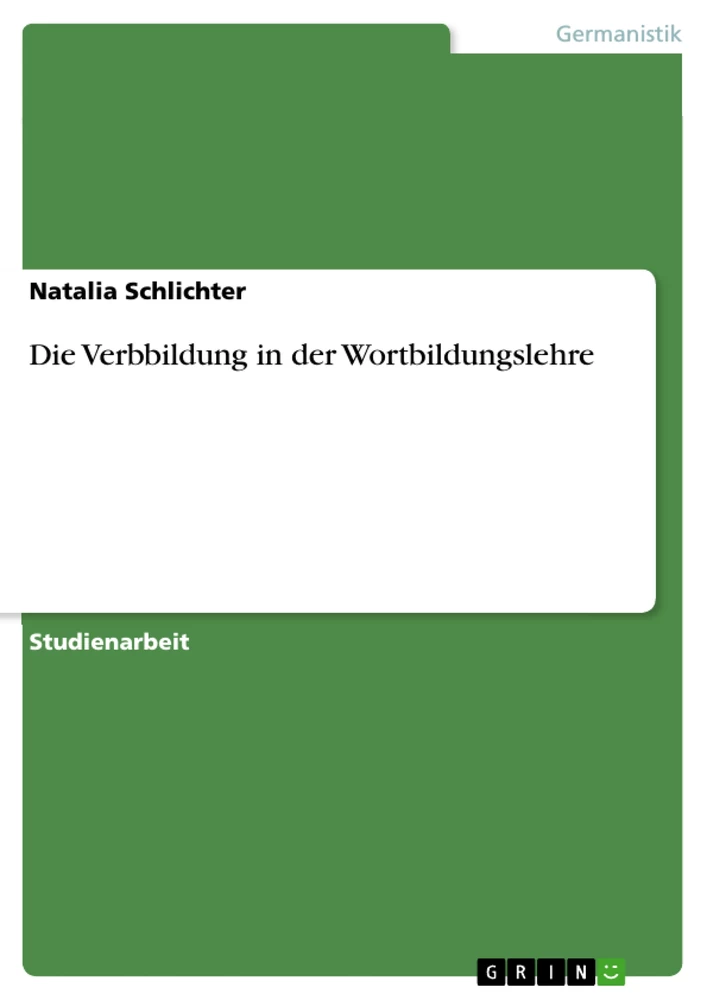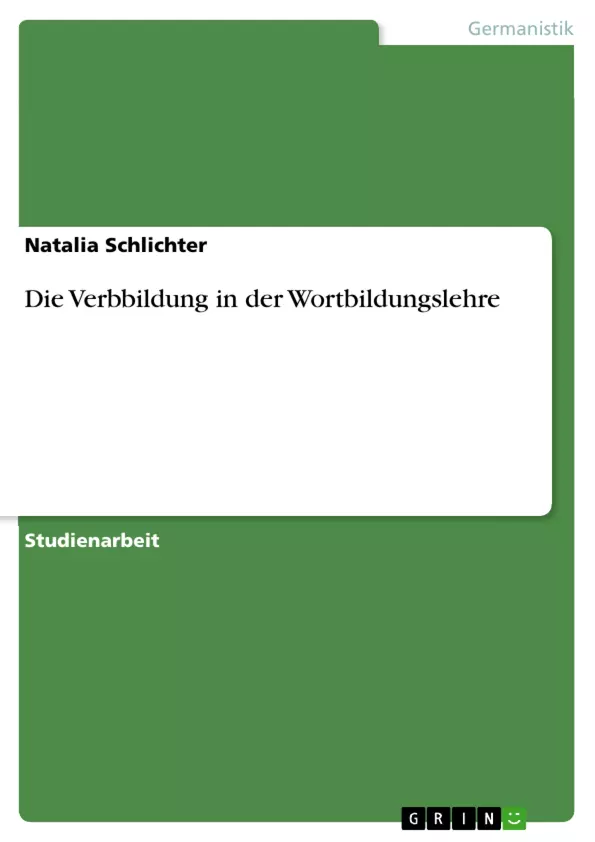1. Geschichtliche, begriffliche und thematische Schwerpunktsetzung der Arbeit
1. 1. Zur Geschichte der Wortbildungslehre
Die Wortbildungslehre wird erst seit dem 19 Jh. als eigenständige Disziplin behandelt. Früher war sie ein Teil der historischen Grammatik (vgl. Erben 1993, 9f.), die die Wortbildung vor allem diachronisch behandelte und als Hauptaufgabe, ,,die verschiedenen Bahnen zu verfolgen, in denen sich die Ausbildung unseres Wortschatzes vollzieht", hatte. (Henzen 1965; zitiert nach: Erben 1973, 7) Jetzt hat die Wortbildungslehre die Erscheinungen der Wortbildung im Rahmen einer synchronischen Sprachbeschreibung zu behandeln.
1.2. Zum Wortbildungsbegriff
Nach Erben ist Wortbildungslehre ,,derjenige Teil der Grammatik, der die Wortbildung, die Bildung neuer Wörter, unter wissenschaftlichen oder praktischen Gesichtspunkten darstellt und dadurch sowohl angemessene Urteile über Wortbildungsprozesse und ihre Bedingungen ermöglicht, als auch über Wortbildungsergebnisse, die Struktur und Funktion vorhandener und möglicher Wörter." ( Erben 1993, 16)
Als Normalfall der Wortbildung wird von Erben ,,Aufbau eines neuen Wortkomplexes aus sprachüblichen Einheiten, also Aufbau eines komplexen Sekundärzeichens aus elementaren Primärzeichen" angesehen. (Erben 1993, 24) Auf diese Weise wird die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass der Gegenstand der Wortbildung - die Bildung neuer Wörter ,,durch zumindest teilweisen Rückgriff auf bereits vorhandene Bauelemente, durch Weiterbilden des Überkommenen oder Entlehnten" - von dem der Wortschöpfung zu trennen sei. Die Wortschöpfung gehört in die Anfangsphase einer Sprache, die für die deutsche Sprache zweifelsfrei schon vergangen ist.
Da auch der Satz als komplexes Superzeichen aus Zeichen niederer Ordnung aufgebaut wird, stellt sich die Frage nach der Unterscheidung zwischen einem komplexen Wort und einem Satz. Fleischer/Barz nennen als Wortbildungseigenschaft die ,,Schaffung von Benennungseinheiten", die, anders als syntaktische Fügungen, meist als feste Wortschatzeinheiten gespeichert werden. (Fleischer/Barz 1992,1)
Ebenfalls von der Wortbildung abzugrenzen ist die Flexion oder Wortformenbildung. Die Flexion ist unter anderem ,,durch die stabilere Systematik", die sich nach der Klassenzugehörigkeit des Wortes richtet, und durch die ,,Invariante der lexikalischen Bedeutung" gekennzeichnet. (vgl. Fleischer/Barz 1992, 3f.)
1.3. Die Wortbildung des Verbs ... 2 [...]
Inhaltsverzeichnis
- Geschichtliche, begriffliche und thematische Schwerpunktsetzung der Arbeit
- Zur Geschichte der Wortbildungslehre
- Zum Wortbildungsbegriff
- Die Wortbildung des Verbs
- Derivation
- Präfigierung
- Die semantische Modifikation
- Die syntaktische Modifikation
- Suffigierung
- Das Suffix -(e)l(n)
- Das Suffix -ig(en)
- Das Suffix -ier(en)
- Das verbale -(en)
- Konversion
- Kombinatorische Derivation
- Implizite Derivation
- Komposition
- Komposita aus zwei Verben
- Komposita mit einem Nominalstamm als Erstglied
- Komposita mit einem Adverb als Erstglied
- Rückbildung
- Das kompliziert vernetzte System der Verbbildung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Verbbildung im Deutschen. Sie verfolgt das Ziel, die verschiedenen Prozesse und Modelle der Verbbildung zu beleuchten und aufzuzeigen, wie diese die semantische und syntaktische Struktur von Verben beeinflussen.
- Die historischen Entwicklungen der Wortbildungslehre und die Definition des Wortbildungsbegriffs.
- Die verschiedenen Arten der Derivation, insbesondere Präfigierung und Suffigierung, sowie deren Auswirkungen auf die Bedeutung und den Gebrauch von Verben.
- Die Komposition von Verben, insbesondere die Bildung von Komposita aus zwei Verben, und die Rolle der Syntax in der Wortbildung.
- Die Rückbildung als ein weiterer Prozess der Verbbildung.
- Das komplexe Zusammenspiel der verschiedenen Wortbildungsmechanismen und deren Einfluss auf die Gesamtstruktur des deutschen Verbsystems.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die historischen Entwicklungen der Wortbildungslehre und definiert den Begriff der Wortbildung. Außerdem wird die spezifische Rolle der Wortbildung des Verbs im deutschen Sprachsystem behandelt.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Derivation, insbesondere die Präfigierung und die Suffigierung. Es werden die verschiedenen Typen von Präfixen und Suffixen im Detail analysiert und deren Auswirkungen auf die Bedeutung und den Gebrauch von Verben untersucht.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Komposition von Verben, insbesondere der Bildung von Komposita aus zwei Verben. Es wird die Rolle der Syntax in der Verbbildung beleuchtet und die spezifischen Eigenschaften von Verbkomposita analysiert.
Das vierte Kapitel widmet sich der Rückbildung als einem weiteren Prozess der Verbbildung.
Schlüsselwörter
Verbbildung, Wortbildung, Derivation, Präfigierung, Suffigierung, Komposition, Rückbildung, Syntax, Semantik, Valenz, Verbkomposita, Wortbildungslehre, deutsche Sprache.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Wortbildung und Wortschöpfung?
Wortbildung nutzt vorhandene Bauelemente einer Sprache, um neue Wörter zu formen. Wortschöpfung hingegen erfindet komplett neue elementare Zeichen, was heute kaum noch vorkommt.
Wie funktioniert die Präfigierung bei Verben?
Durch das Voranstellen eines Präfixes wird die Bedeutung (semantisch) oder die grammatische Verwendung (syntaktisch, z.B. Valenzänderung) eines Verbs modifiziert.
Was versteht man unter verbaler Suffigierung?
Dabei werden Suffixe wie -ieren, -eln oder -igen an Stämme angehängt, um neue Verben zu bilden (z.B. telefon-ieren, läch-eln).
Was ist eine Konversion in der Wortbildungslehre?
Konversion ist die Bildung eines neuen Wortes ohne formale Änderung des Stammes, etwa wenn ein Substantiv direkt zum Verb wird (z.B. Fisch -> fischen).
Wie unterscheiden sich Verbkomposita von einfachen Verben?
Verbkomposita bestehen aus zwei Teilen (z.B. Verb+Verb oder Nomen+Verb), die eine neue Benennungseinheit bilden und oft als feste Wortschatzeinheit gespeichert werden.
- Quote paper
- Natalia Schlichter (Author), 2001, Die Verbbildung in der Wortbildungslehre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/425