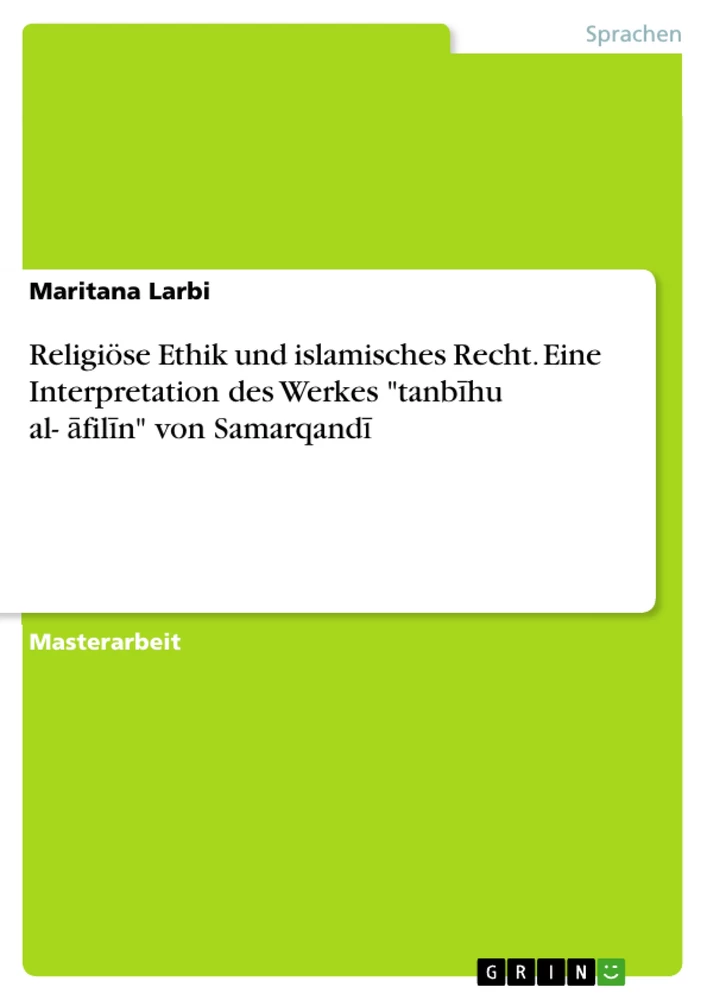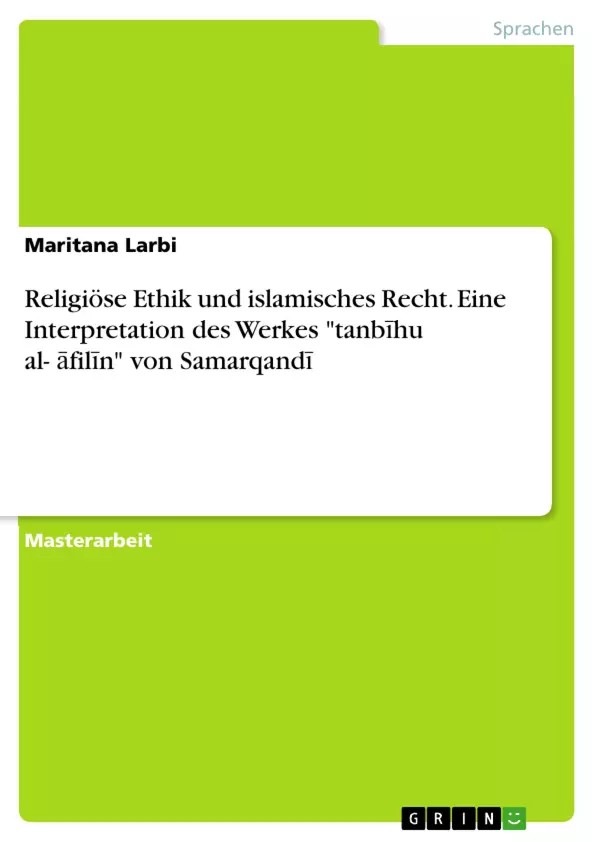Die Kernfragestellung der vorliegenden Arbeit ist, Samarqandīs Werk "tanbīhu al-ġāfīlīn" zu charakterisieren und herauszufinden, welche methodologischen und ethisch-moralischen Grundprinzipien und Handlungsmuster in diesem Werk genutzt wurden, ohne dass hier ein Bild von einer „überhistorischen menschlichen Natur“ rekonstruiert werden soll.
Abū Layṯ Samarqandīs (gestorben 373/983) wohl bekanntestes Werk "tanbīhu al-ġāfīlīn" (Aufwecken der Sorglosen) gibt das Grundprinzip des islamischen Rechts genau wieder und bietet aus Sicht der historischen Kulturforschung mehr als einen ausreichenden Einblick in der Vorstellung der religiös-ethischen Grundsätze eines Menschen des vierten Jahrhunderts der islamischen Zeitrechnung. Die Brisanz dieses Werkes besteht in der methodologischen Vorgehensweise des Autors, da er zur Argumentationsbestätigung seiner ethischen Einweisungen eine beträchtliche Anzahl von schwachen und fabrizierten Hadithen hinzuzieht, obwohl sich zu seiner Zeit wohl bereits eine feste Lehre von der Klassifizierung bzw. vom Gebrauch von Hadithen durchgesetzt hatte. Daher geht es dem Autor mehr um das Finden des semantischen Feldes von moralischen Handlungsanweisungen als um das traditionelle Festhalten an der Glaubwürdigkeit bzw. Nichtglaubwürdigkeit der Prophetenüberlieferung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ethik und das islamische Recht
- Der islamische Ethikbegriff
- Die Prädestinationsfrage
- Das Religiöse und das Moralische des islamischen Rechts
- Begriffsunterscheidung zwischen Scharia und figh
- Die moralische Begründbarkeit von Rechtsnormen
- Beurteilungsskale menschlicher Handlungen
- Die Trennung zwischen juristischen und moralisch-religiösen Urteilen
- Koran und Sunna als die moralisch-ethischen Instanzen
- Der Koran in der ethisch-rechtlichen Diskussion
- Die Frage nach der koranischen Rechtspraxis
- Die koranische Selbstrepräsentation als die göttliche Wegweisung
- Die Sunna in der rechtlich-ethischen Diskussion
- Das sunna-Konzept
- Kanonisierung der Sunna
- Literaturgattung kitāb al-arba in
- Das Verhältnis des Koran zur Sunna in der rechtlichen Diskussion
- Der Koran in der ethisch-rechtlichen Diskussion
- Islam als Orthopraxie
- Zusammenfassung
- Der islamische Ethikbegriff
- Transoxanien zur Zeit Samarqandīs
- Die sozio-politischen Voraussetzungen: die Samanidendynastie (819-999)
- Rechtlich-theologisches Klima in Transoxanien zwischen dem 8. und 11. Jahrhunderts
- Die Murği'a
- Die Māturīdīya
- Die Hanafiya
- Samarqandīs Leben und seine Werke
- Zur Biografie Samarqandīs
- Übersicht der gesamten Werke Samarqandīs
- Das Werk tanbīhu al-ġāfilīn
- Der methodische Aufbau des Werkes
- Die Themenstruktur des Werkes
- Das Problem von nichtkanonischen Überlieferungen
- Übersetzung und Auswertung einzelner Kapitel
- Das erste einführende Kapitel al-'iḥlās (1)
- Eigenschaften der Hölle und ihrer Angehörigen (5)
- Aufbewahrung der Rede (24)
- Kapitel über die Güte des Koran (56)
- Das Handeln mit dem Wissen (58)
- Das Gottvertrauen (tawakkul) (64)
- Die Kapitel über ğihād, ġazwa und ribāṭ (70-71)
- Die Güte von umma des Propheten (74)
- Die Kapitel über die Rechte der Eheleute (75-76)
- Das Handeln mit der Sunna (84)
- Der methodische Aufbau des Werkes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit analysiert das Werk "tanbīhu al-ġāfilīn" von Abū Layt al-Samarqandī (gest. 373/983) und untersucht die Verbindung zwischen islamischem Recht und religiöser Ethik in der frühen islamischen Zeit. Dabei werden die ethischen Prinzipien, die in Samarqandīs Werk zum Ausdruck kommen, in ihren historischen Kontext eingeordnet und im Hinblick auf ihre Relevanz für die gegenwärtige Diskussion über Islam und Moderne beleuchtet.
- Die Bedeutung von Koran und Sunna für die Ausformung des islamischen Rechts
- Die Rolle der Ethik in der Rechtsauslegung und -anwendung
- Die Bedeutung der individuellen Selbstdisziplinierung und der sozialen Verantwortung im islamischen Kontext
- Die Bedeutung der Hadith-Klassifizierung für die ethische Diskussion im islamischen Recht
- Die Relevanz von Samarqandīs Werk für die aktuelle Islamdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des islamischen Rechts für die ethische Diskussion und die Bedeutung von Samarqandīs Werk "tanbīhu al-ġāfilīn" vor. Im zweiten Kapitel wird der islamische Ethikbegriff erläutert und das Verhältnis zwischen islamischem Recht und religiöser Ethik dargestellt. Die Kapitel drei und vier beleuchten den historischen Kontext des Werkes und stellen das Leben und Werk des Autors vor. Das fünfte Kapitel analysiert die Struktur und den Inhalt des Werkes "tanbīhu al-ġāfilīn" und beleuchtet verschiedene Kapitel aus dem Werk.
Schlüsselwörter
Islamisches Recht, religiöse Ethik, Abū Layt al-Samarqandī, tanbīhu al-ġāfilīn, Koran, Sunna, Hadith, Transoxanien, Samanidendynastie, Hanafiya, ethische Prinzipien, historische Kontext, Islam und Moderne.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Abū Layṯ Samarqandī?
Abū Layṯ Samarqandī (gest. 983 n. Chr.) war ein bedeutender Gelehrter der Hanafiya-Rechtsschule in Transoxanien, dessen Werke tiefen Einblick in die religiös-ethischen Grundsätze seiner Zeit bieten.
Was ist der Kerninhalt des Werkes „tanbīhu al-ġāfilīn“?
Das Werk, übersetzt als „Aufwecken der Sorglosen“, behandelt die religiöse Ethik und das islamische Recht. Es liefert moralische Handlungsanweisungen für den Alltag eines gläubigen Muslims.
Warum nutzt der Autor „schwache“ Hadithe in seiner Argumentation?
Samarqandī ging es primär um die moralische Unterweisung und das semantische Feld der Ethik. Daher legte er mehr Wert auf die pädagogische Wirkung als auf die strikte formale Klassifizierung der Prophetenüberlieferungen.
Was ist der Unterschied zwischen Scharia und Fiqh laut diesem Werk?
Die Arbeit untersucht die begriffliche Unterscheidung zwischen der göttlichen Scharia und der menschlichen Rechtsfindung (Fiqh) sowie die moralische Begründbarkeit von Rechtsnormen.
Welche Themen werden in den Kapiteln des Werkes behandelt?
Zu den Themen gehören Aufrichtigkeit (al-iḥlās), die Rechte der Eheleute, das Handeln nach Wissen, Gottvertrauen (tawakkul) und der Umgang mit der Sunna.
- Arbeit zitieren
- Maritana Larbi (Autor:in), 2017, Religiöse Ethik und islamisches Recht. Eine Interpretation des Werkes "tanbīhu al-ġāfilīn" von Samarqandī, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/425063