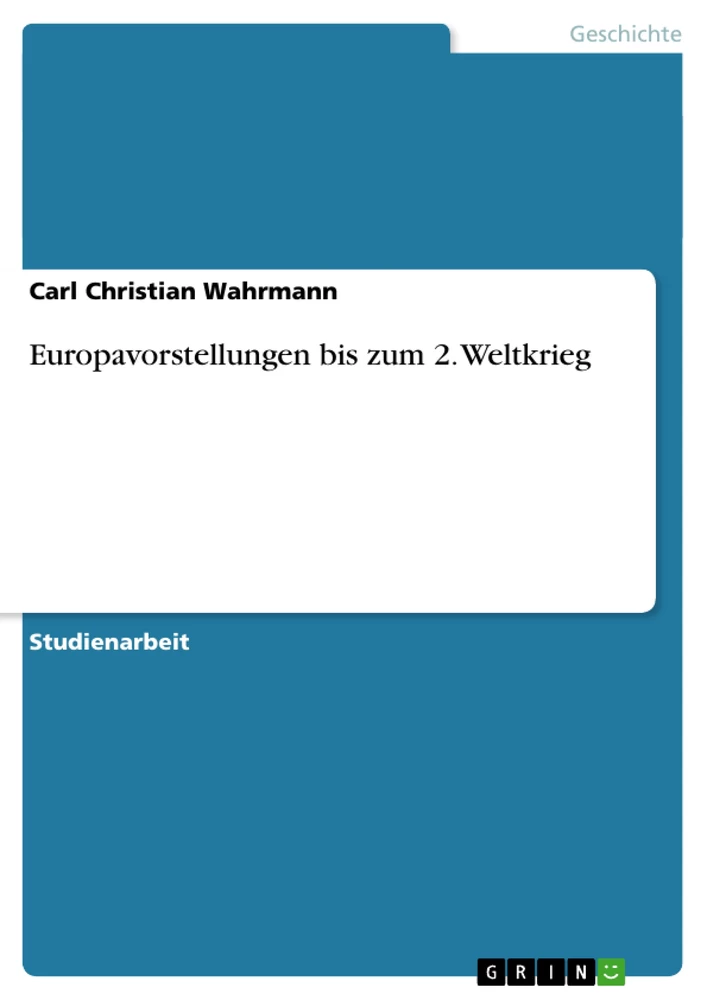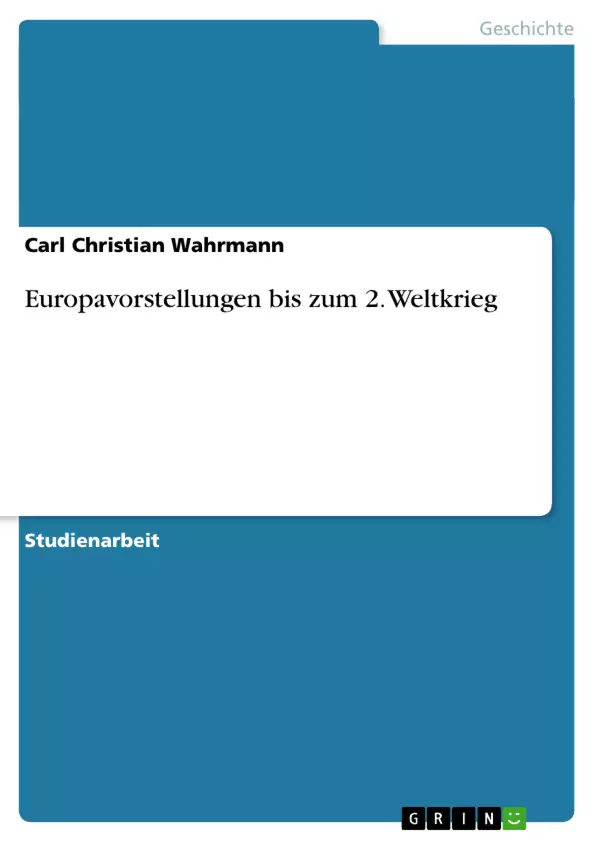Europa – Versuch einer Definition
Was ist eigentlich Europa? Diese Frage stellt sich zwangsläufig, wenn sich eine Arbeit mit der Einheit und den Plänen zur Einigung Europas beschäftigt. Etymologisch betrachtet, leitet sich das Wort „Europa“ vom assyrischen Wort „ereb“ ab, das recht allgemein „Dunkel“ oder „Abendland“ bedeutet und auf die Lage des bezeichneten Gebietes im Gegensatz zum Land des Sonnenaufgangs hinweist, das „acu“ genannt wurde und die Wurzel unseres Wortes „Asien“ darstellt.1 Doch Sprachgeschichte allein genügt nicht zur Klärung der Frage nach Europa.
Geografisch betrachtet bildet die mit diesem Namen bezeichnete Landmasse die vielgegliederte westliche Halbinsel Asiens. Die Griechen des 6. Jahrhunderts v. Chr. bereits bezeichneten die westlichen Küstengebiete der Ägäis und des Schwarzen Meeres als „Europe“, wobei diese Bedeutung sich in der weiteren Entwicklung auf die küstenferneren Hinterländer ausdehnte. Wo aber endet Europa? Weder ist es wie Australien völlig von Wasser umschlossen, noch existiert eine markante Landenge als deutlicher Grenzpunkt, wie sie Nord- von Südamerika bei Panama und Asien von Afrika bei Suez trennt. Während die Bestimmung der Süd-, West- und Nordgrenzen durch Meere erleichtert wird, ist die Frage, wo Europa im Osten endet, komplizierter.2 Seit dem 18. Jahrhundert gilt das Uralgebirge als Grenze gegenüber Asien, obwohl diese Setzung weder eine ethnische noch eine politische Grenze markiert.
Für politische Konzeptionen spielt die geografische Abgrenzung des Kontinents nur bedingt eine Rolle.
...
-------
1 Isensee, Josef: Europa – die politische Erfindung eines Erdteils. In: Kirchhof, Paul; Schäfer, Hermann; Tietmeyer, Hans (Hrsg.): Europa als politische Idee und als rechtliche Form (Wissenschaftliche Abhandlungen und Reden zur Philosophie, Politik und Geistesgeschichte 19). Berlin ²1994, S. 107.
2 Hiestand, Rudolf: „Europa“ im Mittelalter – vom geographischen Begriff zur politischen Idee. In: Hecker, Hans [u.a.] (Hg.): Europa – Begriff und Idee. Historische Streiflichter (Kultur und Erkenntnis 8). Bonn 1991, S. 35.
3 Lobkowicz, Nikolaus: Das geistige Vermächtnis Europas. In: Hecker, Hans; Spieler, Silke (Hg.): Die historische Einheit Europas. Ideen – Konzepte – Selbstverständnis. Bonn 1994, S. 1.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Europa Versuch einer Definition
- 2. Die Vision europäischer Einheit
- 2.1. Die Tradition von Europaplänen in der Geschichte
- 2.2. Der große Plan (Sully)
- 2.3. L'Empire (Napoleon)
- 2.4. Pan-Europa (Coudenhove-Kalergi)
- 3. Ergebnis und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit verschiedenen Bestrebungen, die darauf abzielten, in Europa einen dauerhaften Frieden zu ermöglichen. Sie untersucht verschiedene Konzepte, die zur Durchsetzung dieses Ziels eingesetzt wurden, und analysiert drei unterschiedliche Entwürfe zur europäischen Einigung: die theoretischen Pläne von Sully und Coudenhove-Kalergi sowie die durch militärische Siege etablierte Hegemonialordnung Napoleons. Die Arbeit beschäftigt sich insbesondere mit den Anlässen für die Reform der bestehenden politischen Zustände, den angestrebten Zielen, den eingesetzten Mitteln zur Durchsetzung und den Auswirkungen der Überlegungen auf die reale Politik.
- Die Frage nach der Definition von Europa
- Die Geschichte von Europaplänen
- Die verschiedenen Konzepte zur europäischen Einigung
- Die Rolle von Sully, Napoleon und Coudenhove-Kalergi in der europäischen Einigungsdebatte
- Die Auswirkungen von Europaplänen auf die reale Politik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Europa Versuch einer Definition
Dieses Kapitel beleuchtet die Problematik der Definition von Europa. Die Arbeit geht auf die etymologische und geografische Herleitung des Begriffs "Europa" ein und stellt die Komplexität der Grenzziehung zwischen Europa und Asien heraus. Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage gewidmet, inwieweit die geografische Abgrenzung Europas für politische Konzeptionen von Bedeutung ist.2. Die Vision europäischer Einheit
2.1. Die Tradition von Europaplänen in der Geschichte
Dieses Unterkapitel untersucht die Tradition von Europaplänen in der Geschichte und stellt die zahlreichen Entwürfe für ein geeintes und friedliches Europa vor. Die Arbeit analysiert die Motivation der Planer, die historischen Hintergründe der Pläne und die verschiedenen Ansätze zur Lösung der europäischen Zerstrittenheit.2.2. Der große Plan (Sully)
Dieses Unterkapitel analysiert den Plan des französischen Ministers Sully, der im frühen 17. Jahrhundert eine umfassende Friedensordnung für Europa entwarf. Die Arbeit beleuchtet die zentralen Elemente von Sullys Plan, seine Motivationen und die Auswirkungen auf die politische Landschaft Europas.2.3. L'Empire (Napoleon)
Dieses Unterkapitel konzentriert sich auf das Konzept des "L'Empire" von Napoleon Bonaparte, das die Schaffung eines vereinten Europas durch militärische Eroberung und Hegemonie anstrebte. Die Arbeit untersucht die Machenschaften Napoleons, die politischen und sozialen Auswirkungen seiner Herrschaft und die Dauerhaftigkeit seines Imperiums.2.4. Pan-Europa (Coudenhove-Kalergi)
Dieses Unterkapitel behandelt den "Pan-Europa" Plan des österreichischen Politikers Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi, der im 20. Jahrhundert für eine friedliche und vereinte Europa plädierte. Die Arbeit untersucht die zentralen Ideen des Pan-Europa-Konzepts, die Rolle von Coudenhove-Kalergi in der europäischen Einigungsdebatte und die Auswirkungen des Konzepts auf die europäische Politik.Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Konzepten der europäischen Einigung und den verschiedenen Visionen für ein friedliches und vereintes Europa. Im Zentrum stehen die Begriffe: Europapläne, Friedenssicherung, Hegemonie, Nationalstaat, christlich-abendländische Kultur, traditionelle Europapläne, Sully, Napoleon, Coudenhove-Kalergi, Pan-Europa, L'Empire, Westorientierung, Türkei, politische Ordnung, Europabild, politische Geschichte.Häufig gestellte Fragen
Woher leitet sich der Begriff "Europa" etymologisch ab?
Etymologisch stammt das Wort vom assyrischen "ereb" ab, was "Dunkel" oder "Abendland" bedeutet, im Gegensatz zum asiatischen "acu" (Sonnenaufgang).
Was war Sullys "Großer Plan" für Europa?
Im frühen 17. Jahrhundert entwarf der französische Minister Sully eine theoretische Friedensordnung zur Einigung des Kontinents und zur Überwindung der religiösen und politischen Zerstrittenheit.
Wie versuchte Napoleon, Europa zu einigen?
Napoleon verfolgte das Konzept eines "L'Empire", bei dem Europa durch militärische Eroberung unter einer französischen Hegemonialordnung zwangsweise geeint werden sollte.
Was verbirgt sich hinter dem Pan-Europa-Konzept von Coudenhove-Kalergi?
Richard Graf Coudenhove-Kalergi plädierte im 20. Jahrhundert für eine friedliche, demokratische Vereinigung Europas als Antwort auf den Nationalismus und zur Sicherung des Friedens.
Wo liegt die geografische Ostgrenze Europas?
Seit dem 18. Jahrhundert wird meist das Uralgebirge als Grenze zu Asien angesehen, wobei diese Festlegung eher konventionell als politisch oder ethnisch begründet ist.
- Quote paper
- M.A. Carl Christian Wahrmann (Author), 2005, Europavorstellungen bis zum 2. Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42530