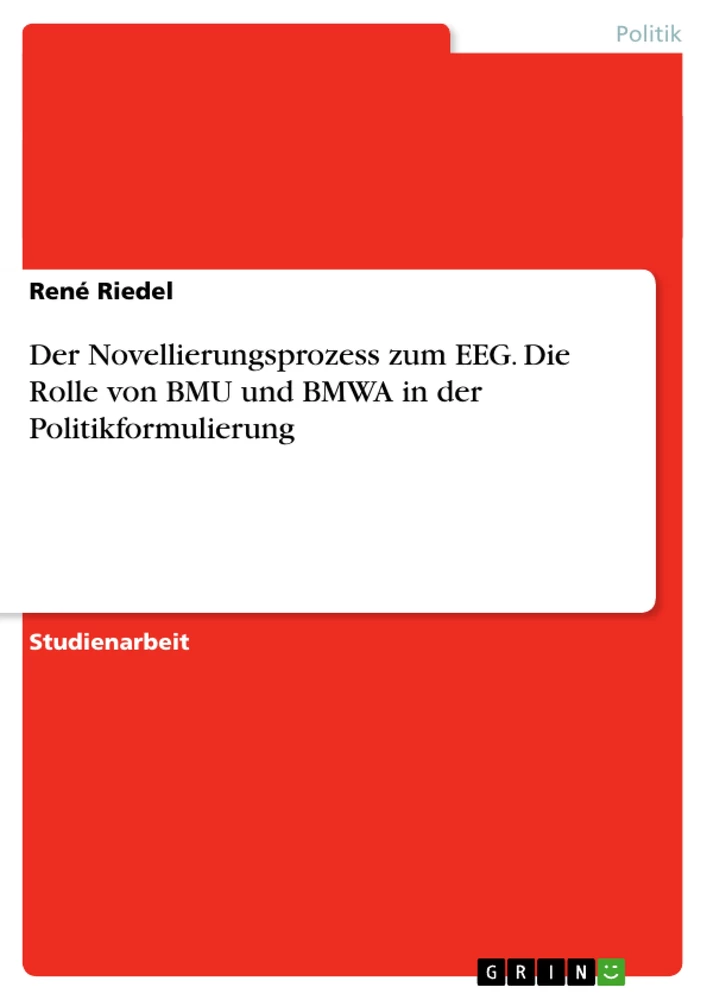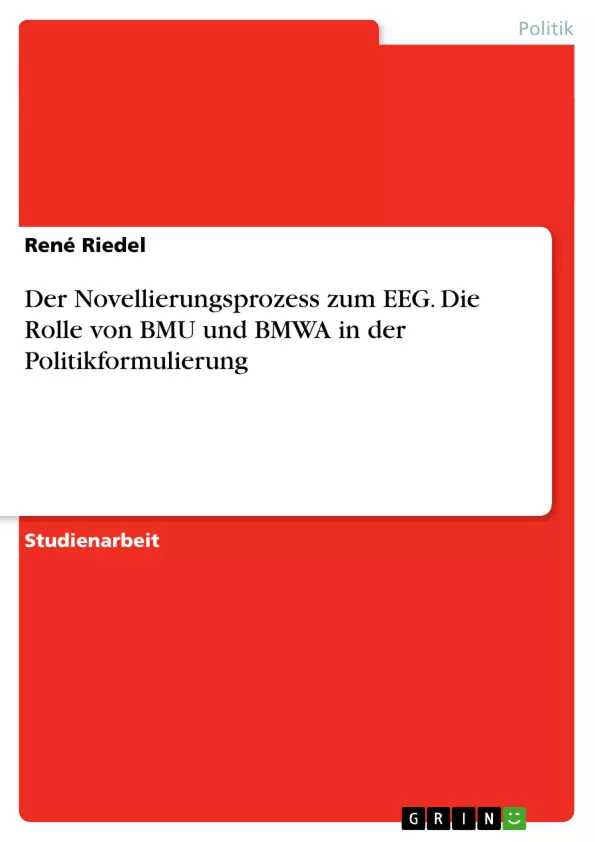Einleitung
Mit der Wiederwahl der rot-grünen Koalitionsparteien im Jahr 2002 wechselte nach Stimmenzuwächsen für die Grünen die Zuständigkeit für die erneuerbaren Energien vom Wirtschafts- zum Arbeitsministerium. Bald danach wurde eine Neufassung des Erneuerbare- Energien-Gesetzes aus dem Jahr 2000 auf den Weg gebracht.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage danach, wie sich diese Änderung auf den Novellierungsprozess auswirkte.
Dass die Untersuchung sich also an der Rolle der beteiligten Akteure ausrichtet, liegt auf der Hand. Dabei liegt die Annahme nahe, dass die Kompetenzübernahme des, die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien durch eine Einspeisevergütung befürwortenden, Umweltministeriums die Zusammenarbeit zwischen Kabinett und und Parlament vereinfachen werde, zumal in den Koalitionsfraktionen dieselbe Auffassung vorherrscht. Allerdings darf hier nicht übersehen werden, dass besonders innerhalb der SPD-Fraktion eine starke Gruppe nach ökonomischen Kriterien argumentierender Parlamentarier gibt, die dem Gesetz skeptisch gegenüberstanden.
Die beiden Bundesministerien können, wie dargelegt werden wird, bei all dem als zentrale Akteure der sich gegenüberstehenden Interessenkoalitionen verstanden werden und sind als solche lohnenswerte Untersuchungsgegenstände. Dennoch sind sie keineswegs die einzigen relevanten Akteure. Der Konflikt zwischen den beiden Ministerien zeichnete sich bereits im Entstehungsprozess des ersten EEG ab. Damals hatte bedingt durch die Blockadehaltung des Wirtschaftsressorts das Parlament die gestaltende Rolle übernommen.
Zunächst soll also ein historischer Abriss zur Entwicklung der Förderung der erneuerbaren Energien durch Einspeisevergütungsregelungen seit den frühen 1990er Jahren gegeben werden. Danach folgt die Darstellung der Akteurs- und Interessenkoalitionen im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energieträger zur Stromerzeugung, um zuletzt deren Rolle im Novellierungsprozess unter besonderer Berücksichtigung der beiden Ministerien zu untersuchen und darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der Einspeisevergütung in Deutschland bis zur Novellierung des EEG
- Akteure und Interessen
- Akteure
- Akteurskonstellationen in der EEG-Novellierung
- Der Novellierungsprozess
- Zu Notwendigkeit einer Novellierung und Agenda Setting
- Die Politikformulierung
- Bis zum ersten Referentenentwurf
- Reaktionen auf den Referentenentwurf
- Ressortabsprache, Photovoltaik-Vorschaltgesetz und zweiter Referentenentwurf
- Reaktionen
- Anhörung im Ausschuss und Beschluss im Bundestag
- Vermittlungsverfahren und Verabschiedung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Novellierungsprozess des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2002 und untersucht dabei die Rolle des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) in der Politikformulierung. Im Vordergrund steht die Frage, wie die Kompetenzübernahme des BMU für die erneuerbaren Energien den Novellierungsprozess beeinflusst hat.
- Die Rolle des BMU und BMWi im Novellierungsprozess des EEG
- Die Einflussfaktoren auf die Politikformulierung, insbesondere die Interessen der beteiligten Akteure
- Die Herausforderungen und Konflikte im Novellierungsprozess, insbesondere zwischen den Koalitionsfraktionen und den Ministerien
- Die Entwicklung der Einspeisevergütung für erneuerbare Energien in Deutschland
- Die Bedeutung des EEG für die Förderung erneuerbarer Energien und die Energiewende
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Fokus der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Bedeutung der Kompetenzübernahme des BMU für die erneuerbaren Energien und die damit verbundenen Erwartungen an den Novellierungsprozess. Kapitel 2 zeichnet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Einspeisevergütung für erneuerbare Energien in Deutschland seit den frühen 1990er Jahren, beginnend mit dem Stromeinspeisegesetz (StrEG) und der Entwicklung des EEG. Kapitel 3 präsentiert die wichtigsten Akteure und Interessenkoalitionen im Bereich der erneuerbaren Energien, einschließlich der beteiligten Ministerien, Parteien, Wirtschaftsunternehmen und Umweltverbände. Dieses Kapitel analysiert auch die Akteurskonstellationen in der EEG-Novellierung. Kapitel 4 widmet sich dem Novellierungsprozess selbst, beginnend mit der Notwendigkeit einer Novellierung und dem Agenda-Setting. Es beleuchtet die einzelnen Phasen der Politikformulierung, die Reaktionen auf den ersten Referentenentwurf und die Ressortabsprachen. Weiterhin werden die Anhörung im Ausschuss, der Beschluss im Bundestag und das Vermittlungsverfahren behandelt. Das Kapitel analysiert die Rolle des BMU und BMWi im Novellierungsprozess und zeigt die Konflikte und Herausforderungen auf, denen sie sich gegenüber sahen.
Schlüsselwörter
Erneuerbare Energien, EEG, Novellierungsprozess, Politikformulierung, Akteure, Interessenkoalitionen, BMU, BMWi, Einspeisevergütung, Strommarktliberalisierung, Energiewende, Förderung, Umweltschutz, Wirtschaft, Politik.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste der Zuständigkeitswechsel 2002 die EEG-Novellierung?
Durch den Wechsel der Zuständigkeit vom Wirtschafts- zum Umweltministerium (BMU) wurde die Förderung erneuerbarer Energien politisch stärker priorisiert.
Welche Rollen spielten BMU und BMWi im Novellierungsprozess?
Das BMU trat als Befürworter der Einspeisevergütung auf, während das BMWi oft eine skeptischere, auf ökonomische Kriterien fixierte Haltung einnahm.
Warum gab es innerhalb der SPD-Fraktion Konflikte zum EEG?
Innerhalb der SPD gab es eine starke Gruppe von Parlamentariern, die dem Gesetz aus wirtschaftlichen Gründen skeptisch gegenüberstanden, was die Ressortabstimmung erschwerte.
Was war das Ziel des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)?
Ziel war es, den Ausbau erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung durch garantierte Einspeisevergütungen massiv zu fördern und die Energiewende voranzutreiben.
Welche Phasen durchlief die Politikformulierung beim EEG?
Der Prozess umfasste die Erstellung von Referentenentwürfen, Ressortabsprachen, Anhörungen im Ausschuss sowie das abschließende Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat.
- Arbeit zitieren
- René Riedel (Autor:in), 2005, Der Novellierungsprozess zum EEG. Die Rolle von BMU und BMWA in der Politikformulierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42537