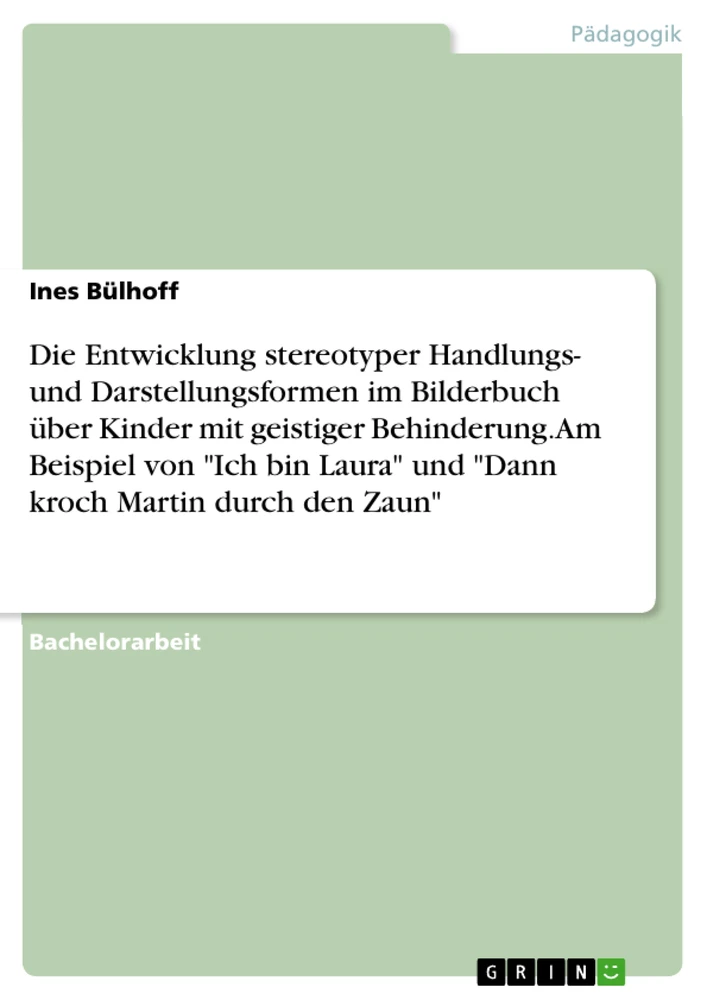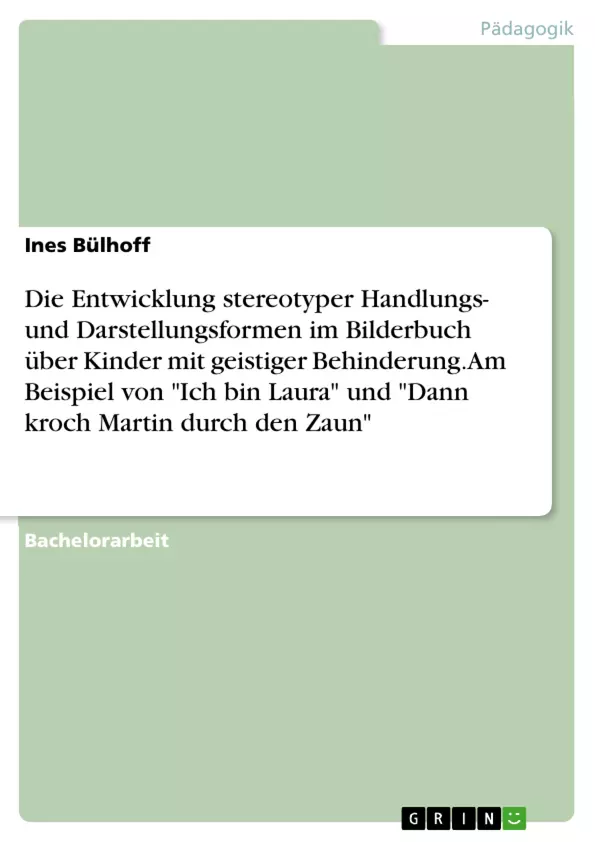Inklusion – so lautet der Leitgedanke der im Jahr 2006 verabschiedeten UN-Behindertenrechtskonvention. Durch Inklusion soll allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht werden. Das gemeinsame Leben von Menschen mit und ohne Behinderungen soll zur Normalität werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss vieles reflektiert und verändert werden. Schon in der Kindheit sollte die Einstellung entstehen, Menschen mit Behinderungen nicht zu benachteiligen, sondern als Teil der Gesellschaft anzusehen. Bei dieser Entwicklung kommt der Kinder- und Jugendliteratur und insbesondere dem Bilderbuch eine wichtige Rolle zu.
Wenn Kinder in ihrem sozialen Umfeld keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderungen haben, bieten Bilderbücher eine erste Möglichkeit, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Wirft man jedoch ein Blick auf die Anzahl der entsprechenden Veröffentlichungen, so ist die Auswahl eher gering. Dabei zeigen beispielsweise schon Untersuchungen von Rupp (1981), dass Kinder insbesondere in jüngeren Jahren, unter anderem im Alter von fünf bis sieben, ein verstärktes Interesse an der Behindertenthematik haben. Da die Auswahl an geeigneter Literatur in diesem Alter noch stark begrenzt ist, werden Bilderbücher für Kinder umso relevanter.
Aufgrund dieser Relevanz werden im Kontext dieser Bachelorarbeit Bilderbücher über Kinder mit Behinderungen in den Blick genommen. Gerade weil die Anzahl dieser Bücher eher gering ausfällt, ist ein Blick auf die Art der Umsetzung und die dadurch erzeugte Wirkung auf die kindlichen Leser von Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stereotype - eine Annäherung
- Topoi in der Kinder- und Jugendliteratur
- Der Umgang mit Behinderungen in der KJL
- Ein geschichtlicher Überblick zur Thematisierung von Behinderungen
- Geistige Behinderung in der KJL und im Bilderbuch
- Stereotype Darstellungsweisen von Menschen mit Behinderungen in der KJL
- Ein Blick auf Bilderbücher
- Vorstellung der Bilderbücher
- Kriterienkatalog und Vorgehensweise
- Vergleichende Analyse
- Inhaltsangabe
- Die Figuren und ihre Konstellationen
- Diskurs und verbale Dimension
- Bildästhetik und Inszenierung von Verbal- und Bildtext
- Rezeptions- und Wirkungsästhetische Fragen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Darstellung von Kindern mit geistiger Behinderung in Bilderbüchern. Sie analysiert, ob stereotype Handlungs- und Darstellungsformen in früheren und aktuelleren Werken zu finden sind. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein besseres Verständnis für die Entwicklung der Thematisierung von geistiger Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur zu gewinnen und die Auswirkungen dieser Darstellungen auf die kindliche Rezeption zu beleuchten.
- Stereotype in der Darstellung von Kindern mit geistiger Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur
- Entwicklung der Thematisierung von geistiger Behinderung in Bilderbüchern
- Analyse der Wirkung von stereotypen Darstellungen auf die kindliche Rezeption
- Relevanz von Inklusion und der Bedeutung der Kinder- und Jugendliteratur für die Förderung eines inklusiven Denkens
- Bedeutung der Bilderbuchliteratur für die Auseinandersetzung mit der Thematik der geistigen Behinderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Relevanz der Arbeit vor. Sie führt den Begriff der Inklusion ein und beleuchtet die Bedeutung der Kinder- und Jugendliteratur für die Förderung eines inklusiven Denkens. Die Arbeit konzentriert sich auf die Darstellung von Kindern mit geistiger Behinderung in Bilderbüchern und erklärt die Wahl des Schwerpunkts.
- Stereotype - eine Annäherung: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Stereotyps und beleuchtet verschiedene Ansätze in der Forschungsliteratur. Es wird erläutert, wie Stereotype in der Kinder- und Jugendliteratur wirken und welche Bedeutung Topoi in diesem Kontext haben.
- Der Umgang mit Behinderungen in der KJL: Das Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Thematisierung von Behinderungen in der Kinder- und Jugendliteratur. Es wird untersucht, wie häufig geistige Behinderung im Vergleich zu anderen Formen von Behinderungen in der Literatur auftaucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Betrachtung von stereotypen Darstellungsformen von Menschen mit Behinderungen in der Kinder- und Jugendliteratur.
- Vorstellung der Bilderbücher: Dieses Kapitel stellt die beiden ausgewählten Bilderbücher vor und erläutert die Gründe für die Auswahl. Die Bilderbücher dienen als Grundlage für die Analyse der stereotypen Handlungs- und Darstellungsformen.
- Kriterienkatalog und Vorgehensweise: Das Kapitel beschreibt den Kriterienkatalog, der für die Analyse der Bilderbücher verwendet wird. Es erläutert die Vorgehensweise der Arbeit und die methodischen Ansätze.
- Vergleichende Analyse: In diesem Kapitel werden die beiden Bilderbücher anhand des zuvor definierten Kriterienkatalogs analysiert. Die Analyse beleuchtet die Inhaltsangabe, die Figuren und ihre Konstellationen, den Diskurs und die verbale Dimension sowie die Bildästhetik und die Inszenierung von Verbal- und Bildtext. Die Analyse befasst sich mit den Rezeptions- und Wirkungsästhetischen Fragen der Bilderbücher.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Inklusion, Stereotype, Kinder- und Jugendliteratur, Bilderbücher, geistige Behinderung, Darstellungsformen, Rezeption, Wirkung, Analyse, Vergleich, Inklusion, Diversität, Kinder mit Behinderungen, Handlungsformen, Bildästhetik, und Inklusion.
- Quote paper
- Ines Bülhoff (Author), 2018, Die Entwicklung stereotyper Handlungs- und Darstellungsformen im Bilderbuch über Kinder mit geistiger Behinderung. Am Beispiel von "Ich bin Laura" und "Dann kroch Martin durch den Zaun", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/425445