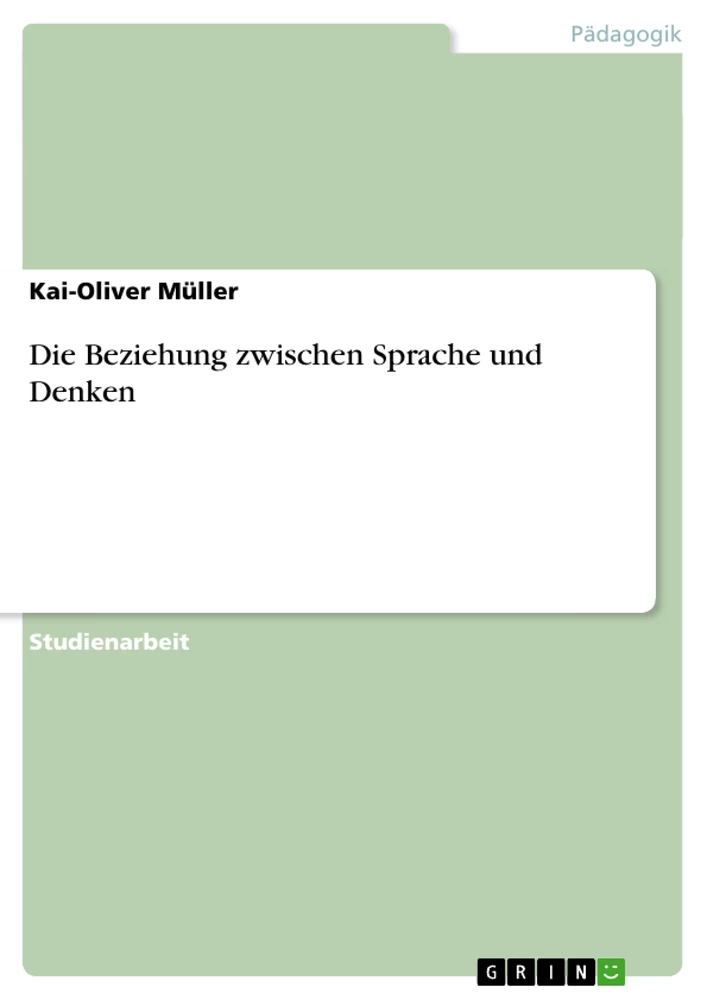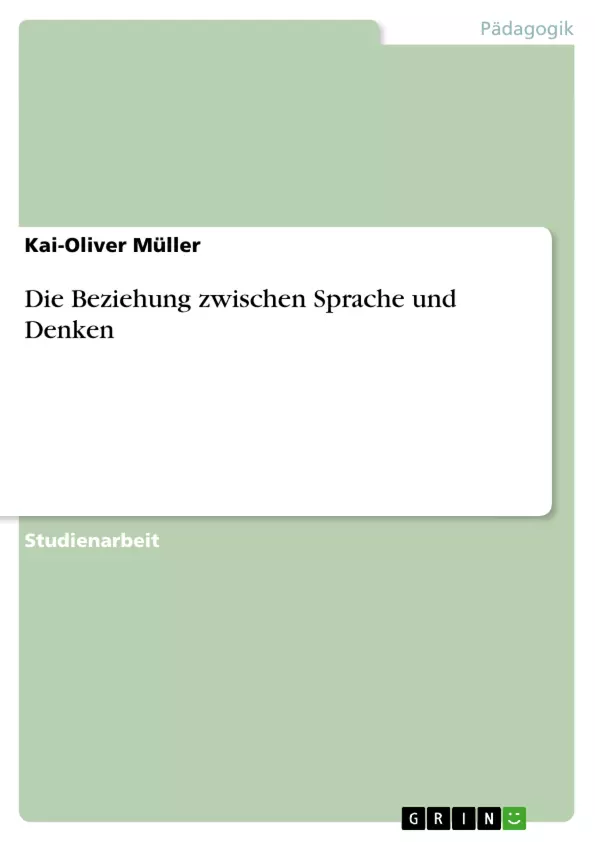Einleitung
Die Diskussion um das Verhältnis von Sprache und Denken hat eine jahrhundertealte Tradition:
Schon Aristoteles verfocht vor fast 2000 Jahren die Ansicht, dass die Prozesse und Strukturen des Denkens die Struktur der Sprache bestimmen.
Diese Ansicht wird heute noch von den meisten Kognitionspsychologen vertreten. Dieser Analyse zufolge, ist die Sprache ein Werkzeug des Denkens, das so geformt wird, dass es den Anforderungen der kognitiven und kommunikativen Prozesse, denen es dient, gerecht wird. Somit ist die Sprache ein Mittel bzw. eine Möglichkeit, um bestimmte Ereignisse und Erfahrungen, welche gespeichert werden sollen, zu enkodieren, wobei die Funktion der Sprache bzw. des Sprechens Kommunikation ist.
Sprache ist zwar eine angeborene Fähigkeit, aber keine genetische Veranlagung. Menschen beginnen nicht automatisch zu sprechen, sondern erlernen Sprache in einem jahrelang andauernden Prozess. Dabei gibt es keinerlei Vorherbestimmtheit , die zur Erzeugung bestimmter Laute führen, so macht es für ein Kind keinen Unterschied, ob es im deutschen oder japanischen Sprachraum aufwächst. Das Kind wird immer die Sprache seiner direkten Umgebung annehmen, worauf unter 2.1 in der Theorie von J. Piaget näher eingegangen wird.
Festgehalten sei, dass das Sprechen zuallererst ein Mittel des sozialen Verkehrs, der Äußerungen und des Verstehens ist. Ohne Sprache oder ein anderes Zeichensystem wäre ein Verkehr bzw. Kommunikation zwischen den Menschen nicht möglich - oder nur auf primitivster Ebene und in eingeschränktem Umfang - wie im Tierreich - möglich. Bei der vorliegenden Arbeit steht die Frage nach der Beziehung zwischen Sprache und Denken im Vordergrund. Es soll also das Verhältnis zwischen Gedanke und Wort näher beleuchtet werden.
Wie klärt man aber nun die Beziehung zwischen Sprache und Denken ?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Darstellung unterschiedlicher Theorien
- 2.1. Die Theorie von J. Piaget
- 2.2. Die Theorie von W. Sterns
- 2.3. Die Theorie von B.L. Whorf
- 3. Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen Sprache und Denken und analysiert unterschiedliche Theorien, die diese Beziehung beleuchten.
- Die Frage nach dem Verhältnis von Sprache und Denken in verschiedenen Theorien
- Die Rolle der Sprache bei der Entwicklung des Denkens
- Die Bedeutung der Sprache als Werkzeug des Denkens
- Die These der Sprachdeterminiertheit des Denkens
- Die Theorie der linguistischen Relativität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor und beleuchtet die Bedeutung des Themas Sprache und Denken. Sie führt den Leser in die Geschichte der Diskussion um das Verhältnis von Sprache und Denken ein und unterstreicht die Bedeutung der Sprache als Werkzeug des Denkens und der Kommunikation.
2. Darstellung unterschiedlicher Theorien
Dieses Kapitel analysiert verschiedene Theorien, die das Verhältnis von Sprache und Denken untersuchen. Es werden die Ansätze von Jean Piaget, Wygotski und B.L. Whorf dargestellt.
2.1. Die Theorie von J. Piaget
Piaget argumentiert, dass die Entwicklung des Denkens weitgehend unabhängig von der Sprache ist. Er sieht Sprache als ein Werkzeug, das zur kognitiven Entwicklung beiträgt, aber nicht die Grundlage dafür bildet.
2.2. Die Theorie von W. Sterns
W. Sterns Theorie behandelt den Zusammenhang von Sprache und Denken. Im Fokus seiner Überlegungen stehen die Sprachentwicklung und die Entwicklung des Denkens. Der Artikel vertritt die Ansicht, dass Sprache und Denken miteinander verwoben sind und sich gegenseitig beeinflussen.
2.3. Die Theorie von B.L. Whorf
Whorf stellt die These der Sprachdeterminiertheit des Denkens auf. Er argumentiert, dass die Sprache die Weltanschauung des Sprechers beeinflusst und prägt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Begriffe Sprache, Denken, Sprachdeterminiertheit, linguistische Relativität, kognitive Entwicklung und Kommunikation. Sie beleuchtet verschiedene Theorien und Ansätze, die das Verhältnis von Sprache und Denken untersuchen.
- Quote paper
- Kai-Oliver Müller (Author), 2004, Die Beziehung zwischen Sprache und Denken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42545