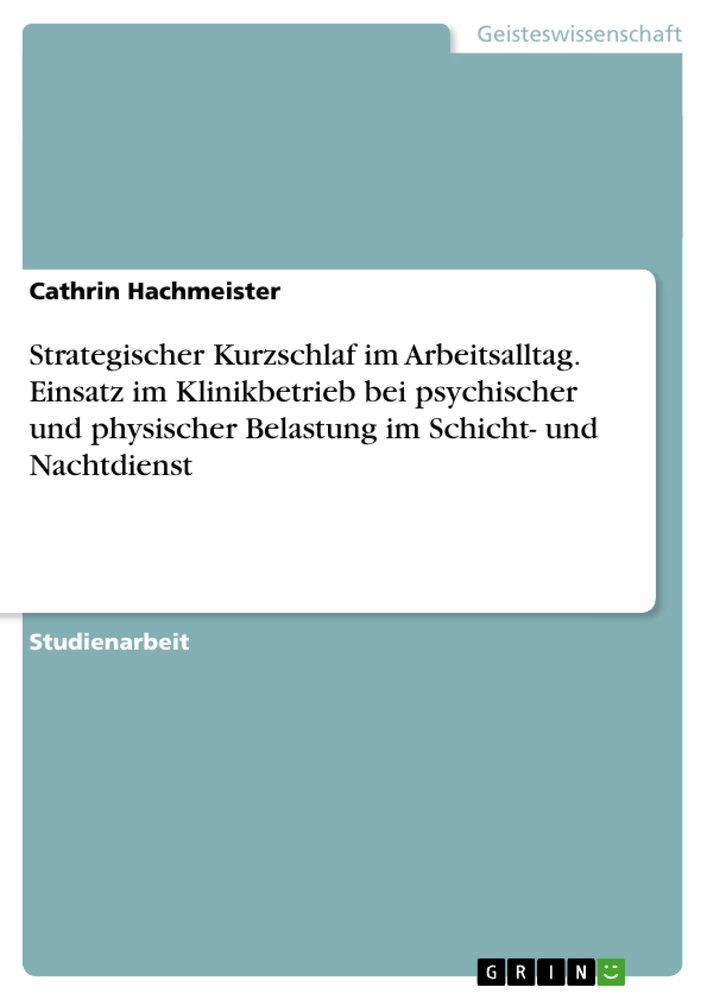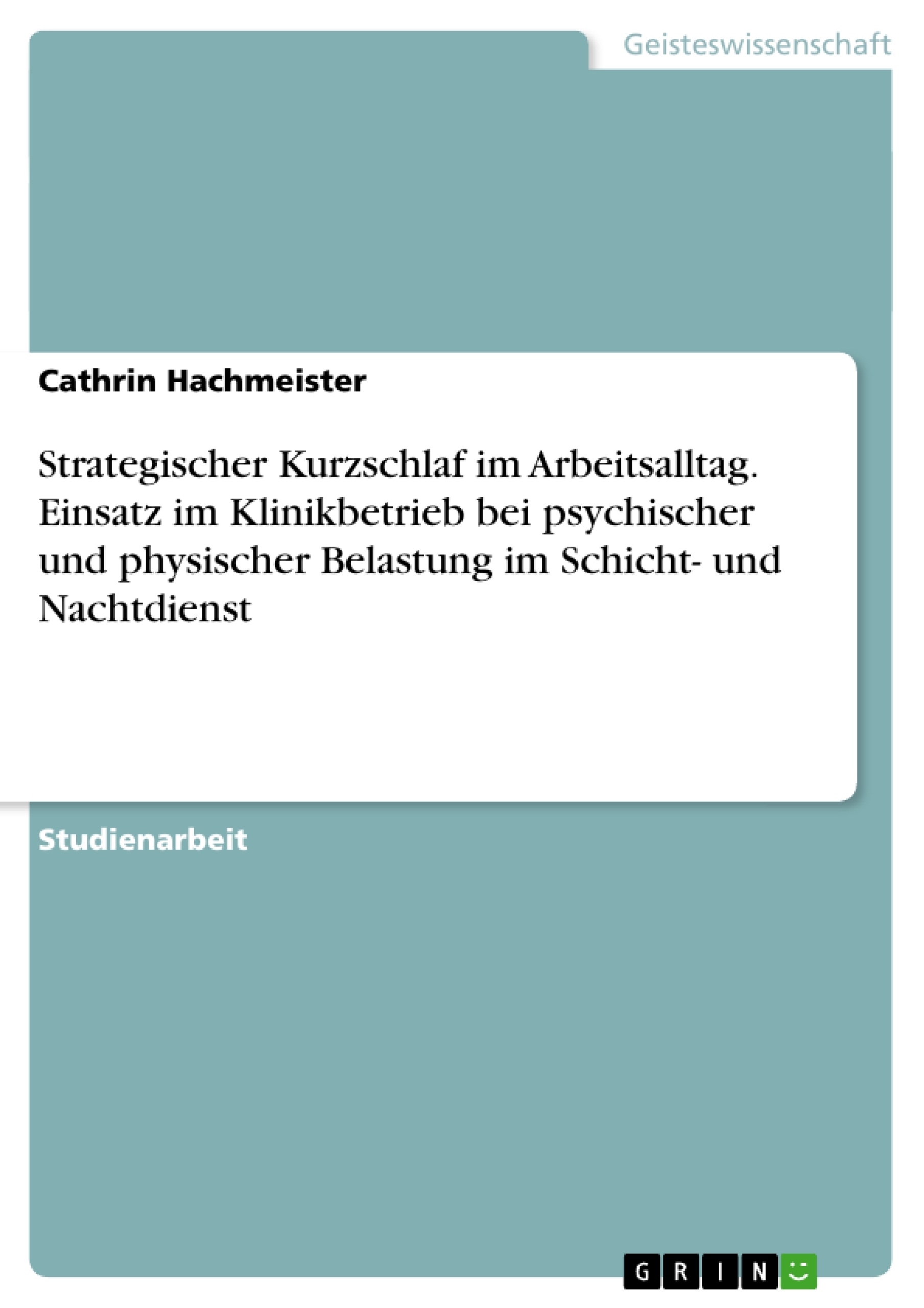Einleitung
Am 27. September 2003 berichtete die Hannoversche Allgemeine Zeitung in ihrer Rubrik „Beruf und Bildung“ über einen Trend: „Mittags ist ein Nickerchen am besten – wer ausgeruht in den Nachmittag startet, beugt Arbeitsunfällen vor“. (HAZ, Nr. 226 vom 27.09.2003). In dem Artikel zeigt der Autor auf, wie eine Mittagspause optimal genutzt werden kann. Dabei soll mindestens eine Viertelstunde auf die Entspannung verwendet werden. Besonders ein kurzes Nickerchen sei empfehlenswert. Dies erhöhe die Leistungsfähigkeit für den Nachmittag und beuge damit auch Unkonzentriertheit vor, die manchmal sogar zu Arbeitsunfällen führen kann.
Das Nickerchen genießt in Deutschland keinen guten Ruf. Ruheständler genießen vielleicht einen Mittagschlaf, aber ein Schläfchen im Büro? Es schwingt der Ruf von Faulheit mit, obgleich Umfragen zufolge jeder dritte Beschäftigte in Deutschland einen Mittagsschlaf für erstrebenswert hält. Dass ein Nickerchen am Tag die Leistungsfähigkeit erhöht ist wissenschaftlich längst erkannt. In den USA spricht man von „Napping“ und der Power Nap ist dort bereits anerkannt und wird von großen Unternehmen wie bspw. PEPSI für seine Mitarbeiter angeboten. In Deutschland sind die Beispiele für den erfolgreichen Einbau des Kurzschlafes in den Arbeitsalltag seltener. Häufig genannt wird dabei die Verwaltung der niedersächsischen Stadt Vechta. In einem Gesundheitsfürsorgeprogramm wird der „Power Nap“ ausdrücklich integriert. Dazu schloss die Stadt eine Betriebsvereinbarung ab, in der den Mitarbeitern eine zusätzliche Entspannungspause von 20 Minuten unter Anrechnung auf die Arbeitszeit gewährt wird. Auf das Beispiel der Stadt Vechta werde ich im vierten Kapitel meiner Arbeit eingehen.
Im Rahmen meiner Hausarbeit möchte ich die Erkenntnisse zum Power Nap verknüpfen mit der besonderen Situation im Klinikbetrieb. In Krankenhäusern wird im Schicht- und Nachtdienst gearbeitet. Die Mitarbeiter sind dadurch besonderen Belastungen und Beanspruchungen ausgesetzt. Wenn in dem zitierten Artikel der HAZ von dem Risiko für Arbeitsunfälle und Fehler gesprochen wird, hat dies im Krankenhaus eine besondere Brisanz: ein Fehler eines Arztes oder eines Mitarbeiters des Pflegedienstes kann lebensbedrohende Auswirkungen auf die Patienten haben. Aus diesem Grund möchte ich in dieser Hausarbeit prüfen, ob und unter welchen Umständen der Power Nap sinnvoll in den Arbeitsalltag von Klinikpersonal einbezogen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Power-Nap: strategischer Kurzschlaf
- Gesellschaftliche und kulturelle Dimensionen
- Schlafforschung
- Besonderheiten des Klinikbetriebes
- Begriffsklärung
- Die betriebswirtschaftliche Perspektive
- Arbeitszeiten im Krankenhaus und Dienstplangestaltung
- Besondere Belastungen und Beanspruchungen der Beschäftigten
- Strategischer Kurzschlaf in der betrieblichen Praxis
- Praktischer Einsatz von strategischem Kurzschlaf im Klinikbetrieb: Empfehlungen
- Allgemeine Empfehlungen zur Gestaltung von Schicht- und Nachtarbeit
- Kernarbeitszeit als Lösung?
- Schlussbetrachtung/ Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Thematik des strategischen Kurzschlafs, auch bekannt als "Power Nap", und dessen potenziellen Einsatz im Arbeitsalltag, insbesondere im Klinikbetrieb. Die Arbeit beleuchtet die kulturellen und gesellschaftlichen Dimensionen des Mittagsschlafs, analysiert wissenschaftliche Erkenntnisse zur Schlafforschung, insbesondere zum Power Nap, und untersucht die besonderen Herausforderungen und Belastungen, denen Beschäftigte im Schicht- und Nachtdienst in Krankenhäusern ausgesetzt sind.
- Kulturelle und gesellschaftliche Perspektiven auf den Mittagsschlaf
- Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Schlafforschung, insbesondere zum Power Nap
- Spezielle Belastungen und Beanspruchungen von Klinikpersonal im Schicht- und Nachtdienst
- Potenziale und Herausforderungen des strategischen Kurzschlafs im Klinikbetrieb
- Empfehlungen für den Einsatz von Power Naps im Klinikalltag
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Power Nap ein und beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext von Arbeitsbelastungen und -unfällen.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Konzept des Power Naps, beleuchtet die gesellschaftliche und kulturelle Wahrnehmung des Mittagsschlafs in Deutschland und setzt diesen Kontext in Relation zu anderen Kulturen. Zudem werden wichtige Erkenntnisse aus der Schlafforschung, insbesondere zum Power Nap und seinen Vorteilen, vorgestellt.
Kapitel drei beschäftigt sich mit den Besonderheiten des Klinikbetriebs, definiert wichtige Begriffe und beleuchtet die betriebswirtschaftliche Perspektive auf das Krankenhauswesen. Es geht auch auf Arbeitszeiten, Dienstplangestaltung und die besonderen Belastungen und Beanspruchungen von Klinikpersonal ein.
Kapitel vier untersucht den Einsatz von strategischem Kurzschlaf in der betrieblichen Praxis, während Kapitel fünf sich mit praktischen Empfehlungen für den Einsatz des Power Naps im Klinikbetrieb auseinandersetzt. Es werden allgemeine Empfehlungen zur Gestaltung von Schicht- und Nachtarbeit sowie die Kernarbeitszeit als potenzielle Lösung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: Power Nap, strategischer Kurzschlaf, Schlafforschung, Arbeitsbelastung, Schichtarbeit, Nachtdienst, Klinikbetrieb, Gesundheitswesen, Arbeitsunfälle, Effizienzsteigerung, Leistungsfähigkeit, Entspannung, betriebswirtschaftliche Perspektive, Kernarbeitszeit, Empfehlungen für die Praxis.
- Citar trabajo
- Cathrin Hachmeister (Autor), 2005, Strategischer Kurzschlaf im Arbeitsalltag. Einsatz im Klinikbetrieb bei psychischer und physischer Belastung im Schicht- und Nachtdienst, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42570