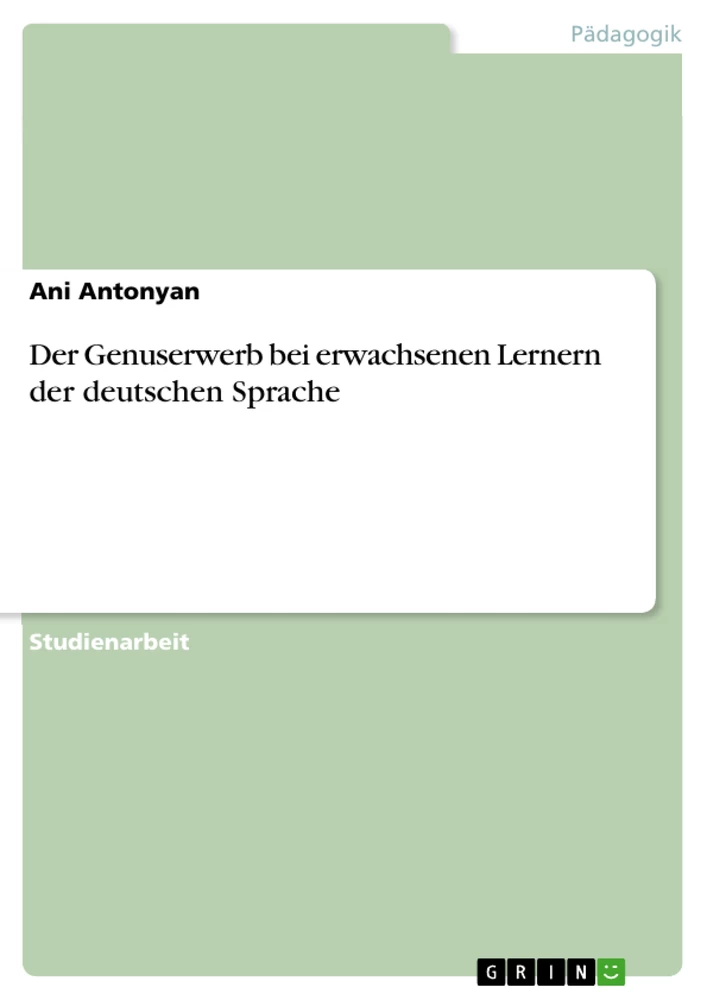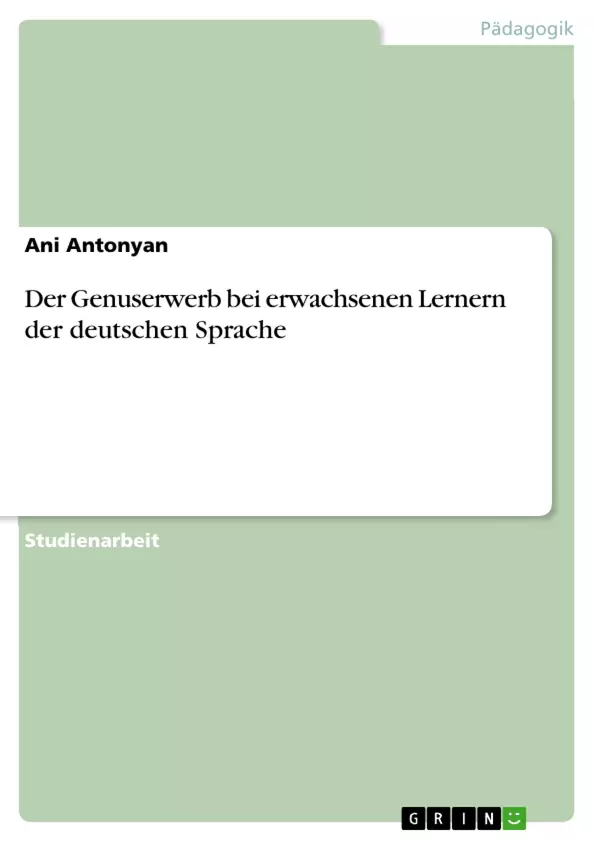Kinder erwerben ihre Muttersprache schnell und reibungslos. Genauso einwandfrei verläuft der doppelte Erstspracherwerb. Wann und wie schnell ein Kind sprechen lernt, kann individuell unterschiedlich sein. Dies hat jedoch keinen Einfluss darauf, wie die Sprache zu den späteren Zeitpunkten bei ihm aussieht. Anders ist es bei den Erwachsenen, denn je weiter das Alter vom Erwerbsbeginn entfernt ist, desto mangelhafter ist die Sprache zu bezeichnen und desto mehr Hindernisse beim Erwerb kommen vor.
So beschäftigt sich diese Arbeit mit der Frage des Erwerbs und der Beherrschung grammatischen Aspekts Genus im Deutschen und betrachtet genustragende Lexeme als isolierte, abgetrennte Einheiten. Sie bewegt sich dabei im Bereich des späten Spracherwerbs des Deutschen und beruht auf einer kleinen empirischen Studie. Das Ziel der Arbeit ist es, aufgrund der Ergebnisse und der Verlaufsbesonderheiten dieser Studie didaktische Überlegungen zu machen und entsprechende Schlüsse zu ziehen. Die Umfrage, die erst im dritten Abschnitt dieser Arbeit dargestellt wird, bedarf zunächst einer theoretischen Abhandlung. Dieser Abhandlung wird das zweite Kapitel gewidmet. So wird hier nach einer einleitenden kurzen Beschreibung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden Sprachfähigkeitsveränderungen eingegangen.
Es werden dabei neurobiologische, sozial-psychologische, antriebs- und inputbasierte Erklärungsansätze über den Zusammenhang zwischen Alter beim Spracherwerbsbeginn und Endzustand dargestellt, die ihrerseits als Anreiz für folgende Fragestellungen gedient haben: Inwieweit korreliert das Alter beim Beginn des Spracherwerbs mit dem Endzustand der Sprachbeherrschung hinsichtlich der richtigen Genuszuweisung und welche Besonderheiten hat der Genuserwerb bei den Erwachsenen? Und ob, und wenn ja welche Regularitäten der Genuszuweisung werden bei Erwachsenen im Rahmen des L2-Erwerbs benutzt und dominiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Theoretische Grundlagen
- 1.1 Alter und Spracherwerb
- 1.2 Alter beim Erwerbsbeginn und erreichter Endzustand
- 2 Der Lerngegenstand: das Genus im Deutschen
- 2.1 Semantische Motivation der Genuszuordnung
- 2.2 Formale Regeln
- 2.2.1 Regeln nach Derivationssuffixen
- 2.2.2 Regeln nach Pseudosuffixen
- 2.2.3 Die einsilbigen Substantive
- 3 Empirische Untersuchung
- 3.1 Die Untersuchungsteilnehmer
- 3.2 Die Untersuchungswörter
- 3.3 Untersuchungsverlauf und Ergebnisse
- Bewertung der Ergebnisse und Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Erwerb und der Beherrschung des grammatischen Aspekts Genus im Deutschen und betrachtet genustragende Lexeme als isolierte Einheiten. Sie liegt im Bereich des späten Spracherwerbs des Deutschen und basiert auf einer kleinen empirischen Studie. Das Ziel der Arbeit ist es, aufgrund der Ergebnisse und Besonderheiten der Studie didaktische Überlegungen anzustellen und entsprechende Schlüsse zu ziehen. Die Arbeit stellt zunächst eine theoretische Abhandlung dar, die sich mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Erst- und Zweitspracherwerb sowie der Altersabhängigkeit von Sprachfähigkeitsveränderungen befasst.
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Alter beim Spracherwerbsbeginn und dem Endzustand der Sprachbeherrschung, insbesondere hinsichtlich der Genuszuweisung.
- Analyse der Besonderheiten des Genuserwerbs bei Erwachsenen.
- Identifizierung von Regularitäten der Genuszuweisung, die von Erwachsenen im Rahmen des L2-Erwerbs genutzt und dominiert werden.
- Darstellung semantischer und formaler Genusregularitäten des Deutschen, die die Substantive in drei Genusklassen einteilen.
- Entwicklung von didaktischen Überlegungen und Schlussfolgerungen auf Grundlage der empirischen Ergebnisse.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Fokus der Arbeit auf den Erwerb des grammatischen Aspekts Genus im Deutschen dar und erläutert den Hintergrund der empirischen Studie. Kapitel 1 behandelt die theoretischen Grundlagen, beginnend mit einer allgemeinen Diskussion über Alter und Spracherwerb. Es werden die Unterschiede zwischen Erst- und Zweitspracherwerb sowie die Bedeutung des Alters beim Spracherwerbsbeginn für den Endzustand der Sprachbeherrschung hervorgehoben. Kapitel 2 konzentriert sich auf den Lerngegenstand Genus im Deutschen und präsentiert semantische und formale Regeln der Genuszuweisung. Es werden auch die Kunstwörter vorgestellt, die als Grundlage für die empirische Studie dienen. Kapitel 3 beschreibt die empirische Untersuchung, inklusive der Untersuchungsteilnehmer, der Untersuchungswörter und des Untersuchungsverlaufs mit seinen Ergebnissen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen des Zweitspracherwerbs, des Genuserwerbs, des Alters beim Spracherwerbsbeginn, der Genusregularitäten im Deutschen, der empirischen Untersuchung und der didaktischen Überlegungen. Besondere Bedeutung haben dabei die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Alter beim Spracherwerbsbeginn und dem Endzustand der Sprachbeherrschung, die Analyse von Regularitäten im Genusgebrauch bei Erwachsenen und die Entwicklung von didaktischen Empfehlungen für den Sprachunterricht.
Häufig gestellte Fragen zum Genuserwerb bei Erwachsenen
Warum haben Erwachsene größere Schwierigkeiten beim Genuserwerb im Deutschen?
Je höher das Alter beim Erwerbsbeginn, desto schwieriger wird die fehlerfreie Beherrschung grammatischer Strukturen wie dem Genus (Altersabhängigkeit).
Gibt es Regeln für die Zuweisung des Genus im Deutschen?
Ja, es gibt semantische Regeln (Bedeutung) und formale Regeln (z. B. Derivationssuffixe wie -heit, -ung oder -keit).
Was wurde in der empirischen Studie dieser Arbeit untersucht?
Die Studie untersuchte, inwieweit das Alter beim Spracherwerbsbeginn mit der korrekten Genuszuweisung bei L2-Lernern korreliert.
Was sind "Pseudosuffixe" im Zusammenhang mit dem Genus?
Pseudosuffixe sind Endungen, die wie Suffixe aussehen und oft fälschlicherweise zur Genusbestimmung herangezogen werden.
Welche didaktischen Schlüsse zieht die Arbeit?
Die Ergebnisse dienen dazu, gezielte Lehrmethoden zu entwickeln, die Erwachsenen helfen, Regularitäten der Genuszuweisung besser zu verinnerlichen.
- Arbeit zitieren
- Ani Antonyan (Autor:in), 2016, Der Genuserwerb bei erwachsenen Lernern der deutschen Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/425806