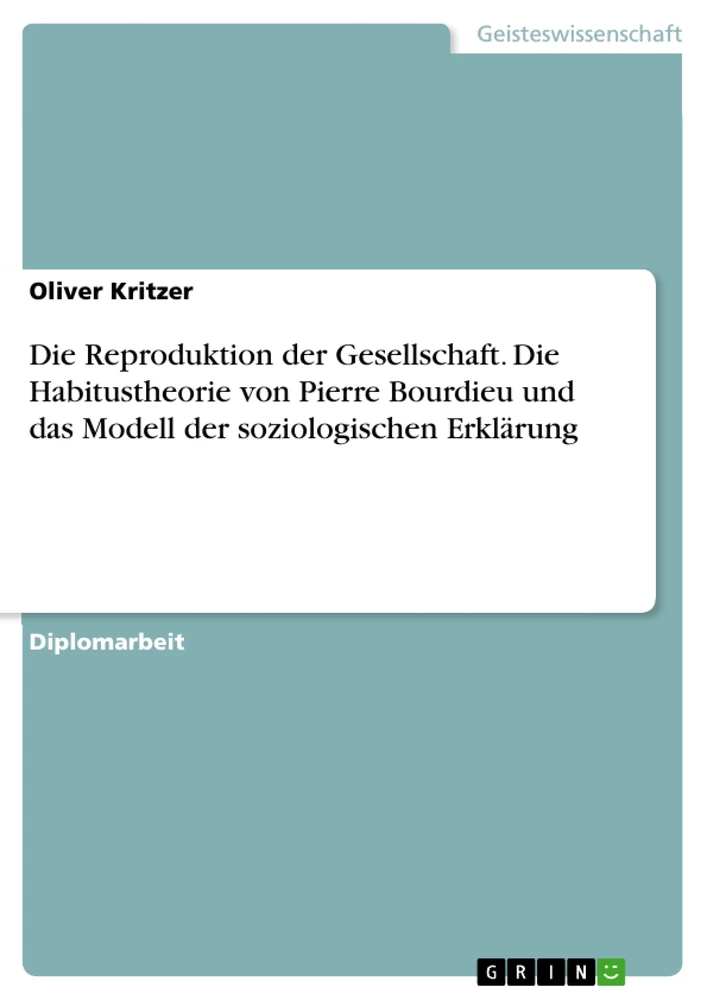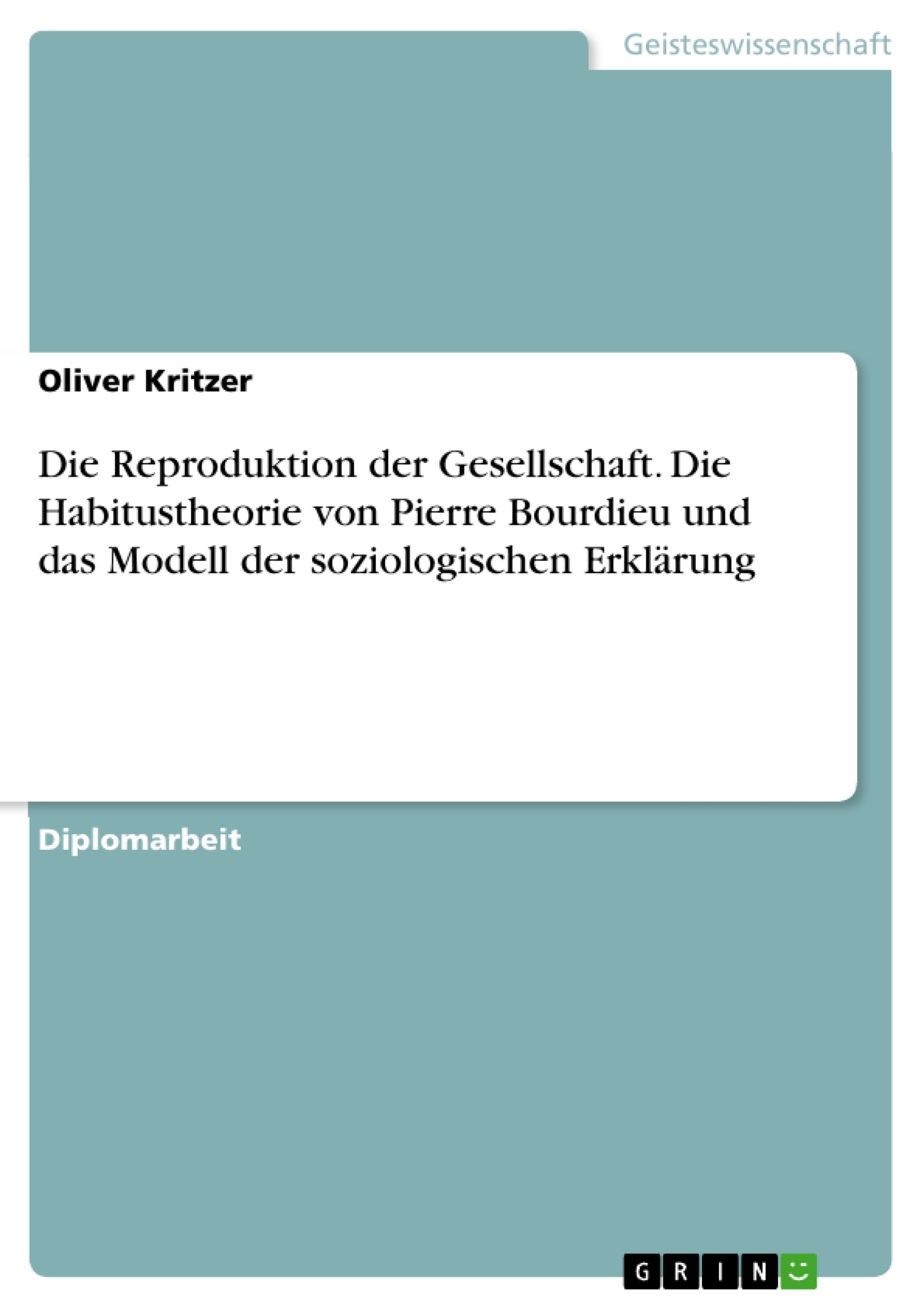Der französische Sozialwissenschaftler Pierre Bourdieu wäre am 1. August 73 Jahre alt geworden. Er wurde 1930 in einem kleinen Ort der französischen Pyrenäen geboren und durchlief alsbald die komplette wissenschaftliche Karrierehierarchie Frankreichs, wo er sich auch aufgrund der Aufnahme in das „Collège de France“ 1982 schließlich zur Akademikerelite zählen durfte. Im französischen Ausland wurde er hauptsächlich durch sein materialreiches Werk „Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft“ bekannt, in welchem er Forschungen über die Interdependenz zwischen sozialstruktureller Positionierung, der Ausprägung klassenspezifischer Geschmacksdispositionen und der sich darauf gründenden symbolischen Lebensführungsstile, bezogen auf die französische Gesellschaft der 60er und 70er Jahre, betrieb.
In den letzten Jahren seiner Arbeit wollte er sein Schaffen vor allem als Anthropologie verstanden wissen: Als umfassende Analytik des vergesellschafteten Menschen. Dabei nahm er eine Position ein, mit welcher er den Gesellschaftsmitgliedern eine soziale Praxis zuordnete, die durch systemische Befangenheit ausgezeichnet war. Er stellte bei diesen den „Sinn für das Spiel“ fest, der jegliche Handlung bestimmt und ihnen damit die Möglichkeit einer permanenten Selbstreflexion nimmt.
In seiner Antrittsvorlesung am „Collège de France“ referierte er in der „leçon sur la leçon“ über die Herrschaftsmechanismen von Vorlesungen, um damit der Akademikerwelt, der er ja selbst angehörte, die Neutralität zu nehmen. Die Erkenntnis und die Offenbarung dieser Wirkungen betrachtete er als Freiheitserhalt aufgrund der Reflexion des Selbst und der Dinge. Nur diese Reflexion, die er dem sozialisierten Akteur weitgehend abstreitet, ermöglicht es, die Herrschaftsmechanismen zu erkennen und zu überwinden, um nicht an der Reproduktion der Herrschaft beteiligt zu sein.
Mit dieser kritischen Haltung vor allem gegenüber dem Neoliberalismus hatte er das von ihm selbst gepflegte Ideal weltanschaulicher Neutralität abgelegt und so auch natürlich kritische Gegenreaktionen auf sich gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Vorgehensweise
- 2. Bourdieus Habitustheorie
- 2.1 Die Soziologie Pierre Bourdieus
- 2.2 Der Habitus
- 2.3 Kapitalformen
- 2.3.1 Ökonomisches Kapital
- 2.3.2 Kulturelles Kapital
- 2.3.2.1 Inkorporiertes kulturelles Kapital
- 2.3.2.2 Objektiviertes kulturelles Kapital
- 2.3.2.3 Institutionalisiertes kulturelles Kapital
- 2.3.3 Soziales Kapital
- 2.3.4 Symbolisches Kapital
- 2.3.5 Kapitalumwandlungen
- 2.4 Das soziale Feld
- 2.5 Klasse und sozialer Raum
- 2.5.1 Der soziale Raum
- 2.5.2 Die Klasse
- 2.5.3 Klasse und Habitus
- 2.6 Funktionen und Bedeutung des Habitus
- 2.7 Die Reproduktion sozialer Ungleichheit
- 2.7.1 Die Lebensstiltheorie
- 2.7.2 Die Reproduktion sozialer Strukturen
- 3. Die soziologische Erklärung und die Habitustheorie
- 3.1 Das Modell der soziologischen Erklärung
- 3.1.1 Das Konzept soziologischer Erklärungen
- 3.1.2 Das Grundmodell soziologischer Erklärungen
- 3.2 Die Erklärung in der Habitustheorie
- 3.2.1 Die Einverleibung der Gegebenheiten
- 3.2.2 Der Habitus
- 3.2.3 Die Generierung von Praxisformen
- 3.2.4 Die Reproduktion
- 3.3 Eine kritische Betrachtung der Habitustheorie
- 3.3.1 Allgemeine Modellbetrachtung
- 3.3.1.1 Klassen und Lebensstile
- 3.3.1.2 Berücksichtigung der Zeit
- 3.3.2 Die Situation
- 3.3.2.1 Situation und Struktur
- 3.3.2.2 Feld und Raum
- 3.3.2.3 Feld und Kampf
- 3.3.2.4 Kapital
- 3.3.2.5 Das inkorporierte kulturelle Kapital
- 3.3.2.6 Klasse
- 3.3.3 Die Logik der Situation
- 3.3.3.1 Habitus und Framing
- 3.3.3.2 Strategie und Habitus
- 3.3.3.3 Familiale Sozialisation
- 3.3.4 Der Habitus
- 3.3.4.1 Reduktion des Akteurs?
- 3.3.4.2 Bounded Rationality
- 3.3.4.3 Informationsverarbeitung und Geschmack
- 3.3.5 Die Logik der Selektion
- 3.3.5.1 Habitus und Rational-Choice
- 3.3.5.2 Subjektive Logik?
- 3.3.6 Die soziale Praxis
- 3.3.6.1 Ambivalenz in Distinktion und Lebensstil
- 3.3.6.2 Prozesshaftigkeit der Praxis
- 3.3.6.3 Die Homologie der Räume
- 3.3.7 Die Logik der Aggregation
- 3.3.8 Resümee
- 4. Implikationen
- 4.1 Verbesserungsvorschläge
- 4.2 Die Erklärung einer Reproduktion
- 4.2.1 Das kollektive Explanandum
- 4.2.2 Die Logik der Situation
- 4.2.3 Die Logik der Selektion
- 4.2.4 Die Logik der Aggregation
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Pierre Bourdieus Habitustheorie und ihr Modell der soziologischen Erklärung im Kontext der Reproduktion sozialer Ungleichheit. Ziel ist es, die Theorie zu analysieren und kritisch zu betrachten, ihre Stärken und Schwächen aufzuzeigen und ihre Anwendbarkeit auf die Erklärung sozialer Reproduktionsprozesse zu evaluieren.
- Bourdieus Habituskonzept und seine verschiedenen Kapitalformen
- Das Modell der soziologischen Erklärung nach Bourdieu
- Die Rolle des Habitus in der Reproduktion sozialer Ungleichheit
- Kritische Auseinandersetzung mit der Habitustheorie
- Implikationen der Theorie für das Verständnis sozialer Prozesse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein, indem es die Fragestellung und die Vorgehensweise der Untersuchung beschreibt. Es bietet einen kurzen Überblick über das Werk Pierre Bourdieus und seine Relevanz für das Verständnis sozialer Reproduktionsprozesse. Die Einleitung legt den Fokus auf Bourdieus Anliegen, die Mechanismen sozialer Herrschaft und Reproduktion aufzudecken und kritisch zu hinterfragen.
2. Bourdieus Habitustheorie: Dieses Kapitel stellt Bourdieus Habitustheorie im Detail vor. Es erklärt die zentralen Konzepte wie Habitus, verschiedene Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales, symbolisches Kapital) und das soziale Feld. Der Fokus liegt auf der Entstehung und Funktion des Habitus als verinnerlichtes System von Dispositionen, das das Handeln von Individuen prägt. Es wird ausführlich erläutert, wie die verschiedenen Kapitalformen ineinander greifen und die soziale Positionierung von Individuen und Gruppen beeinflussen. Der Abschnitt zur Reproduktion sozialer Ungleichheit beschreibt, wie der Habitus zur Perpetuierung bestehender Machtstrukturen beiträgt. Die Verbindung zwischen Habitus, Kapital und sozialer Klasse bildet den Kern dieses Kapitels.
3. Die soziologische Erklärung und die Habitustheorie: Dieses Kapitel analysiert Bourdieus Modell der soziologischen Erklärung und seine Integration in die Habitustheorie. Es beschreibt, wie der Habitus als vermittelnde Instanz zwischen sozialen Strukturen und individuellem Handeln fungiert. Der Prozess der Generierung von Praxisformen wird detailliert erklärt, und die kritische Betrachtung der Theorie umfasst Punkte wie die Berücksichtigung von Zeit, die Rolle der Situation und die Grenzen des Habituskonzepts. Das Kapitel evaluiert die Erklärungsleistung der Theorie für die Reproduktion sozialer Strukturen und diskutiert kritische Einwände.
4. Implikationen: Dieses Kapitel zieht Schlussfolgerungen aus der vorherigen Analyse. Es präsentiert Verbesserungsvorschläge für die Habitustheorie und diskutiert die Anwendung der Theorie auf die Erklärung von Reproduktionsprozessen. Es beschreibt wie die Logik der Situation, Selektion und Aggregation bei der Erklärung von kollektiven Phänomenen eine Rolle spielen.
Schlüsselwörter
Pierre Bourdieu, Habitustheorie, Kapitalformen, soziales Feld, Reproduktion sozialer Ungleichheit, soziologische Erklärung, Klasse, Habitus, Lebensstile, soziale Praxis, kritische Theorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Bourdieus Habitustheorie und die Reproduktion sozialer Ungleichheit"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Pierre Bourdieus Habitustheorie und ihr Modell der soziologischen Erklärung im Kontext der Reproduktion sozialer Ungleichheit. Ziel ist die kritische Betrachtung der Theorie, die Aufzeigung ihrer Stärken und Schwächen sowie die Evaluierung ihrer Anwendbarkeit auf die Erklärung sozialer Reproduktionsprozesse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Bourdieus Habituskonzept und seine verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales, symbolisches Kapital), Bourdieus Modell der soziologischen Erklärung, die Rolle des Habitus in der Reproduktion sozialer Ungleichheit, eine kritische Auseinandersetzung mit der Habitustheorie und die Implikationen der Theorie für das Verständnis sozialer Prozesse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einführung und beschreibt die Fragestellung und Vorgehensweise. Kapitel 2 stellt Bourdieus Habitustheorie detailliert vor, einschließlich der Konzepte Habitus, Kapitalformen und soziales Feld. Kapitel 3 analysiert Bourdieus Modell der soziologischen Erklärung und seine Integration in die Habitustheorie, inklusive einer kritischen Betrachtung. Kapitel 4 zieht Schlussfolgerungen und präsentiert Verbesserungsvorschläge. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die zentralen Konzepte der Habitustheorie nach Bourdieu?
Zentrale Konzepte sind der Habitus als verinnerlichtes System von Dispositionen, die verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales, symbolisches Kapital) und das soziale Feld als Raum sozialer Interaktion und Konkurrenz. Der Habitus prägt das Handeln von Individuen und trägt zur Reproduktion sozialer Ungleichheit bei, da er durch die verschiedenen Kapitalformen beeinflusst und geprägt wird.
Wie erklärt Bourdieu die Reproduktion sozialer Ungleichheit?
Bourdieu erklärt die Reproduktion sozialer Ungleichheit durch das Zusammenspiel von Habitus und Kapital. Der Habitus, erworben durch die Sozialisation, steuert das Handeln von Individuen und begünstigt die Reproduktion der sozialen Positionen. Die verschiedenen Kapitalformen (ökonomisches, kulturelles, soziales, symbolisches) sind dabei ungleich verteilt und sichern den Fortbestand sozialer Ungleichheiten.
Welche Kritikpunkte an Bourdieus Habitustheorie werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Kritikpunkte wie die Berücksichtigung der Zeit, die Rolle der Situation, die Grenzen des Habituskonzepts, die Vereinfachung des Handelns durch den Habitus und die Frage nach der Subjektivität des Handelns. Es wird hinterfragt, ob der Habitus alle Aspekte des individuellen Handelns vollständig erklären kann.
Welche Implikationen ergeben sich aus der Analyse?
Die Arbeit liefert Verbesserungsvorschläge für die Habitustheorie und diskutiert deren Anwendung auf die Erklärung von Reproduktionsprozessen. Die Logik der Situation, Selektion und Aggregation spielt dabei eine wichtige Rolle bei der Erklärung kollektiver Phänomene. Die Arbeit zeigt auf, wie die Theorie weiterentwickelt werden kann, um ein umfassenderes Verständnis sozialer Prozesse zu ermöglichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pierre Bourdieu, Habitustheorie, Kapitalformen, soziales Feld, Reproduktion sozialer Ungleichheit, soziologische Erklärung, Klasse, Habitus, Lebensstile, soziale Praxis, kritische Theorie.
- Citar trabajo
- Oliver Kritzer (Autor), 2003, Die Reproduktion der Gesellschaft. Die Habitustheorie von Pierre Bourdieu und das Modell der soziologischen Erklärung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42588