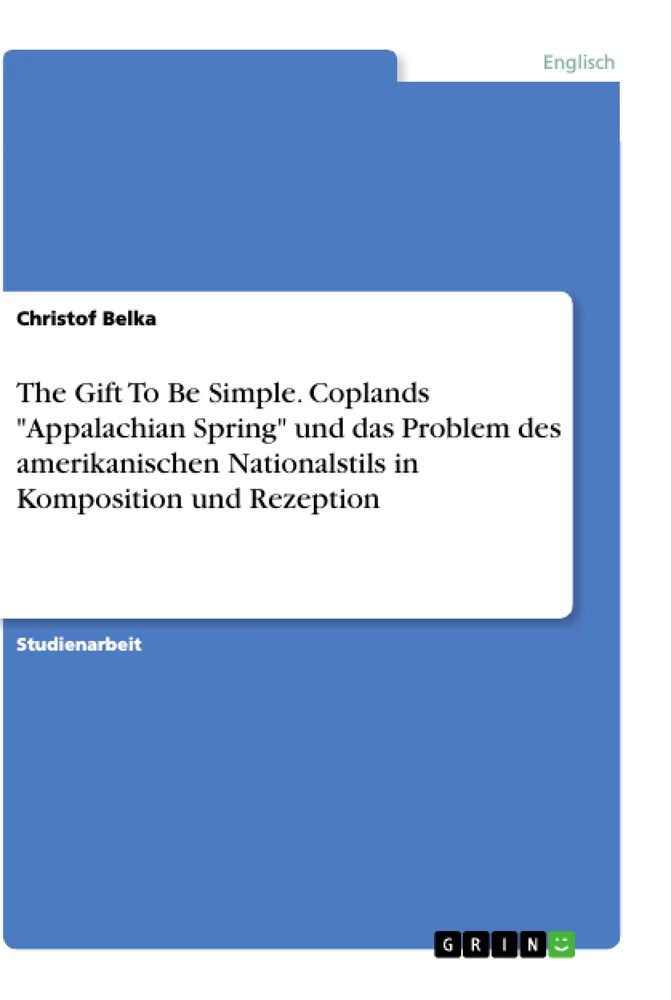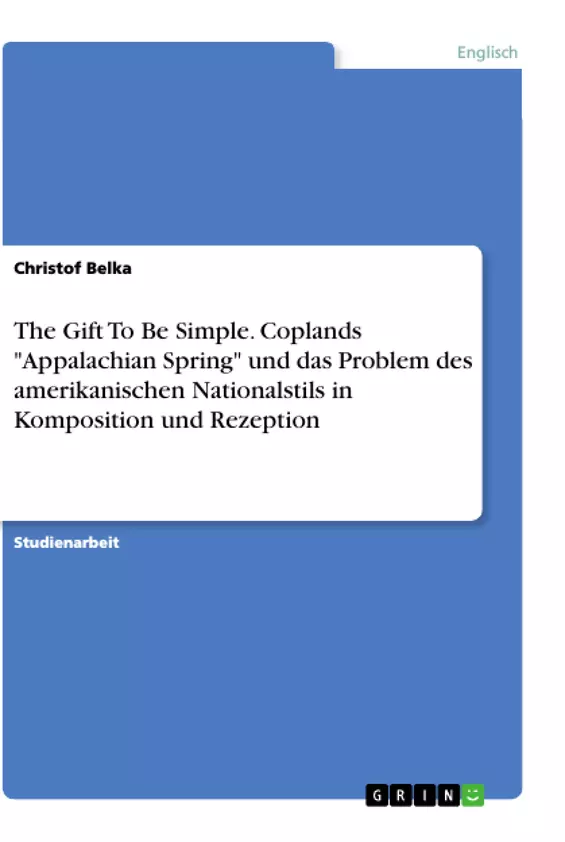In wenigen anderen Bereichen der heutigen Alltagskultur ist der Einfluss der USamerikanischen ”Exportprodukte“ auf Europa – insbesondere freilich auf Deutschland – so augenfällig wie in der Musik: Ein Blick in beliebige Charts (ist nicht bereits dieser Anglizismus ein dezenter Hinweis auf die angloamerikanische Prägung des Ressorts?) macht schnell deutlich, dass diese von Künstlerinnen und Künstlern aus den USA dominiert werden. Ebenso auffällig ist, dass die Einflüsse praktisch ausschließlich auf alle Stile populärer Musik wie Rock, Pop, Hip Hop usw. (häufig unter den unglücklichmissverständlichen Terminus ”U-Musik“ subsumiert) ausgeübt werden, nicht jedoch auf das, was in der Umgangssprache landläufig als ”klassische Musik“ bezeichnet wird. Mit anderen Worten: Der Einfluss der amerikanischen Musik auf Europa erstreckt sich nur bis vor die Türen der Kammer- und Orchesterkonzertsäle, nicht jedoch in sie hinein. Amerikanische Komponisten sind mit wenigen Ausnahmen Exoten im hiesigen Konzertleben. Gibt es denn überhaupt so etwas wie einen amerikanischen ”Nationalstil“? Wenn ja, wollen wir hier den Versuch einer Definition wagen.
Zur induktiven Näherung betrachten wir exemplarisch ein Werk, das oft als amerikanische Musik schlechthin rezipiert wird: die Appalachian Spring Suite von Aaron Copland (1900-1990). Was waren die sozial- und kulturgeschichtlichen Hintergründe ihrer Entstehung und wie wurde das vom Komponisten angestrebte Ideal eines originär amerikanischen Stils umgesetzt? Schließlich werden wir der Rezeption des Werkes in seiner Auührungs- und Publikationsgeschichte nachgehen, mit besonderem Akzent auf medienrelevanten Aspekten, und dabei prüfen, inwieweit nicht nur die Musikrezensenten, sondern auch Film- und Fernsehregisseure, die Tonträgerindustrie und deren Designer die Botschaft des musikalischen Amerikanismus erkannt und weitertransportiert haben.
Inhaltsverzeichnis
- Amerikanischer Nationalstil
- Komponist und Werk im epochalen Kontext
- Biografie und Schaffensperioden
- Postkoloniale Selbstzweifel der amerikanischen Kultur
- Positionierung Coplands im werdenden künstlerischen Selbstbewusstsein Amerikas
- Appalachian Spring in Komposition und Rezeption
- Aspekte der Komposition
- Hintergründe der Entstehung
- Inhalt und Verlaufsanalyse des Werks
- Motiv- und Themenbildung in verschiedenen Topoi
- Aspekte der Rezeption
- Verwendung als Film- und TV-Musik
- Besonderheiten der Diskografie
- Was ist amerikanisch?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, das Werk „Appalachian Spring“ von Aaron Copland im Kontext des Strebens nach einem amerikanischen Nationalstil zu untersuchen. Dabei werden die biographischen Hintergründe und Einflüsse auf Coplands Kompositionsweise sowie die Entstehung und Rezeption des Werks beleuchtet.
- Die Suche nach einem spezifisch amerikanischen Nationalstil in der Musik
- Die Rolle der amerikanischen Kultur und des „American Sound“ in Coplands Werk
- Die Bedeutung der Jazzmusik und ihrer Integration in klassische Kompositionen
- Die Rezeption von „Appalachian Spring“ im Kontext des amerikanischen und europäischen Musikverständnisses
- Die mediale Rezeption des Werks durch Film, Fernsehen und Tonträgerindustrie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem komplexen Konzept des amerikanischen Nationalstils in der Musik, wobei die Dominanz amerikanischer Musik in der Popkultur im Gegensatz zur geringen Präsenz klassischer amerikanischer Kompositionen in Europa aufgezeigt wird. Das zweite Kapitel widmet sich der Biografie und dem Werdegang Aaron Coplands, beleuchtet seine frühen Einflüsse und die Herausforderungen, die sich aus der Suche nach einer eigenen „amerikanischen“ Musiksprache ergaben. Hier wird auch die postkoloniale Situation der amerikanischen Gesellschaft thematisiert und ihre Auswirkungen auf die Suche nach einer nationalen Identität in der Kunst diskutiert.
Im dritten Kapitel wird die Komposition „Appalachian Spring“ detailliert analysiert. Es werden die Hintergründe der Entstehung, der Inhalt und die musikalische Struktur des Werks sowie die Verwendung verschiedener musikalischer Motive und Themen in verschiedenen Abschnitten der Komposition untersucht. Der vierte Kapitelteil widmet sich der Rezeption von „Appalachian Spring“, wobei die Verwendung des Werks in Film und Fernsehen sowie die Besonderheiten der Diskografie beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Amerikanischer Nationalstil, Aaron Copland, Appalachian Spring, Jazz, postkoloniale Selbstzweifel, amerikanische Musikgeschichte, nationale Identität, Film- und Fernsehmusik, Diskografie.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Aaron Copland?
Aaron Copland (1900–1990) war ein bedeutender US-amerikanischer Komponist, der maßgeblich zur Entwicklung eines eigenständigen amerikanischen Nationalstils in der klassischen Musik beitrug.
Was ist das Besondere an „Appalachian Spring“?
Das Werk gilt als Inbegriff des „American Sound“. Es integriert Volksweisen (wie den Shaker-Song „Simple Gifts“) und fängt die Weite und den Geist der amerikanischen Landschaft ein.
Gibt es einen spezifisch amerikanischen Nationalstil in der Musik?
Ja, Copland suchte nach einer Musiksprache, die sich von europäischen Vorbildern löst und Elemente wie Jazz-Rhythmen, Folklore und eine offene Harmonik verbindet.
Wie wird Coplands Musik in Film und Fernsehen genutzt?
Seine Werke, besonders „Appalachian Spring“, werden oft verwendet, um ländliche Idylle, Pioniergeist oder patriotische Gefühle musikalisch zu untermalen.
Warum sind amerikanische Komponisten in europäischen Konzertsälen oft „Exoten“?
Während US-Popmusik weltweit dominiert, blieb die klassische Musikszene in Europa lange Zeit stark eurozentrisch geprägt, was den Zugang für amerikanische Nationalstile erschwerte.
- Quote paper
- Christof Belka (Author), 2001, The Gift To Be Simple. Coplands "Appalachian Spring" und das Problem des amerikanischen Nationalstils in Komposition und Rezeption, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42593