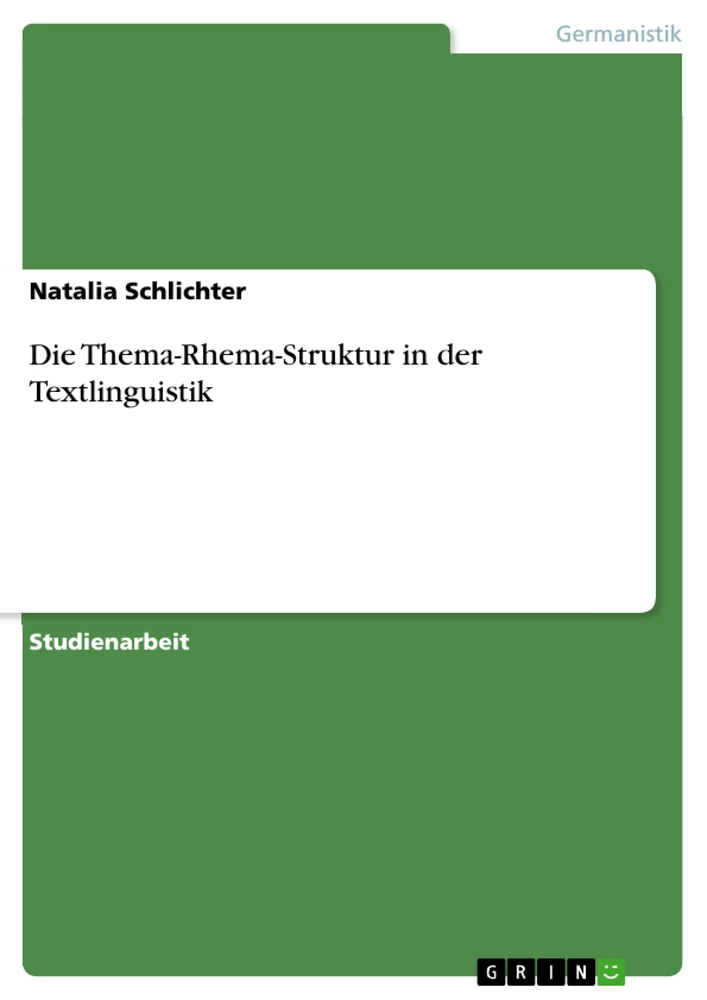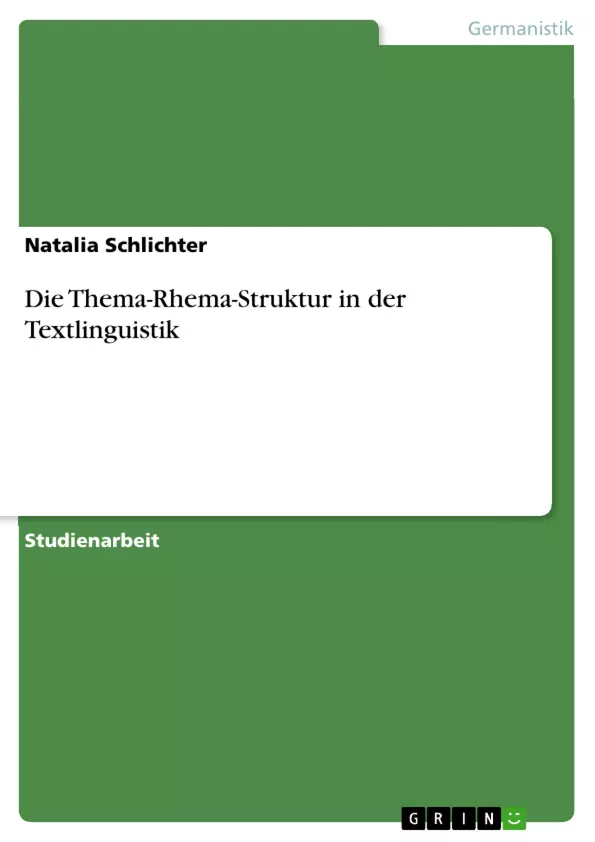1. Die Problematik der zentralen Begriffe in der Textlinguistik
Die Textlinguistik ist ein Forschungsbereich der Linguistik, der die Beschaffenheit von Texten in ihrer Abhängigkeit von der Darstellungs- oder Mitteilungsabsicht, der Thematik oder der Rolleneinstellung der Aktanten untersucht. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie es mit den Begriffen zu tun hat, die im Alltagsverständnis definiert werden können. Jedoch oder gerade deswegen ist es schwierig, alle Aspekte des zu untersuchenden Objektes zu berücksichtigen. Dieses Phänomen lässt sich z. B. an solch zentralen Begriffen wie ,,Text", ,,Satz" und anderen beobachten. Diese haben das Interesse vieler Wissenschaftler und denen bis jetzt keine eindeutige Definition beigefügt werden kann. Ähnliche Probleme kennt auch die Textforschung im Hinblick auf den Aufbau eines Textes, die Feststellung der Zusammenhängen zwischen dem Text und seinem Thema. Ihre Definition lässt sich auch durch mehrere sich von einander unterscheidende Ansätze charakterisieren. Es gibt in der Textlinguistik viele Methoden und Analysen, die sich mit gerade diesen zentralen Fragen der Wissenschaft beschäftigen: der Text und dessen Thema, die Beziehungen zwischen diesen beiden Begriffen, die Frage nach ihrem Verhältnis zueinander, wie verhält sich das Thema des Textes hinsichtlich des Textaufbaus und was ist dementsprechend unter dem Text und unter dem Textthema zu verstehen. Diese Fragen werden in Mittelpunkt dieser Arbeit gestellt. Es soll versucht werden, die hinsichtlich dieser Fragen in der Textlinguistik bekannt gewordenen Ansätze zu präsentieren: die Klassifizierung der thematischen Entfaltung, die Themenanalyse (von E. Agricola) und das Thema-Rhema-Konzept (von F. Danes).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Problematik der zentralen Begriffe in der Textlinguistik
- 2. Textthema
- 2.1 Alltägliche Definition des Begriffs „Thema“
- 2.2 Sprachwissenschaftliche Definitionen
- 3. Grundformen thematischer Entfaltung
- 3.1 Deskriptive Themenentfaltung
- 3.2 Narrative Themenentfaltung
- 3.3 Explikative Themenentfaltung
- 3.4 Argumentative Themenentfaltung
- 4. Das Modell der Themenanalyse von E. Agricola
- 4.1 Einige Ausführungen von E. Agricola als Anlass zur Erstellung der Analyse
- 4.1.1
- 4.1.2 Die sieben Schritte der Analyse
- 4.1.3 Der Wortlaut der Oberflächenstruktur
- 4.1.4 Die komplete Grundanalyse der Einzltexteme
- 4.1.5 Die Regularisierung der auktoriellen Textform
- 4.1.6 Die Ermittlung relevanter Folgen von rekurrenten semantischen Äquivalenzen
- 4.1.7 Die Feststellung der Querverbindungen zwischen den Isotopieketten
- 4.1.8 Die Zuordnung eines Hyperonyms
- 4.1.9 Die Erstellung des informativen Extraktes
- 4.1 Einige Ausführungen von E. Agricola als Anlass zur Erstellung der Analyse
- 5. Thema-Rhema Definitionen
- 5.1 Definition von H. Bußmann
- 5.2 Definition von Th. Lewandowski
- 5.3 Definition von W. Welte
- 6. Das Thema-Rhema-Konzept der Prager Schule
- 6.1 Grundprinzipien des Thema-Rhema-Konzeptes
- 6.2 Typen der thematischen Progression nach F. Danes
- 6.2.1 Die einfache lineare Progression
- 6.2.2 Der Typus mit einem durchlaufenden Thema
- 6.2.3 Die Progression mit abgeleiteten Themen
- 6.2.4 Die Progression mit einem gespalteten Thema
- 6.2.5 Die Progression mit einem thematischen Sprung
- 7. Mögliche Perspektiven in der Textforschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Thematik der Thema-Rhema-Struktur in der Textlinguistik. Ziel ist es, verschiedene Ansätze zur Definition und Analyse von Textthemen zu präsentieren und zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition zentraler Begriffe der Textlinguistik und untersucht verschiedene Modelle der Themenanalyse.
- Definition und Problematik zentraler Begriffe der Textlinguistik (Text, Thema, Satz)
- Verschiedene sprachwissenschaftliche Definitionen des Textthemas
- Grundformen der thematischen Entfaltung (deskriptiv, narrativ, explikativ, argumentativ)
- Das Modell der Themenanalyse nach E. Agricola
- Das Thema-Rhema-Konzept der Prager Schule
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Problematik der zentralen Begriffe in der Textlinguistik: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition zentraler Begriffe in der Textlinguistik, insbesondere "Text", "Satz" und "Thema". Es wird deutlich, dass die alltagssprachliche Verwendung dieser Begriffe oft von den wissenschaftlichen Definitionen abweicht und eine präzise Bestimmung für die Textanalyse unerlässlich ist. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit, verschiedene Ansätze zur Definition und Analyse von Textthemen zu untersuchen, um ein umfassenderes Verständnis zu erreichen. Die daraus resultierenden Herausforderungen bilden den Ausgangspunkt der weiteren Analyse.
2. Textthema: Kapitel 2 befasst sich mit der Definition des Begriffs "Thema". Es vergleicht die alltagssprachliche Vorstellung von einem Thema ("Worum geht es?") mit sprachwissenschaftlichen Definitionen. Es werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die das Thema als Makroproposition, begrifflichen Kern oder als eine mit dem Text untrennbar verbundene Komponente definieren. Der Fokus liegt auf der Unterschiedlichkeit und Komplexität der verschiedenen Definitionen und deren Implikationen für die Textanalyse.
3. Grundformen thematischer Entfaltung: Kapitel 3 beschreibt verschiedene Grundformen der thematischen Entfaltung in Texten. Es werden die deskriptive, narrative, explikative und argumentative Themenentfaltung erläutert. Der Fokus liegt darauf, dass ein Thema nicht nur auf eine einzige Weise textuell präsentiert werden kann, sondern verschiedene Formen der gedanklichen Ausführung und Entfaltung existieren. Diese unterschiedlichen Formen der Darstellung beeinflussen die Art und Weise, wie der Leser das Thema des Textes versteht und verarbeitet.
4. Das Modell der Themenanalyse von E. Agricola: Dieses Kapitel widmet sich der detaillierten Darstellung des Modells der Themenanalyse nach E. Agricola. Es beschreibt die sieben Schritte dieses Modells, die von der Analyse der Oberflächenstruktur bis zur Erstellung eines informativen Extraktes reichen. Der Leser erhält einen tiefen Einblick in den methodischen Ansatz und die einzelnen Arbeitsschritte der Agricola-Methode, sowie deren Bedeutung für die Ermittlung und Darstellung des zentralen Themas eines Textes. Die verschiedenen Stufen der Analyse werden einzeln erklärt und ihre Zusammenhänge zueinander dargestellt.
5. Thema-Rhema Definitionen: In Kapitel 5 werden verschiedene Definitionen der Begriffe Thema und Rhema präsentiert. Die Definitionen von H. Bußmann, Th. Lewandowski und W. Welte werden vorgestellt und miteinander verglichen. Der Fokus liegt dabei auf den Nuancen und Unterschieden in den Definitionen und deren Implikationen für die praktische Analyse von Texten. Die unterschiedlichen Perspektiven werden beleuchtet und kritisch bewertet.
6. Das Thema-Rhema-Konzept der Prager Schule: Dieses Kapitel behandelt das Thema-Rhema-Konzept der Prager Schule. Es erläutert die Grundprinzipien dieses Konzepts und die verschiedenen Typen thematischer Progression nach F. Danes, einschließlich einfacher linearer Progression, Progression mit durchlaufendem Thema, Progression mit abgeleiteten Themen, Progression mit gespaltenem Thema und Progression mit thematischem Sprung. Die Bedeutung dieser Progressionstypen für das Verständnis des Textzusammenhangs und der Informationsstruktur wird umfassend diskutiert.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Thema-Rhema-Struktur in der Textlinguistik
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Thematik der Thema-Rhema-Struktur in der Textlinguistik. Sie präsentiert und vergleicht verschiedene Ansätze zur Definition und Analyse von Textthemen und beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Definition zentraler Begriffe der Textlinguistik.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Definition und Problematik zentraler Begriffe der Textlinguistik (Text, Thema, Satz); verschiedene sprachwissenschaftliche Definitionen des Textthemas; Grundformen der thematischen Entfaltung (deskriptiv, narrativ, explikativ, argumentativ); das Modell der Themenanalyse nach E. Agricola; und das Thema-Rhema-Konzept der Prager Schule.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Kapitel 1 behandelt die Problematik zentraler Begriffe; Kapitel 2 definiert den Begriff „Textthema“; Kapitel 3 beschreibt Grundformen thematischer Entfaltung; Kapitel 4 erklärt das Modell der Themenanalyse nach Agricola; Kapitel 5 präsentiert verschiedene Thema-Rhema-Definitionen; Kapitel 6 behandelt das Thema-Rhema-Konzept der Prager Schule; und Kapitel 7 diskutiert mögliche Perspektiven in der Textforschung.
Wie definiert die Hausarbeit den Begriff „Thema“?
Die Hausarbeit vergleicht alltagssprachliche und sprachwissenschaftliche Definitionen von „Thema“. Sie betrachtet verschiedene Ansätze, die das Thema als Makroproposition, begrifflichen Kern oder untrennbare Komponente des Textes definieren und hebt die Komplexität und Unterschiedlichkeit dieser Definitionen hervor.
Welche Modelle der Themenanalyse werden vorgestellt?
Die Hausarbeit stellt das Modell der Themenanalyse nach E. Agricola mit seinen sieben Schritten (von der Oberflächenstruktur bis zum informativen Extrakt) detailliert vor und behandelt das Thema-Rhema-Konzept der Prager Schule inklusive der verschiedenen Typen thematischer Progression nach F. Danes (einfache lineare Progression, durchlaufendes Thema, abgeleitete Themen, gespaltenes Thema, thematischer Sprung).
Welche Schwierigkeiten bei der Definition zentraler Begriffe werden angesprochen?
Die Hausarbeit betont die Schwierigkeiten bei der präzisen Definition von „Text“, „Satz“ und „Thema“ und die Unterschiede zwischen alltagssprachlicher und wissenschaftlicher Verwendung dieser Begriffe. Diese Schwierigkeiten bilden den Ausgangspunkt für die weitere Analyse.
Was sind die Grundformen der thematischen Entfaltung?
Die Hausarbeit unterscheidet zwischen deskriptiver, narrativer, explikativer und argumentativer Themenentfaltung und betont, dass ein Thema auf verschiedene Weisen textuell präsentiert werden kann, was das Verständnis des Lesers beeinflusst.
Wer sind die wichtigsten Autoren, die in der Hausarbeit zitiert werden?
Die Hausarbeit bezieht sich auf die Arbeiten von E. Agricola, H. Bußmann, Th. Lewandowski, W. Welte und F. Danes.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Hausarbeit?
Die Hausarbeit fasst verschiedene Ansätze zur Definition und Analyse von Textthemen zusammen und vergleicht diese. Kapitel 7 skizziert mögliche Perspektiven für zukünftige Forschung in der Textlinguistik.
- Citation du texte
- Natalia Schlichter (Auteur), 2001, Die Thema-Rhema-Struktur in der Textlinguistik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426