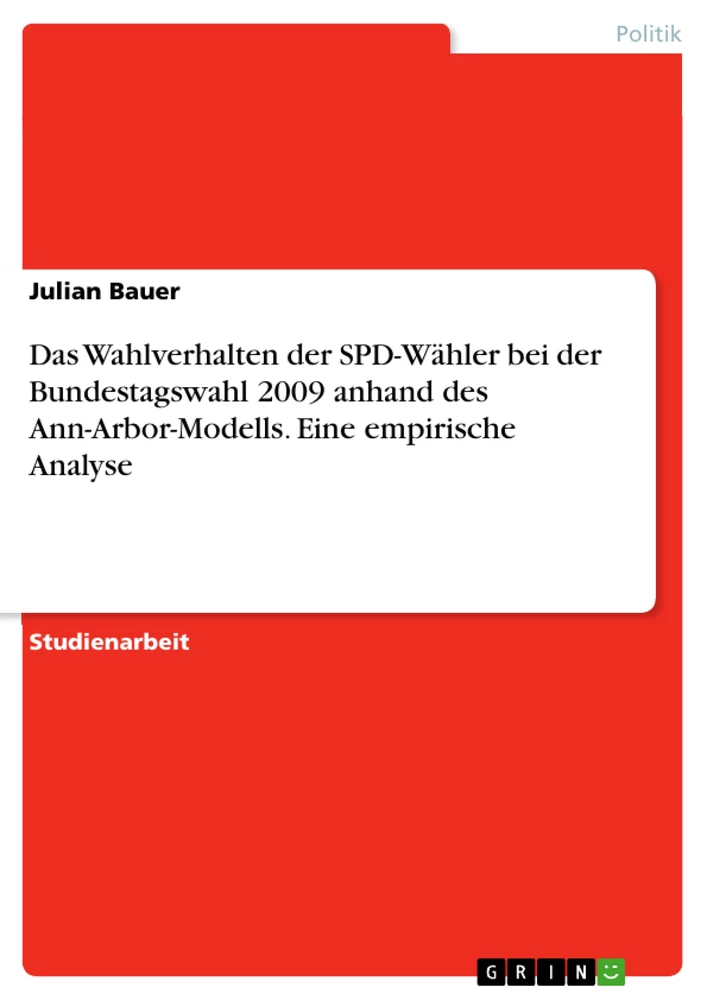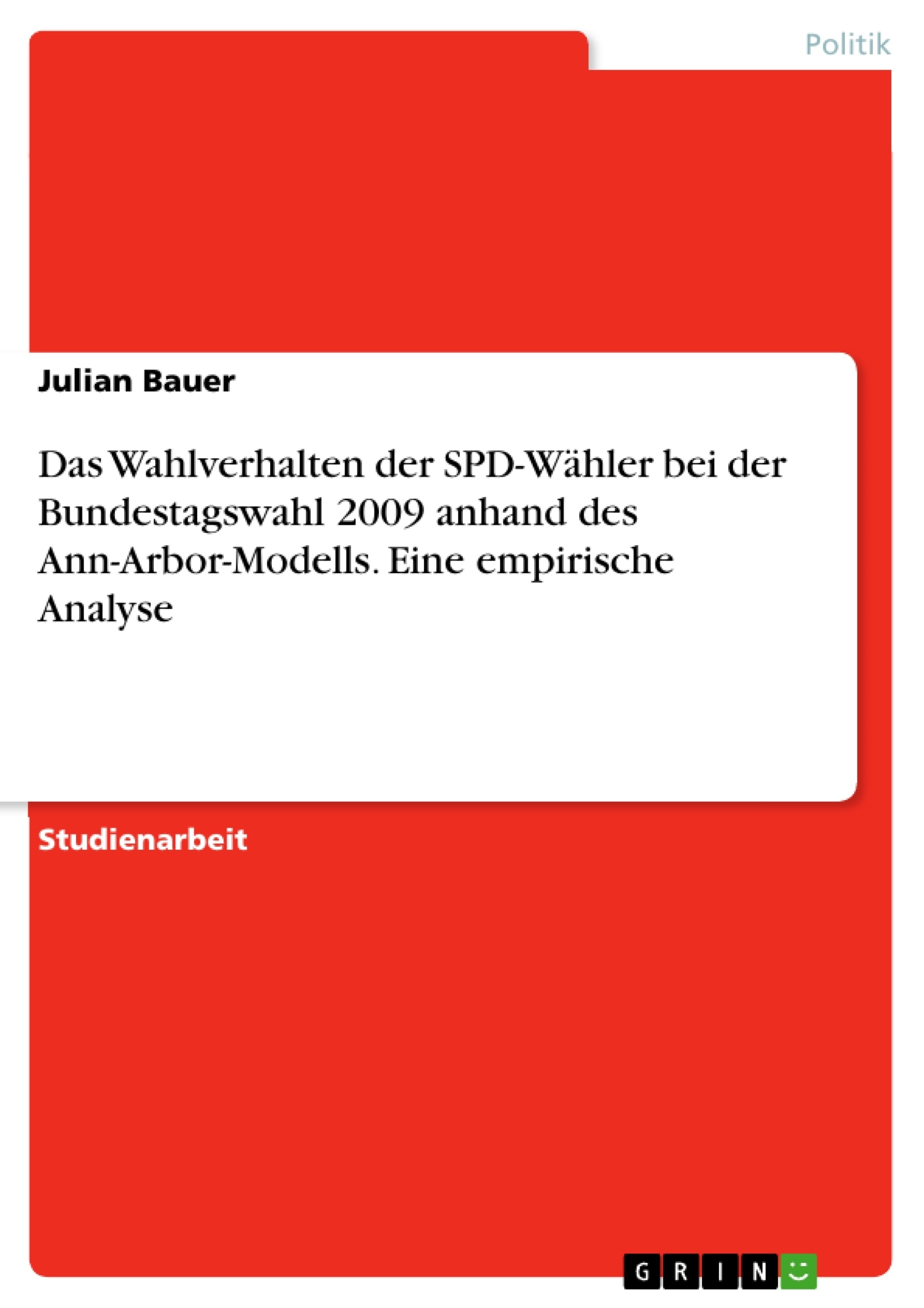Kanzlerbonus, Eurokrise oder doch der Atomausstieg? Gerade mit Blick auf die kommende Bundestagwahl 2013 stellt sich immer wieder die Frage, wovon Wähler ihre Entscheidung abhängig machen, wem sie ihre Stimme bei Wahlen geben. Die Wahlforschung als einer der bedeutendsten Zweige der Politikwissenschaft hat sich als Ziel gesetzt, Wahlverhalten zu untersuchen und zu erklären. Sie befragt, analysiert, prognostiziert und ist immer auf der Suche nach der Antwort auf die Frage: "Wer wählt wen warum?"
Das in der 60er Jahren an der University of Michigan entwickelte Ann-Arbor-Modell erhebt den Anspruch, das Wahlverhalten der Bürger durch deren Identifikation mit einer Partei, ihre Bewertung der Kandidaten und ihre persönliche Position zu politischen Sachfragen erklären zu können. Die anhaltende Dominanz des Modells in der Wahlforschung scheint dem Ansatz Recht zu geben. Doch ist das Modell auch noch heute, rund 50 Jahre später- trotz Dealignment und Politikverdrossenheit - überhaupt noch anwendbar? Um zu überprüfen, ob sich die Theorie auch noch zur heutigen Zeit in die Praxis umsetzen lässt, soll dies anhand einer Anwendung des Modells auf die Bundestagswahl 2009 empirisch analysiert werden. Bei dieser Wahl erzielte die SPD mit 23% das schlechteste Ergebnis in der Parteigeschichte und verlor im Vergleich zur Bundestagswahl 2005 11 Prozentpunkte an Zweitstimmen.
Die Verluste der SPD waren mit über 6 Millionen abgewanderten Wählern von allen Parteien am größten. Die meisten Wähler verlor sie jedoch nicht an andere Parteien, sondern über zwei Millionen an das Lager der Nichtwähler. Daher soll in dieser Arbeit untersucht werden, ob mit Hilfe des Ann-Arbor-Modells erklärt werden kann, warum die Wählerschaft der SPD bei der Bundestagswahl 2009 für ihre Partei gestimmt bzw. sich der Wahl enthalten hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlage
- Das Ann-Arbor-Modell als Erklärungsgrundlage für individuelles Wahlverhalten
- Die Übertragbarkeit des Ann-Arbor-Modells auf deutsche Bundestagswahlen
- Die Ausgangssituation der SPD bei der Bundestagswahl 2009
- Anwendung des Ann-Arbor-Modells auf die Bundestagswahl 2009
- Vorstellung und Operationalisierung der Daten
- Analyse der langfristigen Variable „Parteiidentifikation“ als Determinante des Wahlverhaltens
- Kann das Ann-Arbor-Modell das Wahlverhalten der SPD-Wähler erklären?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit hat zum Ziel, das Wahlverhalten der SPD-Wähler bei der Bundestagswahl 2009 mithilfe des Ann-Arbor-Modells zu erklären und zu analysieren. Dabei werden die Übertragbarkeit des Modells auf den deutschen Kontext, die Ausgangssituation der SPD bei der Wahl sowie die Determinanten des Wahlverhaltens, insbesondere die Parteiidentifikation, betrachtet.
- Übertragbarkeit des Ann-Arbor-Modells auf deutsche Bundestagswahlen
- Analyse der Parteiidentifikation als Determinante des Wahlverhaltens
- Einfluss politischer Einstellungen auf das Wahlverhalten zugunsten der SPD
- Erklärung des Wahlverhaltens der SPD-Wähler bei der Bundestagswahl 2009
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Relevanz des Themas und stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen des Wahlverhaltens der SPD-Wähler bei der Bundestagswahl 2009. Das zweite Kapitel widmet sich dem Ann-Arbor-Modell, seinen zentralen Annahmen und der Übertragbarkeit auf den deutschen Kontext. In Kapitel 3 wird die Ausgangssituation der SPD bei der Bundestagswahl 2009 beschrieben. Das vierte Kapitel analysiert die Daten, die Operationalisierung der Variablen und untersucht die Rolle der Parteiidentifikation als Determinante des Wahlverhaltens. In Kapitel 4.3 wird der Einfluss von politischen Einstellungen auf das Wahlverhalten zugunsten der SPD untersucht, um die Frage zu beantworten, ob das Ann-Arbor-Modell das Wahlverhalten der SPD-Wählerschaft erklären kann.
Schlüsselwörter
Wahlverhalten, Ann-Arbor-Modell, Parteiidentifikation, Bundestagswahl 2009, SPD, politische Einstellungen, empirische Analyse.
- Citar trabajo
- Julian Bauer (Autor), 2012, Das Wahlverhalten der SPD-Wähler bei der Bundestagswahl 2009 anhand des Ann-Arbor-Modells. Eine empirische Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426008