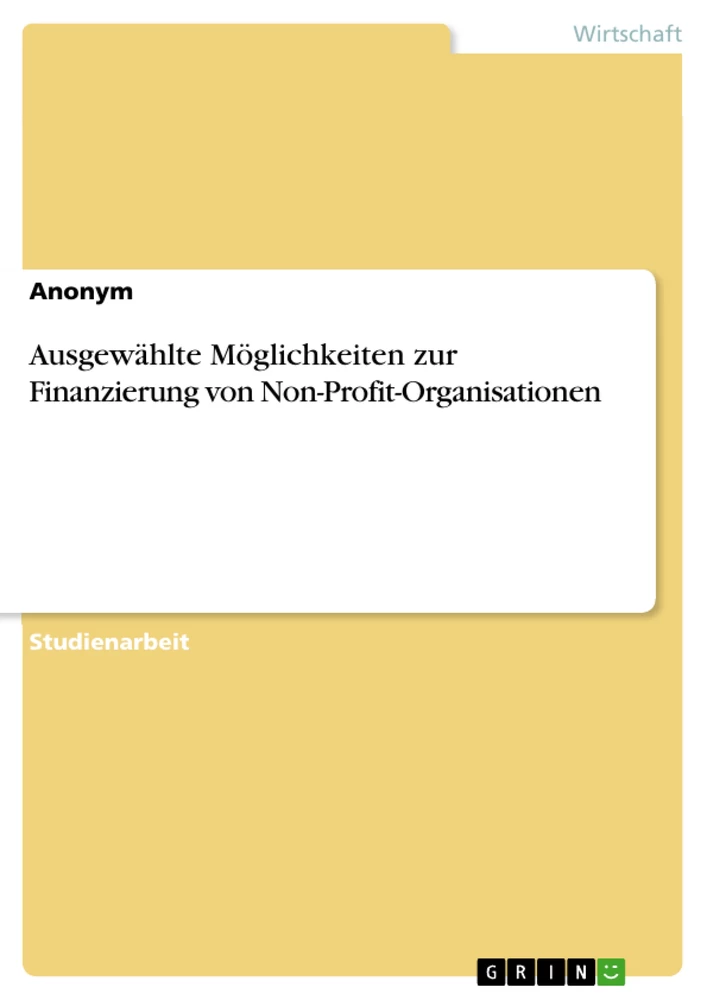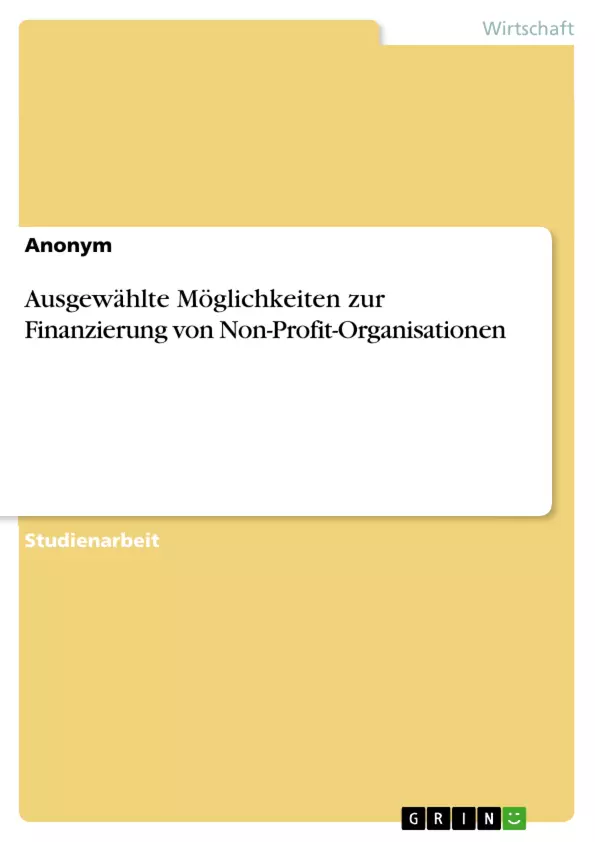Soziale Unternehmen stehen in Zeiten dynamischer Unternehmenswelten und sich ändernden Leistungsstrukturen vor großen Herausforderungen. Für eine funktionierende Gesellschaft werden funktionierende Non-Profit-Organisationen jedoch zwingend benötigt, denn diese leisten weltweit wichtige Beiträge. Intakte und unabhängige NPOs gelten beispielsweise als eine der wichtigsten Grundlagen einer freien Wirtschaft und Gesellschaft, denn die Summe dieser, unter anderem bestehend aus der öffentlichen Verwaltung sowie Sozial-, Gesundheits- und Kulturorganisationen, bildet die Basis für private Haushalte und Forprofit-Organisationen. Funktionierende NPOs sollten daher das höchste Interesse einer Gesellschaft sein. Umso wichtiger ist es, ein besonderes Augenmerk auf die Finanzierung zu richten, ohne die eine NPO langfristig nicht überlebensfähig wäre. Angesichts der immer schwieriger werdenden staatlichen Finanzierung, nehmen alternative Finanzierungsmöglichkeiten an Bedeutung zu. Daraus ergibt sich die zentrale Fragestellung, welche Möglichkeiten der Finanzierung sich für Non-Profit-Organisationen in der heutigen Zeit bieten.
Die Analyse sowie die kritische Beurteilung der Finanzierungsmöglichkeiten von NPOs, zunächst im theoretischen Kontext und anschließend anhand einer bestehenden NPO im sozialen Bereich, stellen das Ziel dieser Arbeit dar.
Die Arbeit beginnt mit der Einleitung, welche sich in Problemstellung sowie Ziel und Gang gliedern lässt. Darauffolgend befasst sich das zweite Kapitel mit dem theoretischen Kontext von NPOs und geht somit neben der Begriffsbestimmung und den möglichen Formen insbesondere auf die detaillierte Aufgliederung und Beschreibung der verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten und deren Grenzen ein. Die Finanzierung innerhalb einer bestehenden NPO wird im dritten Kapitel analysiert, wodurch die in Kapitel Zwei aufgeführten theoretischen Grundlagen durch Beispiele aus der Praxis untermauert werden sollen. Im vierten Kapitel werden die gewonnen Erkenntnisse zu einem Fazit zusammengefasst und somit der Abschluss dieser Arbeit gebildet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziel und Gang der Arbeit
- 2. Non-Profit-Organisationen im theoretischen Kontext
- 2.1 Begriffliche Grundlagen
- 2.2 Formen von Non-Profit-Organisationen
- 2.3 Die Finanzierungsmöglichkeiten
- 2.3.1 Innenfinanzierung
- 2.3.2 Außenfinanzierung
- 2.3.3 Fundraising
- 2.4 Grenzen der Finanzierung
- 3. Theorie-Praxis-Reflexion am Beispiel der UNICEF Deutschland
- 3.1 Unternehmensvorstellung
- 3.2 Analyse der Finanzierung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Analyse und kritischen Beurteilung der Finanzierungsmöglichkeiten von Non-Profit-Organisationen (NPOs). Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten im theoretischen Kontext zu erlangen und dieses anhand eines konkreten Beispiels, der UNICEF Deutschland, in die Praxis zu übertragen.
- Begriffliche Grundlagen und Formen von NPOs
- Finanzierungsmöglichkeiten von NPOs: Innenfinanzierung, Außenfinanzierung, Fundraising
- Grenzen der Finanzierungsmöglichkeiten
- Praxisbeispiel: UNICEF Deutschland und deren Finanzierung
- Zusammenfassendes Fazit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein. Es werden die Herausforderungen für soziale Unternehmen in dynamischen Unternehmenswelten und sich ändernden Leistungsstrukturen beleuchtet. Die Bedeutung von funktionierenden NPOs für eine freie Wirtschaft und Gesellschaft wird hervorgehoben, sowie die Notwendigkeit, der Finanzierung von NPOs besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Kapitel 2 befasst sich mit dem theoretischen Kontext von NPOs. Es werden die Begrifflichen Grundlagen von NPOs sowie deren Formen erläutert. Ein Schwerpunkt liegt auf der detaillierten Analyse der Finanzierungsmöglichkeiten, darunter Innenfinanzierung, Außenfinanzierung und Fundraising. Weiterhin werden die Grenzen der Finanzierung im Detail beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert die Finanzierung einer bestehenden NPO, der UNICEF Deutschland. Es werden die theoretischen Grundlagen aus Kapitel Zwei anhand von praktischen Beispielen aus der Praxis untermauert.
Schlüsselwörter
Non-Profit-Organisationen, Finanzierung, Innenfinanzierung, Außenfinanzierung, Fundraising, UNICEF Deutschland, Theorie-Praxis-Reflexion, soziale Unternehmen, gesellschaftliche Bedeutung, Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Finanzierung für Non-Profit-Organisationen (NPOs) so wichtig?
NPOs leisten essentielle Beiträge für die Gesellschaft. Ohne eine stabile Finanzierung sind sie langfristig nicht überlebensfähig, besonders da staatliche Mittel zunehmend knapper werden.
Welche Formen der Außenfinanzierung gibt es für NPOs?
Dazu gehören öffentliche Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge, Sponsoring, Spenden und Leistungsentgelte für erbrachte soziale Dienste.
Was versteht man unter Fundraising?
Fundraising ist die systematische Akquise von Ressourcen (meist Geld, aber auch Zeit oder Sachmittel) von Dritten, um die gemeinnützigen Zwecke der Organisation zu finanzieren.
Was sind die Grenzen der Finanzierung bei NPOs?
Grenzen ergeben sich durch rechtliche Vorgaben (Gemeinnützigkeit), die Abhängigkeit von Spendern oder staatlichen Geldgebern sowie den ethischen Anspruch der Organisation.
Wie finanziert sich UNICEF Deutschland beispielhaft?
Die Arbeit analysiert UNICEF als Praxisbeispiel, wobei der Fokus auf einem Mix aus privaten Spenden, dem Verkauf von Grußkarten und Partnerschaften mit Unternehmen liegt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Ausgewählte Möglichkeiten zur Finanzierung von Non-Profit-Organisationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426014