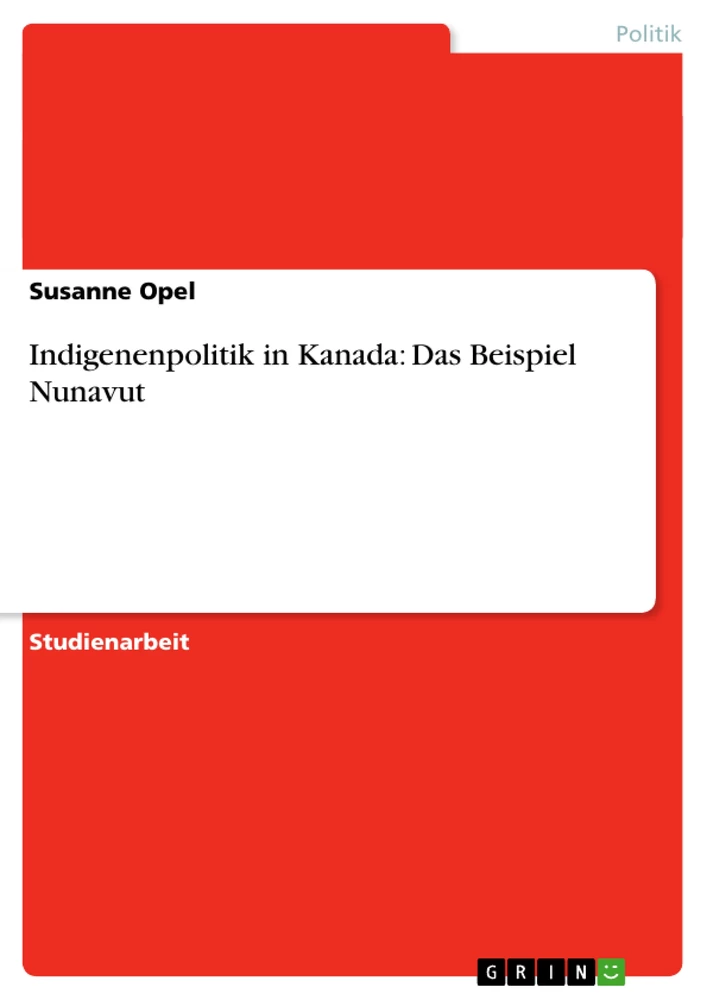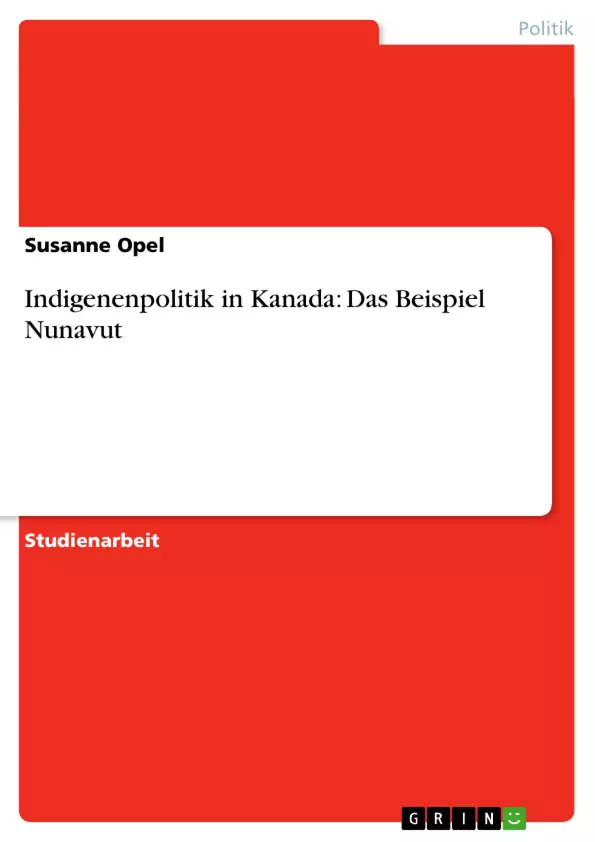Über das Schicksal der Indianer in den USA ist viel bekannt: dass sie einen Großteil ihres Landes verloren und auf vom Staat zugeteilten, vergleichsweise winzigen Reservaten leben; dass sie zeitweise regelrecht ausgerottet wurden; dass die indianische Kultur ihnen ausgetrieben werden sollte. Z.B. wurden Indianische Kinder
„zu Tausenden in Internate geschickt, wo sie manchmal für Jahre von zu Hause ferngehalten und für das Sprechen ihrer eigenen Sprache – oft brutal – bestraft wurden. Aus „Indianern“ sollten „Amerikaner“ werden [...].“
Des weiteren weiß man auch, dass viele von ihnen heute arbeitslos und süchtig nach Alkohol und anderen Drogen sind; dass ihnen von der US-Regierung zu geringe finanzielle Mittel zu Verfügung gestellt werden; dass ihre Reservate Großbauprojekten und der Ausschöpfung von Rohstoffvorkommen zum Opfer fallen etc. etc.
Doch James Wilsons Buch, indem er diese und viele andere Faktoren der Geschichte der „indigenen Völker Nordamerikas“ beschreibt, bezieht sich nur auf das heutige Gebiet der USA. Zu Nordamerika gehört aber auch Kanada, wo auch Indigene leben, deren Traditionen und Kulturen durch das Eintreffen der Europäer und die Politik der heutigen Regierungen gefährdet waren und sind. Diese Arbeit soll sich mit der Indigenenpolitik in Kanada beschäftigen, vor allem mit den Inuit und ihrem Territorium Nunavut, und untersuchen, inwieweit sich diese Politik von der in Wilsons Buch beschriebenen US-amerikanischen unterscheidet und, im besten Fall, auch, ob sie für andere Länder ein Vorbild sein kann.
Schon auf den ersten Blick bietet Kanada ein anderes Bild als die USA: In den USA ist fast das gesamte Staatsgebiet besiedelt und „wilde“ Gegenden sind relativ klein und begrenzt. Kanada hingegen weist nur im äußersten Süden eine große Bevölkerungsdichte auf, in den übrigen Gebieten leben nur sehr wenige Menschen. Kanada als Staat ist jünger als die USA und gehört zum britischen Commonwealth mit der englischen Königin als Staatsoberhaupt. Auch politisch und verwaltungstechnisch gibt es große Unterschiede zu den USA. Die USA bestehen aus 50 Bundesstaaten, Kanada hingegen aus zehn Provinzen (weitestgehend mit den US-amerikanischen Staaten vergleichbar) und drei riesigen Territorien, die direkter von der Hauptstadt Ottawa abhängig sind. In diesen Territorien lebt ein Großteil der indigenen Bevölkerung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Kanada - das „andere“ Amerika?
- 2. Die verschiedenen indigenen Gruppen Kanadas
- 3. Die traditionelle Lebensweise der Inuit
- 4. Die Inuit-Politik bis zum 2. Weltkrieg
- 5. Der Kampf um Selbstbestimmung
- 5.1. Als Minderheit in den Northwest Territories
- 5.2. Nunavut kommt ins Rollen
- 5.3. Die Arbeit des NFC
- 6. Nunavut — „unser Land“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Indigenenpolitik in Kanada, insbesondere die Situation der Inuit und ihres Territoriums Nunavut. Sie befasst sich mit der Frage, inwieweit sich diese Politik von der in den USA unterscheidet und ob sie ein Vorbild für andere Länder sein könnte.
- Die Geschichte der indigenen Bevölkerung Kanadas
- Die traditionelle Lebensweise der Inuit
- Der Kampf der Inuit um Selbstbestimmung
- Die Entstehung des Territoriums Nunavut
- Die aktuelle Situation der Inuit in Nunavut
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Kanada als „anderes“ Amerika vor und hebt die Unterschiede in der Siedlungsgeschichte, Bevölkerungsstruktur und Politik im Vergleich zu den USA hervor. Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen indigenen Gruppen Kanadas vorgestellt, wobei der Fokus auf die vier Kategorien Status-Indianer, statuslose Indianer, Métis und Inuit liegt. Kapitel 3 beleuchtet die traditionelle Lebensweise der Inuit als kleinste Gruppe der First Nations. Die Kapitel 4 und 5 befassen sich mit der Geschichte der Inuit-Politik bis zum 2. Weltkrieg und dem Kampf um Selbstbestimmung, der zur Gründung des Territoriums Nunavut führte. Das letzte Kapitel, das hier nicht zusammengefasst wird, befasst sich mit der Situation Nunavuts als "unser Land".
Schlüsselwörter
Indigene Politik, Kanada, Nunavut, Inuit, Selbstbestimmung, First Nations, Status-Indianer, statuslose Indianer, Métis, traditionelle Lebensweise, Geschichte, Kultur, Politik, Vergleich, USA.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Nunavut und welche Bedeutung hat es für die Inuit?
Nunavut ("Unser Land") ist ein 1999 geschaffenes Territorium in Kanada. Es ist das Ergebnis des Kampfes der Inuit um Selbstbestimmung und gibt ihnen weitgehende politische Autonomie über ihr traditionelles Siedlungsgebiet.
Wie unterscheidet sich die kanadische Indigenenpolitik von der in den USA?
Während die US-Politik oft auf Assimilation und kleine Reservate setzte, ermöglichte Kanada mit Nunavut ein riesiges, selbstverwaltetes Territorium. Kanada erkennt die Rechte der First Nations, Métis und Inuit differenzierter an.
Wer sind die verschiedenen indigenen Gruppen in Kanada?
Man unterscheidet zwischen Status-Indianern, statuslosen Indianern, den Métis (Nachfahren von Europäern und Indigenen) und den Inuit im hohen Norden.
Was war das Ziel der Residential Schools in Kanada?
Ähnlich wie in den USA dienten diese Internate dazu, indigenen Kindern ihre Sprache und Kultur auszutreiben und sie zwangsweise an die europäisch geprägte Gesellschaft anzupassen.
Kann Nunavut als Vorbild für andere Länder dienen?
Die Arbeit untersucht, ob das Modell der territorialen Selbstverwaltung ein Weg sein kann, um die Rechte indigener Völker weltweit zu stärken und historische Ungerechtigkeiten auszugleichen.
- Quote paper
- Susanne Opel (Author), 2004, Indigenenpolitik in Kanada: Das Beispiel Nunavut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42614