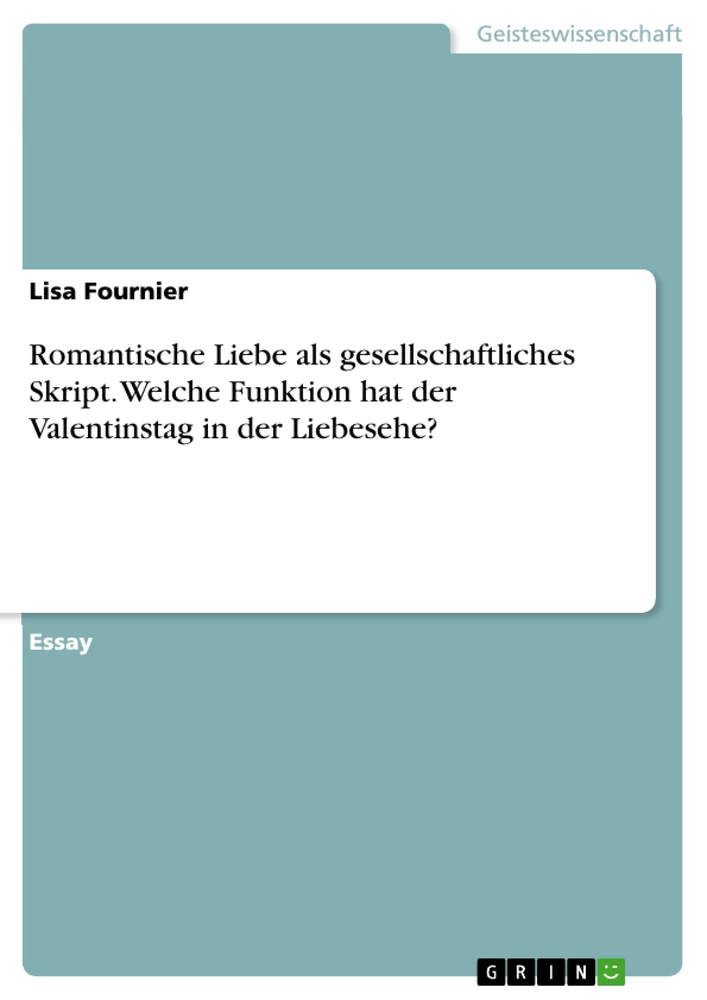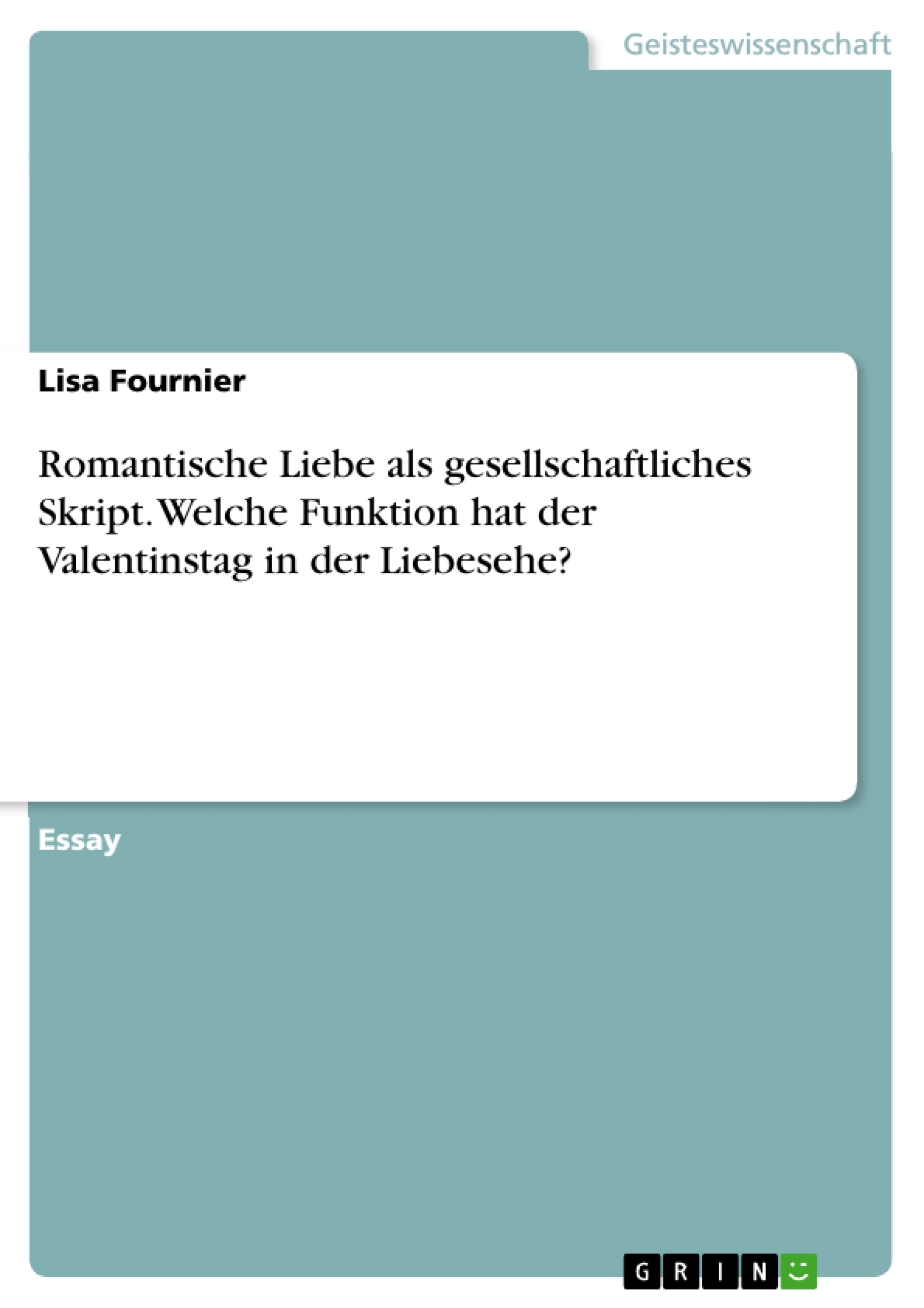Dieses Essay ist der Versuch zu erarbeiten, welche Funktion der Valentinstag gegebenenfalls in dem Konzept der Liebesehe haben könnte. Die romantische Liebe wird soziologisch untersucht und als gesellschaftliches Skript dargestellt.
Die Liebe ist für unsere Gesellschaft etwas Alltägliches und der Grundbaustein des Eheverständnisses. Wer aus Liebe heiratet entspricht der Norm. Wer aus anderer Gründen, wie zum Beispiel finanzielle Absicherung sein Eheversprechen abgibt, gilt als nicht normkonform und bedauernswert.
In Hollywood Filmen, Büchern, Liedern und selbst in persönlichen Erzählungen wird immer von der großen Liebe gesprochen. Zwei Blicke treffen sich und schon weiß man, dass es sich um die eine Person handelt, mit der man den Rest seiner Tage verbringen möchte, ohne dass man ein Wort miteinander gewechselt hat.
In der Realität jedoch ist die vermeintliche „große Liebe“ sehr häufig gebunden an bestimmten Schicht- oder Alterslinien. Das bedeutet, Liebe ist nicht ganz so zufällig, wie es scheint. Die meisten Paare verkehren in einer ähnlichen Altersklassen und einem ähnlichen sozialen Stand. Trotz der unklaren Vorstellung von Liebe, heiraten 95 Prozent der Bevölkerung jedoch, wenn man sie befragt aus Liebe, wodurch man vermuten kann, dass die meisten Menschen Vorstellungen von Liebe haben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Romantische Liebe als gesellschaftliches Skript
- Welche Funktion hat der Valentinstag in dem Konzept der Liebesehe?
- Liebe als Konzept
- Liebe im gesellschaftlichen Kontext
- Der „moderne Heiratsmarkt“
- Romantische Konventionen als gesellschaftliches Skript
- Normen innerhalb der Liebesheirat
- Romantische Liebe als soziale Erfindung
- Romantische Liebe und die Romantik
- Der Valentinstag und romantische Gefühle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieses Essay analysiert die Funktion des Valentinstags im Kontext der Liebesehe. Es untersucht, wie die romantische Liebe als gesellschaftliches Skript konstruiert wird und welche Rolle Normen, Erwartungen und Symbole in diesem Prozess spielen.
- Die Bedeutung von Liebe und Heiratsmarkt in der Gesellschaft
- Die Rolle von Normen und Erwartungen in der Partnerwahl
- Der Einfluss von romantischen Konventionen auf das Konzept der Liebesehe
- Die Verbindung zwischen dem Valentinstag und romantischen Gefühlen
- Die Frage nach der Rolle des Valentinstags im Konzept der Liebesehe
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der Text beginnt mit einer Einführung in das Thema romantische Liebe als gesellschaftliches Skript und stellt die Frage nach der Funktion des Valentinstags in diesem Kontext. Anschließend wird das Konzept der Liebe im gesellschaftlichen Kontext erörtert, wobei der "moderne Heiratsmarkt" als ein relevantes Modell zur Analyse der Partnerwahl vorgestellt wird.
Im nächsten Kapitel werden romantische Konventionen als gesellschaftliches Skript untersucht, wobei die Rolle von Normen, Erwartungen und Symbolen in der Liebesheirat hervorgehoben wird. Der Fokus liegt auf der These, dass romantische Liebe eine soziale Erfindung ist und dass der Valentinstag ein Beispiel für die Instrumentalisierung romantischer Elemente in der modernen Gesellschaft darstellt.
Im letzten Abschnitt wird der Valentinstag als ein konstitionalisierendes Element der Liebesehe betrachtet und dessen Rolle bei der Festigung des Konzepts der Liebe diskutiert. Die Frage, welche Auswirkungen das Fehlen des Valentinstags auf das Konzept der Liebesehe hätte, wird als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen vorgeschlagen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Romantische Liebe, Liebesehe, Valentinstag, gesellschaftliches Skript, Normen, Erwartungen, Symbole, moderne Heiratsmarkt, Emotionalarbeit, Romantik, dyadischer Rückzug.
- Quote paper
- Lisa Fournier (Author), 2017, Romantische Liebe als gesellschaftliches Skript. Welche Funktion hat der Valentinstag in der Liebesehe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426213