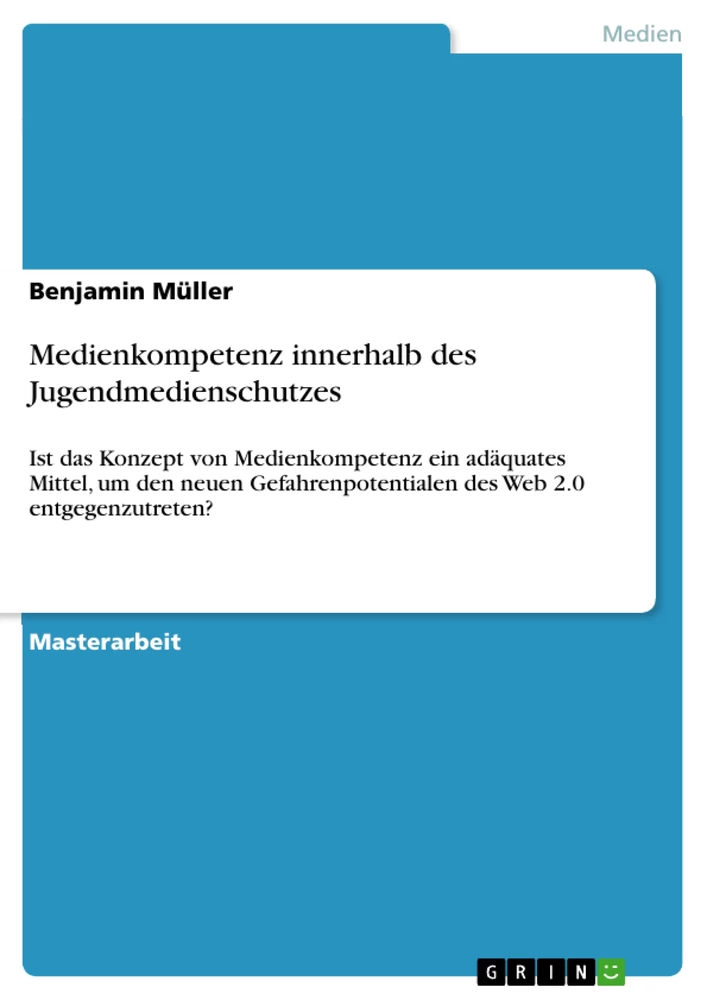Jugendschutz heute bedeutet immer auch Jugendmedienschutz. Kinder und Jugendliche wachsen in „Mediatisierten Lebenswelten“ auf, in denen Medien zu ihrer Alltagswelt geworden sind und sie permanent umgeben. Dieser dauerhafte Kontakt der sog. „Digital Natives“ mit Medien führt dazu, dass diese heute zu einer wichtigen Sozialisationsinstanz neben Familie, Schule oder der Peer Group geworden sind. Sie vermitteln Kindern und Jugendlichen Werte und Normen, bieten ihnen Identifikationspotentiale und Möglichkeiten zur Partizipation, zeigen ihnen Verhaltensmuster auf und tragen zu ihrer Identitätsbildung bei.
Neue Informations- und Kommunikationstechniken führen heute zu einer Verschmelzung verschiedener Medien, welche als Medienkonvergenz bezeichnet wird. Durch mobile Endgeräte, Handys, Smartphones und Co. ist das Web 2.0 heute nahezu überall verfügbar.
Der Begriff der „Medienkompetenz“ gilt heute als eine Art Generallösung für sämtliche medienbasierten Probleme und ist innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Debatte und im Speziellen innerhalb des Jugendmedienschutzes so unscharf und ohne Aussagekraft wie nie zuvor. Deshalb soll in dieser Arbeit geklärt werden, ob Medienkompetenz ein wirksames Mittel sein kann, um den Jugendschutz-Gefahren, die von neuen Medien ausgehen, wirksam zu begegnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 1.1 Ziele und Aufbau der Arbeit
- 2. Begriffsdefinition
- 2.1 Medien.
- 2.2 Kompetenz
- 2.3 Jugendmedienschutz.
- 2.4 Web 2.0
- 3. Gesellschaftliche - und technologische Rahmenbedingungen.
- 3.1 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- 3.2 Technologische Rahmenbedingungen.
- 4. Neue Gefährdungspotentiale durch das Web 2.0.
- 4.1 Sexuelle Belästigung und Cybergrooming.
- 4.2 Cybermobbing.
- 4.3 Selbstpräsentation und Datenschutz.
- 4.4 Inhaltliche Gefahren - Porno, Gewalt, Rassismus und Werte.
- 4.5 Werbung aus allen Richtungen
- 4.6 Verlinkungen zu gefährdenden Angeboten.
- 4.7 Mobiles Internet und Ortungsdienste
- 4.8 Suchtpotential der Mediennutzung.
- 4.9 Entwicklungsbeeinträchtigende - und gesundheitliche Risiken.
- 5. Gesetzlicher Jugendmedienschutz und Web 2.0
- 5.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen.
- 5.2 Jugendmedienschutzstaatsvertrag
- 5.3 Handlungsmöglichkeiten des JMStV.
- 5.3.1 Sperrungen
- 5.3.2 Geschlossene Benutzergruppen.
- 5.3.3 Technische Mittel und Jugendschutzprogramme.
- 5.4 Kritik am gesetzlichen Jugendmedienschutz.
- 6. Medienkompetenz in der Wissenschaftstheorie
- 6.1 Verortung von Medienpädagogik und Medienkompetenz.
- 6.2 Medienkompetenzmodelle im Überblick.
- 6.3 Medienbildung vs. Medienkompetenz.
- 6.4 New Media Literacy – Eine internationale Sichtweise
- 7. Medienkompetenz in der Vermittlung
- 7.1 Übergreifende Annahmen im Vermittlungsprozess.
- 7.1.1 Normative Ausrichtung und Messbarkeit
- 7.1.2 Digital Divide.
- 7.1.3 Das Generationsproblem.
- 7.2 Phasen der Mediennutzung
- 7.2.1 Frühe Kindheit.
- 7.2.2 Mittlere - und späte Kindheit
- 7.2.3 Jugendalter
- 7.3 Medienkompetenzvermittlung in der Familie.
- 7.4 Medienkompetenzvermittlung in der Schule
- 7.5 Außerschulische Einrichtungen, Medien und Peer-Group.
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Medienkompetenz im Kontext des präventiven Jugendmedienschutzes. Ziel ist es, zu analysieren, ob das Konzept der Medienkompetenz ein adäquates Mittel ist, um den neuen Gefahrenpotentialen des Web 2.0 entgegenzutreten.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Medienkompetenz
- Die Herausforderungen des Web 2.0 für den Jugendmedienschutz
- Die Rolle des gesetzlichen Jugendmedienschutzes in der digitalen Welt
- Medienkompetenz in der Theorie und Praxis der Medienpädagogik
- Die Bedeutung von Medienkompetenzvermittlung in verschiedenen Lebensbereichen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Ziele und den Aufbau der Arbeit dar. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der begrifflichen Klärung von "Medien", "Kompetenz" und "Jugendmedienschutz" sowie einer Definition von Web 2.0. Das dritte Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen, die den Umgang mit Medien im Jugendalter prägen. Kapitel vier widmet sich den neuen Gefährdungspotentialen des Web 2.0, darunter sexuelle Belästigung, Cybermobbing, Selbstpräsentation und Datenschutz, inhaltliche Gefahren, Werbung, Verlinkungen zu gefährdenden Angeboten, mobiles Internet und Ortungsdienste, Suchtpotential und entwicklungsbeeinträchtigende Risiken. Das fünfte Kapitel analysiert den gesetzlichen Jugendmedienschutz im Kontext des Web 2.0, einschließlich der verfassungsrechtlichen Grundlagen, des Jugendmedienschutzstaatsvertrags und seiner Handlungsmöglichkeiten sowie Kritikpunkten. Kapitel sechs untersucht die Medienkompetenz in der Wissenschaftstheorie, einschließlich der Verortung von Medienpädagogik und Medienkompetenz, verschiedener Medienkompetenzmodelle, der Abgrenzung von Medienbildung und Medienkompetenz sowie der internationalen Perspektive "New Media Literacy". Das siebte Kapitel befasst sich mit der Medienkompetenzvermittlung in der Praxis, wobei übergreifende Annahmen im Vermittlungsprozess, Phasen der Mediennutzung, die Vermittlung in Familie, Schule und außerschulischen Einrichtungen sowie Peer-Groups betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Medienkompetenz, Jugendmedienschutz, Web 2.0, Gefahrenpotentiale, Cybermobbing, Datenschutz, Medienpädagogik, Medienbildung, New Media Literacy, Vermittlung, Familie, Schule, Peer-Group.
- Quote paper
- Benjamin Müller (Author), 2013, Medienkompetenz innerhalb des Jugendmedienschutzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426288