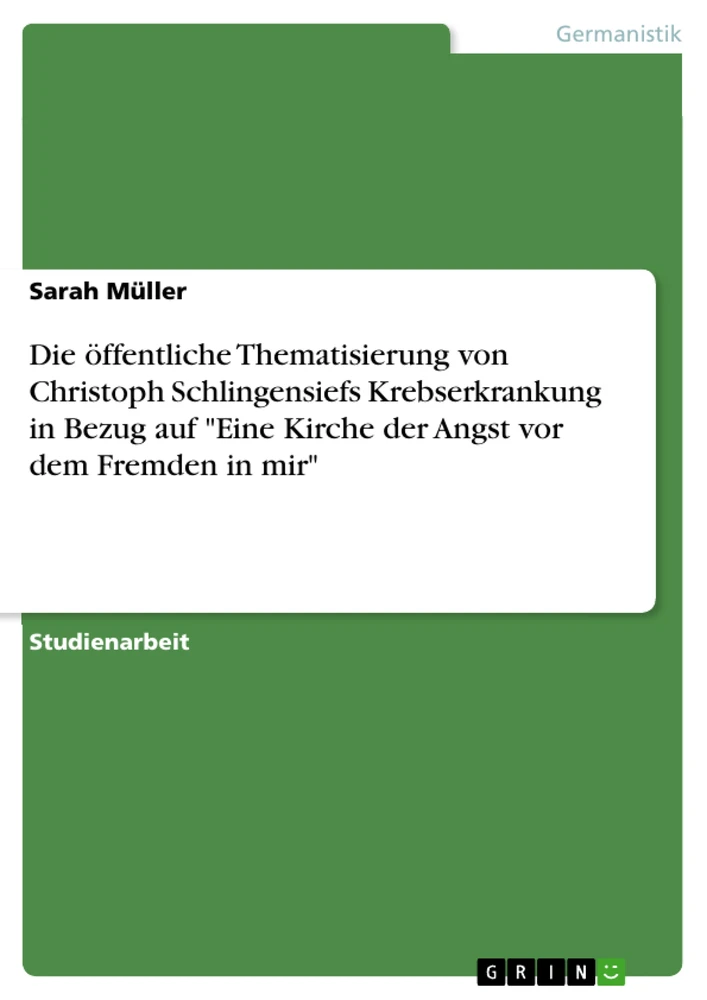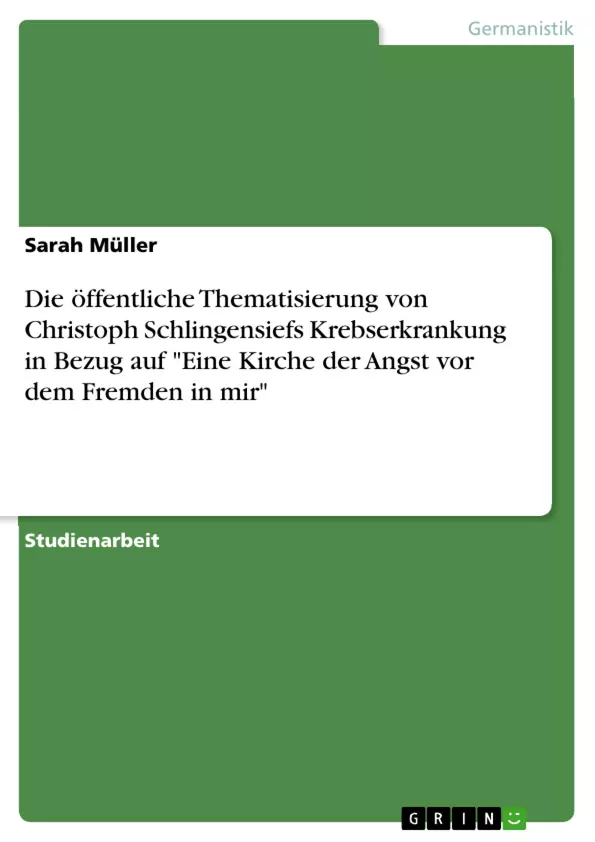„Ich will gegen Krankheit, Sterben und Tod sprechen. Gegen diese Ächtungskultur ansprechen, die den Kranken Redeverbot erteilt. Ich gieße eine soziale Plastik aus meiner Krankheit.“ Diese Worte hat der am 21. August 2010 verstorbene Christoph Schlingensief im Dezember 2008, nachdem man festgestellt hatte, dass sich an seinem verbliebenen Lungenflügel Metastasen gebildet haben, in sein Diktiergerät gesprochen.
Die auf diese Weise protokollierten Erfahrungen des Regisseurs wurden transkribiert und unter dem Titel So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein als Buch herausgegeben. Diese Aufzeichnungen liegen in Ausschnitten auch seiner im September 2008 im Rahmen der Ruhrtriennale erstmalig aufgeführten Inszenierung Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir zugrunde. In diesem Stück hat Christoph Schlingensief seine Krankheit vollkommen offen und schonungslos dargestellt. Den Innenraum seiner Oberhausener Pfarrkirche, wo er getauft worden und Messdiener gewesen war, hatte er zumindest auf den ersten Blick originalgetreu in einer alten Industriehalle nachbauen lassen.
Neben den Aspekten Kindheit, Krankheit und Glaube werden in Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir auch sein Verhältnis zur Musik und zur bildenden Kunst behandelt. Seine Beschäftigung einerseits mit Richard Wagner sowie andererseits mit Joseph Beuys und der Fluxus-Bewegung prägte ihn als Mensch und gleichzeitig sein Werk. „Zeige deine Wunde“, dieser von Beuys übernommene Ausspruch steht als Maxime über seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit seiner Krebserkrankung. Die Beschäftigung Schlingensiefs mit dem, in der deutschen Öffentlichkeit, zum Tabu deklarierten Themenkomplex rund um Krankheit, Leiden, Sterben, Tod und Trauer schied wie bereits seine früheren Arbeiten die Geister.
In der folgenden Arbeit werde ich mich damit auseinandersetzen, wie Christoph Schlingensief sich in der Öffentlichkeit mit seiner Krebserkrankung auseinandergesetzt hat. Dies wird stets in Hinblick auf das Fluxus-Oratorium Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir geschehen, um schließlich auf die Inszenierung selber einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- Der Einfluss der Fluxus-Bewegung und Joseph Beuys auf das Werk Christoph Schlingensiefs
- Richard Wagner und der Parsifal in Bezug auf Schlingensiefs Krebserkrankung und seine Auseinandersetzung mit dieser
- Schlingensief: Geliebt und gehasst
- Schlingensiefs Thematisierung seiner Krankheit als natürliche Folge seiner Arbeit
- Die Kirche der Angst vor dem Fremden in mir – zur Titelgebung
- Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir - Von den Aufzeichnungen seiner Gedanken bis zur Inszenierung
- Abschließende Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der öffentlichen Thematisierung der Krebserkrankung von Christoph Schlingensief und seiner Auseinandersetzung mit dieser. Sie analysiert den Einfluss der Fluxus-Bewegung und Joseph Beuys auf sein Werk, beleuchtet seine Beziehung zu Richard Wagner und dem Parsifal sowie die Auswirkungen seiner Krankheit auf sein Schaffen.
- Der Einfluss der Fluxus-Bewegung und Joseph Beuys auf das Werk Schlingensiefs
- Die Auseinandersetzung mit der Krankheit als Ausdruck künstlerischer Freiheit und sozialer Kritik
- Die Verbindung zwischen Schlingensiefs Arbeit, seiner Krankheit und dem Konzept der „sozialen Plastik“
- Die Rolle von Richard Wagner und dem Parsifal in Schlingensiefs Auseinandersetzung mit seiner Krankheit
- Die öffentliche Rezeption von Schlingensiefs Krankheit und seine bewusste Konfrontation mit Tabuthemen
Zusammenfassung der Kapitel
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit: Das Kapitel stellt den Gegenstand und die Ziele der Arbeit vor, wobei es die Bedeutung von Schlingensiefs Tagebuchaufzeichnungen und die Inszenierung "Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir" hervorhebt. Die zentrale Frage ist, wie Schlingensief in der Öffentlichkeit mit seiner Krebserkrankung umgegangen ist.
- Der Einfluss der Fluxus-Bewegung und Joseph Beuys auf das Werk Christoph Schlingensiefs: Dieses Kapitel beschreibt den Einfluss der Fluxus-Bewegung und insbesondere von Joseph Beuys auf Schlingensiefs Schaffen. Es beleuchtet die Bedeutung des Events, die Rolle des Zufalls und die aktive Beteiligung des Publikums. Die „Soziale Plastik“ als idealtypische Gesellschaftsform und die Rolle der Kunst in der Gesellschaftstransformation werden erläutert.
Schlüsselwörter
Schlingensief, Krebserkrankung, Fluxus, Joseph Beuys, soziale Plastik, Richard Wagner, Parsifal, „Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir“, öffentliche Thematisierung, Tabubruch, Kunst im öffentlichen Raum, gesellschaftliche Transformation, Freiheit, Selbstbestimmung.
- Quote paper
- Sarah Müller (Author), 2015, Die öffentliche Thematisierung von Christoph Schlingensiefs Krebserkrankung in Bezug auf "Eine Kirche der Angst vor dem Fremden in mir", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426441