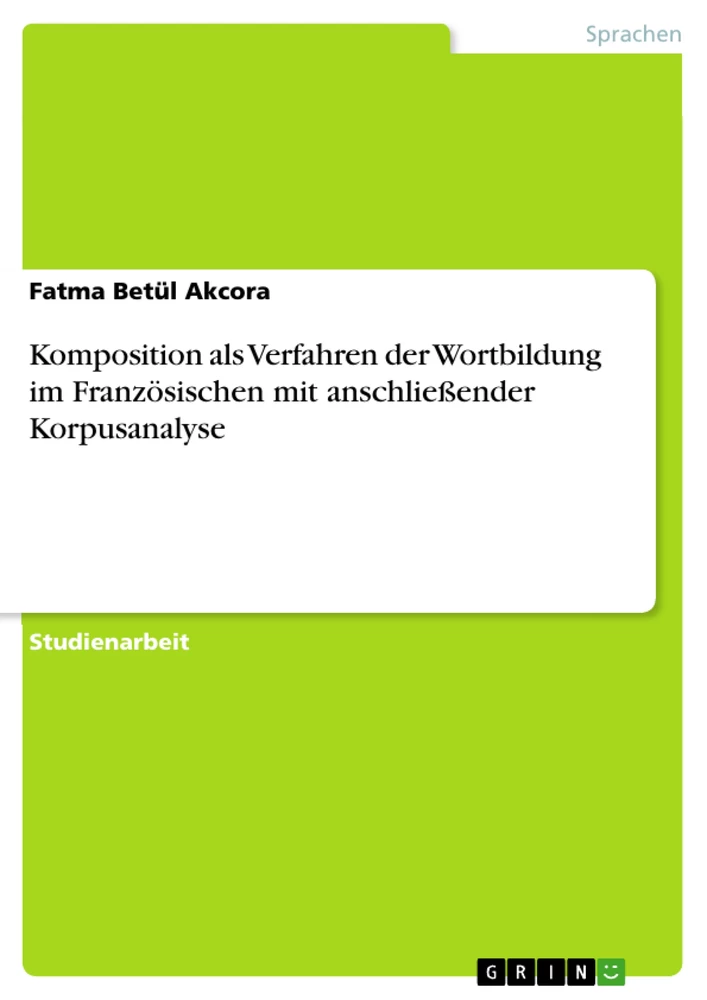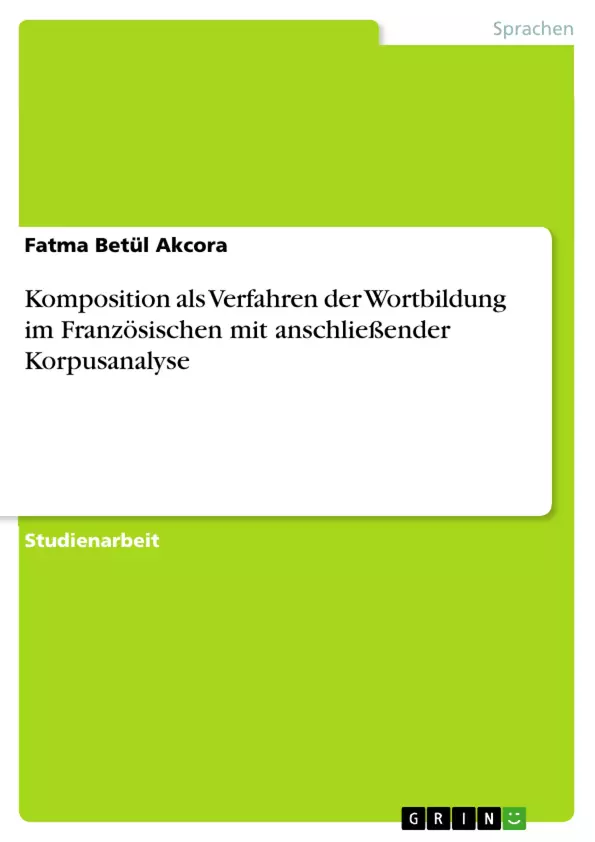Sprachwandel und Wortschatzwachstum sind sowohl bedeutungsvolle als auch unumgängliche Phänomene, die ausschlaggebend für die (Weiter-) Entwicklung aller Sprachen der Welt – und somit auch des Französischen – sind. Der genetisch-historischen Klassifikation zufolge, wird das Französische als ein Repräsentant der romanischen Sprachen angesehen, die sich aus dem Vulgärlatein entwickelten, und gehört folglich zur indoeuropäischen Sprachfamilie. Mit circa 131 Millionen Sprechern (davon 76 Millionen Primärsprachler und 55 Millionen Zweitsprachler) in über 3 Kontinenten (darunter Europa, Afrika und Nordamerika) und einer Sprachgeschichte, die sich über mehrere Jahrhunderte streckt, ist das Französische in der Lage, einen immensen Sprachwandel sowie auch einen enormen Wortschatzwachstum vorzuweisen.
Wird die Entwicklung der französischen Sprache näher in Betracht gezogen, so lassen sich drei Epochen herauskristallisieren, von denen die erste das Altfranzösische war, das auf das 9. Jh. bis 1350 datiert wird. Im Laufe des 9. Jahrhunderts nahm die Geschichte des Französischen durch die Zunahme von Texten in der langue d'oïl, wie zum Beispiel die Eulalia Sequenz (880), seinen Anfang. Die zweite Phase bildete die Epoche des Mittelfranzösischen, dessen Beginn auf 1350 und Ende ca. auf das 15./16. Jh. festgelegt ist. Diese Periode war vor allem durch das Verschwinden der meisten germanischen Wörter, die Bereicherung der Sprache aus Dialekten und anderen Sprachen und die Zunahme von Latinismen gekennzeichnet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Grundlagen
- 2.1 Wortbildung
- 2.2 Wort und Wortschatz
- 3. Wortbildungsverfahren
- 3.1 Derivation
- 3.1.1 Präfigierung
- 3.1.2 Suffigierung
- 3.1.3 Parasynthese
- 3.2 Konversion
- 3.2.1 Konversion ohne Flexion
- 3.2.2 Konversion mit Flexion
- 3.3 Komposition
- 3.3.1 Definition
- 3.3.2 Kompositionsformen
- 3.3.3 Morphologische Komposita und syntaktische Wortgruppen
- 3.3.4 Endozentrische und exozentrische Komposita
- 3.3.5 Determinativ- und Kopulativkomposita
- 3.3.6 Kompositionstypen
- 3.3.7 Gelehrte Bildung
- 4. Problematik
- 4.1 Was ist ein Präfix?
- 4.2 Abgrenzung der Präfigierung gegenüber der Komposition
- 4.2.1 Wortbildungen mit griechischen und lateinischen Elementen
- 4.2.2 Wortbildungen mit Präposition
- 4.2.3 Wortbildungen mit Adverbien
- 4.2.4 Wortbildungen mit non-
- 5. Korpusanalyse
- 5.1 Le Petit Prince
- 5.2 Les voyages en train
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Komposition als Verfahren der Wortbildung im Französischen. Ziel ist es, das Kompositionsverfahren zu definieren, seine verschiedenen Formen und Typen zu erläutern und die Problematik der Abgrenzung von Präfigierung und Komposition zu beleuchten. Die Analyse wird anhand von Beispielen aus dem Korpus der französischen Literatur veranschaulicht.
- Wortbildungsverfahren im Französischen
- Komposition als Verfahren der Wortbildung
- Abgrenzung der Präfigierung von der Komposition
- Analyse von Komposita in literarischen Texten
- Beitrag zur Untersuchung des Wortschatzes der französischen Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Sprachwandel und das Wortschatzwachstum im Französischen vor. Sie gibt einen Überblick über die Entwicklung des Französischen und beleuchtet die Bedeutung von Fremdwörtern für die Bereicherung der Sprache. Das Kapitel erläutert verschiedene Wortbildungsverfahren und deren Bedeutung für den Wortschatz. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Verfahren der Komposition und seinen verschiedenen Formen.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Problematik der Abgrenzung von Präfigierung und Komposition anhand von verschiedenen Beispielen. Es wird argumentiert, dass die Abgrenzung nicht immer eindeutig ist und dass es zahlreiche Fälle von Wortbildungen gibt, die sowohl präfigiert als auch komponiert sein können.
Schlüsselwörter
Wortbildung, Komposition, Präfigierung, Derivation, Konversion, Französisch, Wortschatz, Korpusanalyse, Le Petit Prince, Les voyages en train, Sprachwandel, Wortschatzwachstum.
- Arbeit zitieren
- M.o.A. Fatma Betül Akcora (Autor:in), 2015, Komposition als Verfahren der Wortbildung im Französischen mit anschließender Korpusanalyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426478