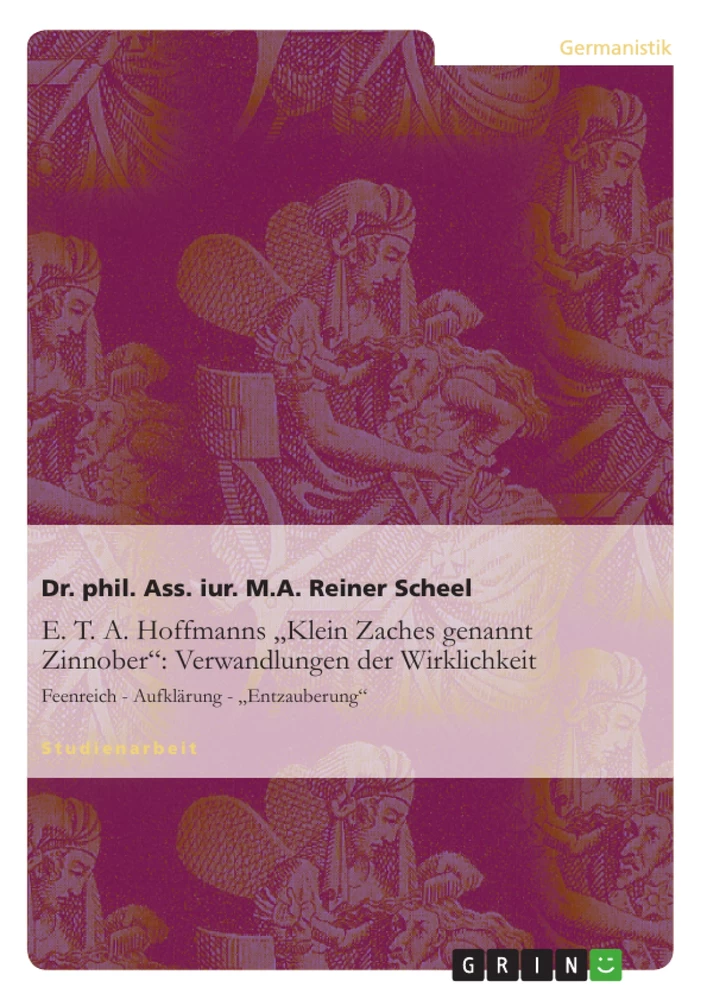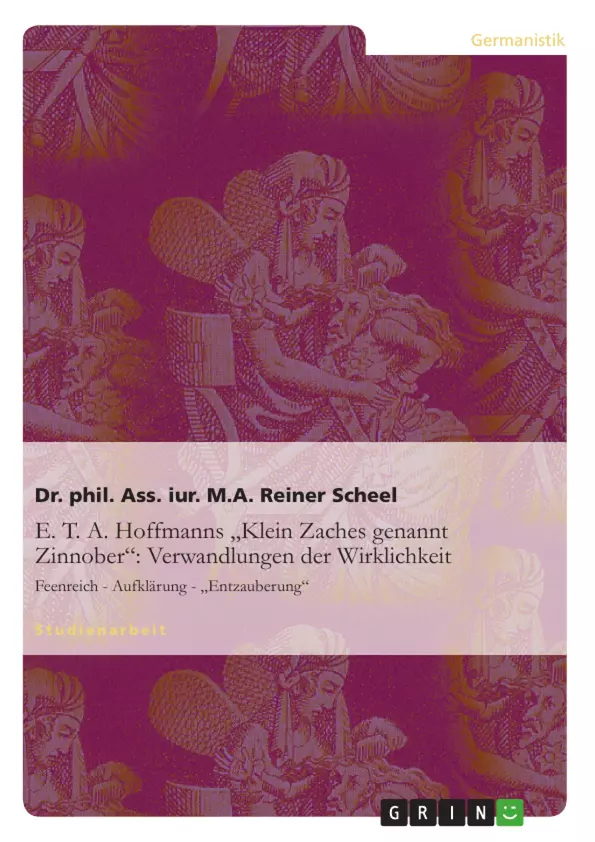Die Forschungsarbeit über das Feenreich, die Aufklärung und die „Entzauberung“ im Märchen „Klein Zaches genannt Zinnober“ entstand während des Sommersemesters 2001 im Rahmen eines Grundseminars zum Gesamtwerk E. T. A. Hoffmanns an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Die Untersuchung beginnt mit Charakterisierungen der Figuren aus dem Feenreich, der neben Bürgern und Künstlern dritten Personengruppe im Text. Wie die Fee Rosabelverde neben ihrer phantastischen eine bürgerliche Existenz als Stiftsfräulein führt, so agiert ihr Gegenspieler, der Magier Prosper Alpanus, in der konventionellen Rolle eines Arztes im Ruhestand. Ironisiert werden die Feengestalten durch die komischen Effekte ihrer Zaubereien. Einerseits bewirkt die Ironie die Verringerung der sozialen Distanz zu den Feenfiguren und damit deren gesellschaftliche Integration, andererseits wird hierdurch die Romantik selbst der Ironie preisgegeben.
Als Hauptvertreter der per Edikt eingeführten Aufklärung (Ironie!) figuriert Professor Mosch Terpin, der für die Kooperation des absolutistischen Staats mit dem die Aufklärung wesentlich bestimmenden neuzeitlichen Rationalismus steht. Mit Terpin und anderen Intellektuellen werden Dünkel und Hochmut der Wissenschaft und deren Empfänglichkeit für eine Korrumpierung durch das politische Establishment entlarvt.
Durch die Verwandlung der „verwahrloste(n) Missgeburt“ Klein Zaches in den einnehmenden Zinnober wird die Manipulierbarkeit der Masse auf die Leugnung der Magie durch die Aufklärung zurückgeführt. Mit der unverdienten Blitzkarriere Zinnobers wird zudem die Günstlingspolitik im System des aufgeklärten Absolutismus demaskiert. Die spätere Entzauberung der Titelfigur führt nicht zu einer strukturellen Veränderung der Gesellschaft von Kerepes. Durch Zaches’ posthume Rehabilitation und die fragwürdige Eheidylle von Candida und Balthasar wird nämlich ironisch-resignativ die Möglichkeit eines neuen Fall Zaches angedeutet.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Hauptteil
- Feenreich
- Rosabelverde
- Prosper Alpanus
- Ironisierung der Feengestalten
- Aufklärung: Ihre Einführung
- Mosch Terpin
- Weitere Vertreter der Aufklärung
- „Entzauberung“ – Verwandlungen der Wirklichkeit
- Verzauberung von Klein Zaches und ihre Wirkungen
- Entzauberung des Zinnober und deren Wirkungen
- Feenreich
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Geschichte von „Klein Zaches genannt Zinnober“ von E. T. A. Hoffmann, indem sie das Konzept des Feenreichs im Kontext der Aufklärung und der „Entzauberung“ der Wirklichkeit untersucht. Die Arbeit zeigt, wie Hoffmanns Werk das Spannungsverhältnis zwischen rationalistischer und romantischer Weltanschauung in der nachaufklärerischen Phase widerspiegelt.
- Das Feenreich als Gegenwelt zur bürgerlichen Realität
- Die Ironisierung der Feengestalten und die Untergrabung des magischen Nimbus
- Die Rolle der Aufklärung in der Transformation der Wirklichkeit
- Die Ambivalenz der „Entzauberung“ und ihre Auswirkungen auf den Protagonisten
- Die Interaktion zwischen den Figuren aus dem Feenreich und der bürgerlichen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Hauptteil
Feenreich
Dieses Kapitel beleuchtet die Figuren aus dem Feenreich, insbesondere Rosabelverde und Prosper Alpanus. Es wird analysiert, wie diese Figuren sowohl übernatürliche Fähigkeiten als auch menschliche Eigenschaften aufweisen. Die Ironisierung der Feengestalten durch den Erzähler wird untersucht, und es wird gezeigt, wie die Magie durch Komik und Fragwürdigkeit untergraben wird.
Aufklärung: Ihre Einführung
Dieses Kapitel behandelt die Einführung der Aufklärung in der Geschichte und ihre Auswirkungen auf die Figuren. Es wird die Rolle von Figuren wie Mosch Terpin als Vertreter der Aufklärung dargestellt, sowie weitere Personen, die diese Denkweise verkörpern.
„Entzauberung“ – Verwandlungen der Wirklichkeit
Dieses Kapitel analysiert den Prozess der „Entzauberung“ der Wirklichkeit, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den Protagonisten Klein Zaches hat. Es wird die Verzauberung und Entzauberung des Protagonisten untersucht und die Folgen für seine Existenz beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themengebiete Feenreich, Aufklärung, „Entzauberung“, Dualismus, Romantische Weltanschauung, Ironie, Gesellschaft, Verwandlung, und die Figuren Rosabelverde, Prosper Alpanus und Klein Zaches.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in E. T. A. Hoffmanns „Klein Zaches genannt Zinnober“?
Das Werk thematisiert die Verwandlung eines missgestalteten Jungen in den angesehenen Zinnober durch magische Hilfe und analysiert dabei das Spannungsfeld zwischen dem Feenreich und der rationalistischen Aufklärung.
Welche Rolle spielen Rosabelverde und Prosper Alpanus?
Sie sind Figuren aus dem Feenreich, die jedoch bürgerliche Tarnidentitäten (Stiftsfräulein und Arzt im Ruhestand) führen. Durch ihre Zaubereien werden sie oft ironisiert, was die soziale Distanz verringert.
Wie wird die Aufklärung in der Erzählung dargestellt?
Die Aufklärung wird oft ironisch als per Edikt eingeführte Ordnung dargestellt. Figuren wie Professor Mosch Terpin verkörpern einen Rationalismus, der für politische Korrumpierung anfällig ist.
Was bedeutet die „Entzauberung“ der Wirklichkeit?
Die Entzauberung beschreibt den Prozess, in dem die Magie durch Rationalität verdrängt wird. Bei Klein Zaches führt dies zur Aufdeckung seiner wahren Natur, was jedoch nicht zwingend zu einer besseren Gesellschaft führt.
Was kritisiert Hoffmann durch die Figur des Zinnober?
Hoffmann entlarvt die Manipulierbarkeit der Massen und die Günstlingspolitik im absolutistischen Staat, in dem Äußerlichkeiten oft mehr zählen als wahre Verdienste.
- Quote paper
- Dr. phil. Ass. iur. M.A. Reiner Scheel (Author), 2001, E. T. A. Hoffmanns "Klein Zaches genannt Zinnober": Verwandlungen der Wirklichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42655