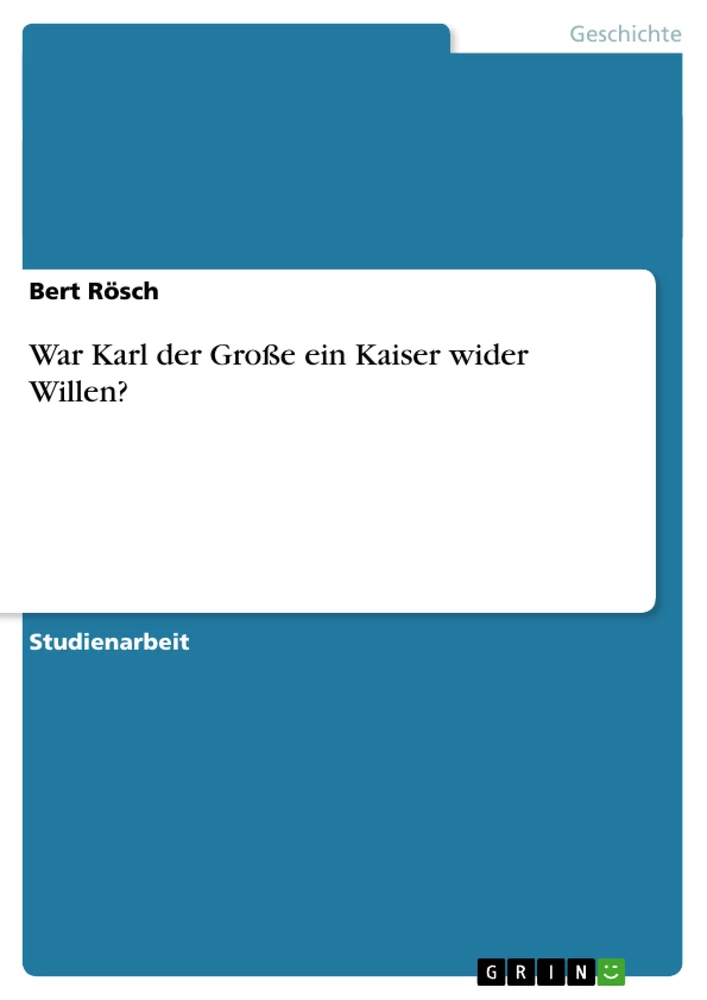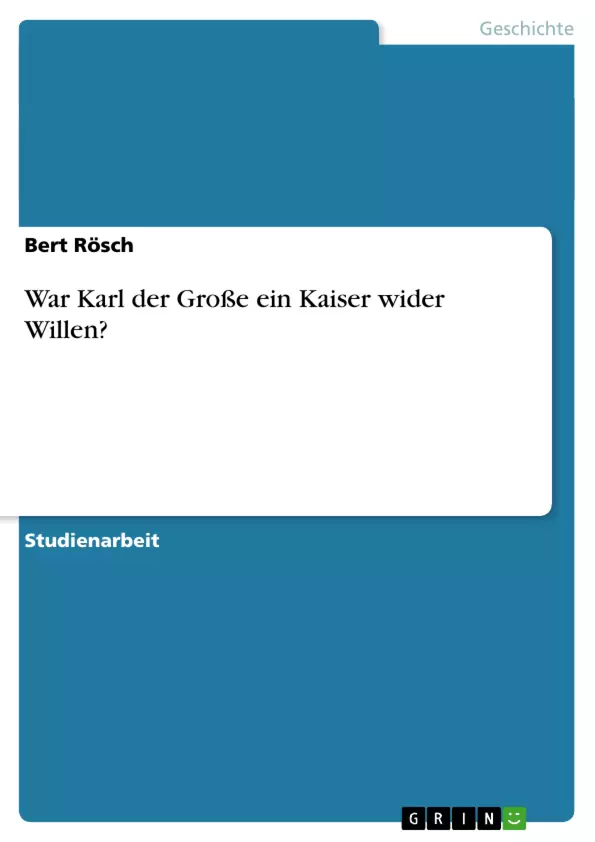„Quo tempore imperatoris et augusti nomen accepit, quod primo in tantum aversatus est, ut adfirmaret se eo die, quamvis praecipua festivitas esset, in ecclesiam non intraturum, si pontificis consilium praescire potuisset.“
Dieses Zitat des Karl-Biographen Einhard aus dem Jahre 851 war der Ausgangspunkt einer Diskussion über das Kaisertum Karls des Großen, die die Geschichtswissenschaft über Jahrhunderte hinweg beschäftigte. Denn diese Äußerung unterstellt Karl der Große, daß er eigentlich gar nicht Kaiser werden wollte. Papst Leo III. habe ihm die Kaiserkrone in einem Überraschungscoup aufs Haupt gesetzt, und Karl habe diese Würde erst nach langem Zögern angenommen.
Diese Theorie fand sowohl zahlreiche Verfechter als auch Kritiker, so daß schließlich zwei Positionen unversöhnlich gegenüberstanden: Die einen gingen davon, daß Karl zwar danach trachtete, sein königliches Ansehen bis zur Grenze des Möglichen zu steigern und sich gern zu den höchsten Personen der Welt zählen ließ, aber zugleich von einer solchen Abneigung gegen alles Römische und insbesondere gegen den Kaisertitel erfüllt war, daß er keinesfalls Kaiser werden wollte. Die anderen waren der Ansicht, daß Karl im Jahre 800 den Romzug in der Absicht antrat, von dem damaligen Papst Leo III. die Kaiserkrone zu erhalten, sprich: Karl hatte die Krönung schon seit langem geplant, und sein von Einhard zitiertes Widerwillen war nur vorgetäuscht.
Die vorliegende Arbeit untersucht diese „Kaiser wider Willen“-Theorie, indem sie den Forschungsgang des Problems untersucht, das laut Heldmann „wie ein gespenstiger Schatten alle Jahrhunderte unseres geschichtlichen Lebens begleitet“ hat. Die Untersuchung beginnt mit der Darstellung Ludens aus dem Jahre 1828 und endet mit den Gedanken, die Johannes Fried 1994 veröffentlichte. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, d.h. es werden nur diejenigen Arbeiten untersucht, die sich entweder sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt haben oder die durch ihre Thesen die Forschungsdiskussion vorangetrieben haben. Besondere Beachtung verdienen dabei auf Seiten der „Kaiser wider Willen“-Theorie Heldmann, Ohr und Schramm und auf Seiten der Gegner dieser Auffassung Fichtenau, Classen und Beumann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil: Die Analyse der Sekundärliteratur
- 1828 bis zur Jahrhundertwende
- 1900 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges
- Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1994
- Schlußteil
- Zusammenfassung
- Schlußfolgerungen und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „Kaiser wider Willen“-Theorie um Karl den Großen, indem sie den Forschungsdiskurs von 1828 bis 1994 analysiert. Das Ziel ist es, die unterschiedlichen Positionen und Argumentationslinien der Historiker nachzuvollziehen und aufzuzeigen, wie sich die Interpretation der Ereignisse um die Kaiserkrönung im Jahr 800 im Laufe der Zeit entwickelt hat. Die Arbeit beschränkt sich dabei auf einflussreiche Studien, die die Debatte maßgeblich geprägt haben.
- Entwicklung der „Kaiser wider Willen“-These in der Geschichtsschreibung
- Analyse der Argumentationen von Befürwortern und Kritikern der These
- Bewertung der Quellenlage und deren Interpretation
- Einfluss der politischen und gesellschaftlichen Kontexte auf die Forschung
- Kontinuitäten und Brüche in der historischen Deutung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach Karls tatsächlichem Wunsch nach der Kaiserkrone vor, ausgehend von Einharts Aussage über Karls anfänglichen Widerwillen. Sie skizziert den Forschungsstand und die zwei gegensätzlichen Positionen (Karl als Kaiser wider Willen vs. geplante Kaiserkrönung). Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Sekundärliteratur ab 1828, da frühere Quellen keine direkte Bezugnahme auf vorherige wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit der Thematik bieten. Die Arbeit ist in drei Abschnitte gegliedert, die jeweils eine Periode der Geschichtsforschung abdecken.
Hauptteil: Die Analyse der Sekundärliteratur - 1828 bis zur Jahrhundertwende: Dieses Kapitel analysiert Heinrich Ludens Werk von 1828, welches erstmals die „Kaiser wider Willen“-Theorie diskutiert, ohne jedoch den Ursprung der These zu benennen. Luden argumentiert, dass Karl die Kaiserwürde bewusst anstrebte und die Gelegenheit beim Hilferuf Leos III. nutzte. Obwohl Luden die These einer in Paderborn geschmiedeten Kaiserkrönung aufstellt, räumt er die fehlende Quellenlage ein. Die Zusammenfassung der Position Ludens hebt die Schwierigkeit hervor, den Ursprung der These zu identifizieren und die damalige Deutung der Ereignisse zu beleuchten.
Hauptteil: Die Analyse der Sekundärliteratur - 1900 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges: (Hier muss der Inhalt des entsprechenden Kapitels aus dem Originaltext zusammengefasst werden. Mindestens 75 Wörter, detaillierte Analyse der Argumentationen, Beispiele und Verknüpfungen zu anderen Kapiteln und Thesen).
Hauptteil: Die Analyse der Sekundärliteratur - Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1994: (Hier muss der Inhalt des entsprechenden Kapitels aus dem Originaltext zusammengefasst werden. Mindestens 75 Wörter, detaillierte Analyse der Argumentationen, Beispiele und Verknüpfungen zu anderen Kapiteln und Thesen).
Schlüsselwörter
Karl der Große, Kaiserkrönung, Papst Leo III., „Kaiser wider Willen“-Theorie, Geschichtsschreibung, Sekundärliteraturanalyse, Forschungsgeschichte, 800 n. Chr., Römisches Reich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der "Kaiser wider Willen"-Theorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Forschungsdiskurs zur "Kaiser wider Willen"-Theorie um Karl den Großen von 1828 bis 1994. Sie untersucht die unterschiedlichen Positionen und Argumentationslinien der Historiker und die Entwicklung der Interpretation der Kaiserkrönung Karls im Jahr 800.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse einflussreicher Studien der Sekundärliteratur ab 1828, da frühere Quellen keine direkte Bezugnahme auf vorherige wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit der Thematik bieten. Die Analyse umfasst drei Perioden der Geschichtsforschung: 1828 bis zur Jahrhundertwende, 1900 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges und Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1994.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Das Ziel ist es, die Entwicklung der "Kaiser wider Willen"-These in der Geschichtsschreibung nachzuvollziehen. Die Arbeit analysiert die Argumentationen von Befürwortern und Kritikern der These, bewertet die Quellenlage und deren Interpretation und untersucht den Einfluss politischer und gesellschaftlicher Kontexte auf die Forschung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der "Kaiser wider Willen"-These, die Analyse der Argumentationen, die Bewertung der Quellenlage und deren Interpretation, den Einfluss von politischen und gesellschaftlichen Kontexten auf die Forschung sowie Kontinuitäten und Brüche in der historischen Deutung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit drei Unterkapiteln (jeweils eine Periode der Geschichtsforschung abdeckend) und einen Schlussteil mit Zusammenfassung und Schlussfolgerungen. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Forschungsstand dar. Der Hauptteil analysiert die Sekundärliteratur der drei Perioden. Der Schlussteil fasst die Ergebnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen.
Welche Rolle spielt Heinrich Luden in der Analyse?
Heinrich Ludens Werk von 1828 wird im ersten Kapitel des Hauptteils analysiert. Luden diskutiert die "Kaiser wider Willen"-Theorie, argumentiert jedoch, dass Karl die Kaiserwürde bewusst anstrebte und die Gelegenheit beim Hilferuf Leos III. nutzte. Die Analyse beleuchtet Ludens Argumentation und die Schwierigkeit, den Ursprung der These zu identifizieren.
Was wird in den Kapiteln zum Zeitraum 1900-1945 und 1945-1994 behandelt?
Die Kapitel zum Zeitraum 1900-1945 und 1945-1994 enthalten detaillierte Analysen der jeweiligen Sekundärliteratur. Sie beschreiben die Argumentationen der Historiker dieser Zeit, belegen diese mit Beispielen und stellen Verknüpfungen zu anderen Kapiteln und Thesen her (genaue Inhalte fehlen in diesem Preview).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Karl der Große, Kaiserkrönung, Papst Leo III., "Kaiser wider Willen"-Theorie, Geschichtsschreibung, Sekundärliteraturanalyse, Forschungsgeschichte, 800 n. Chr., Römisches Reich.
- Citation du texte
- Bert Rösch (Auteur), 1998, War Karl der Große ein Kaiser wider Willen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42687