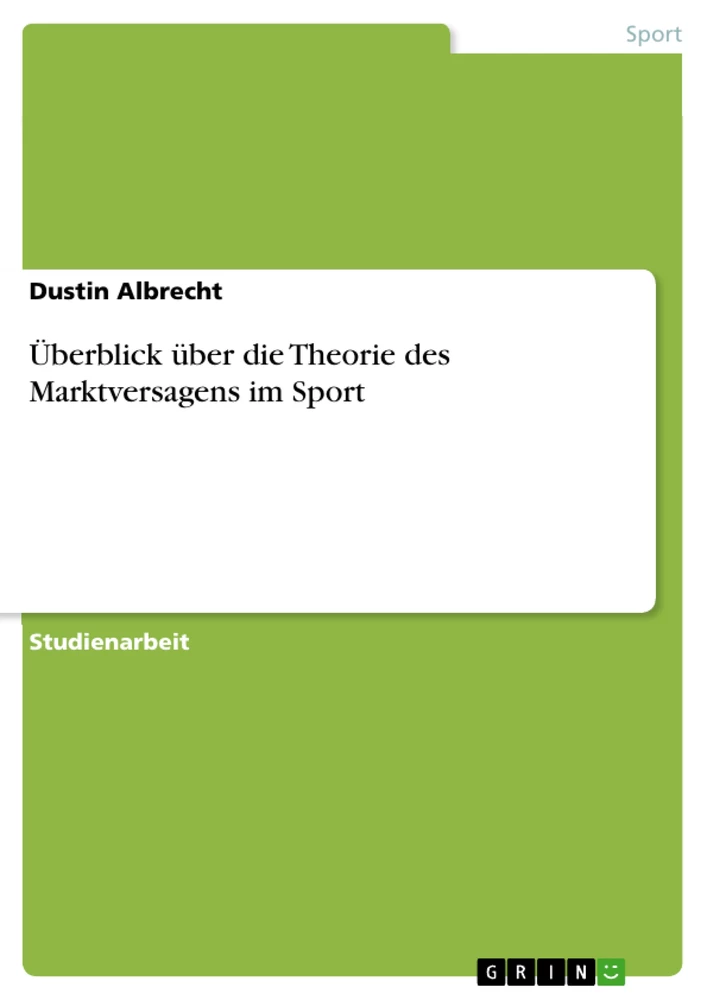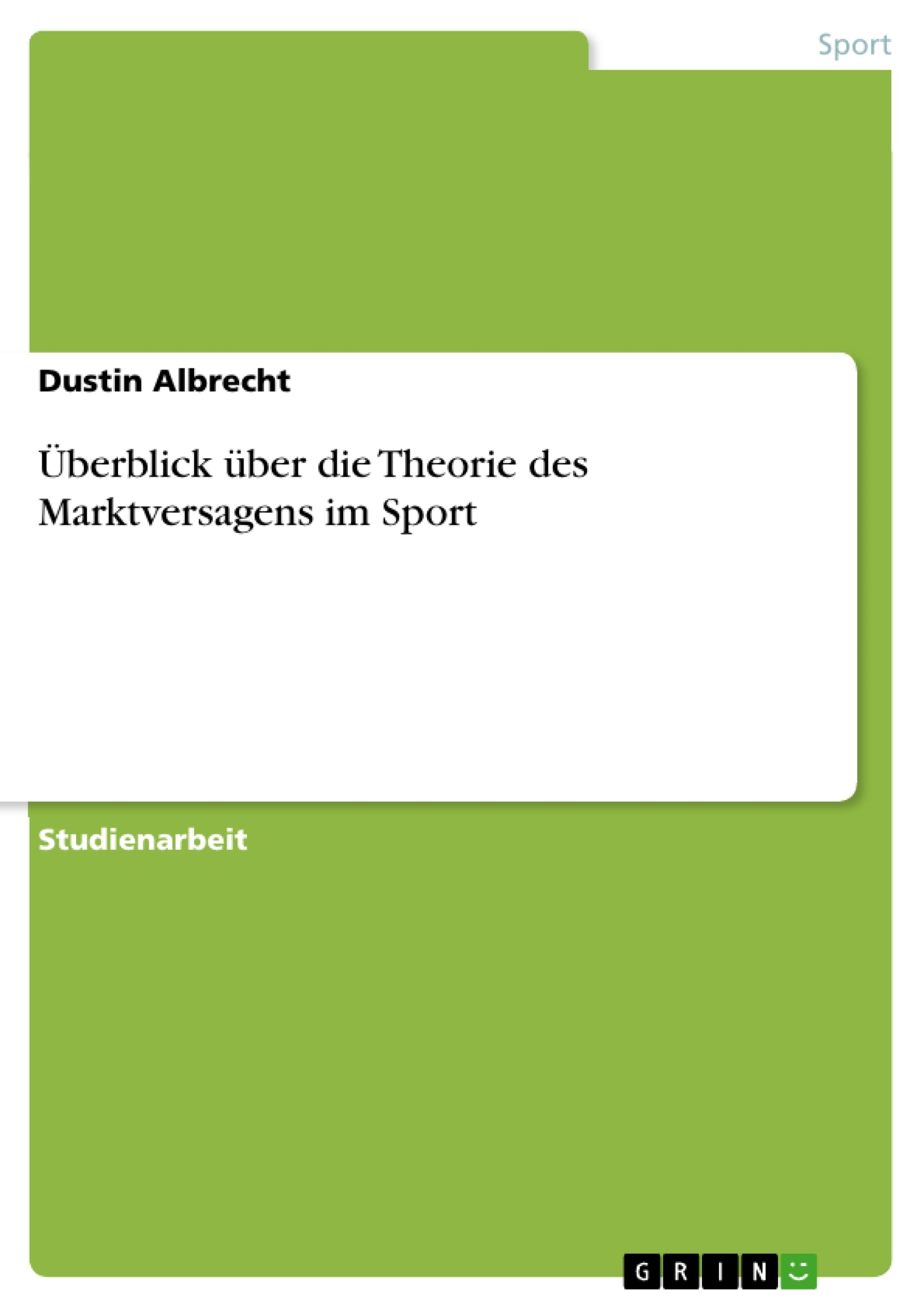Der Kern der nachfolgenden Hausarbeit beschäftigt sich mit der Theorie des Marktversagens im Sport. Anfangs erkläre ich den Begriff des Sportmarkts. Im Mittelpunkt des Abschnitts steht der Aufbau des Sportmarktes, sowie dessen Akteure. Im zweiten Teil der Hausarbeit geht es dann einleitend um eine allgemeine Definition des Marktversagen. Nachfolgend stehen die Ursachen für Marktversagen im Fokus, wobei externe Effekte, Unteilbarkeiten, natürliche Monopole, öffentliche Güter und Informationsmängel den Kern darstellen. In Abschnitt 3.4 den Informationsmängeln werden weitere Formen der Problematik erläutert. Hauptmerkmale sind die adverse Selektion, Moral-Hazard und der Prinzipal-Agent-Ansatz. Weiterhin beschäftigt sich die Hausarbeit mit dem Marktversagen im Sport. Hierbei stehen die zuvor genannten Ursachen im Mittelpunkt. Anschließend werden Lösungsmöglichkeiten bei Marktversagen aufgeführt. Das Ende der Hausarbeit stellt die Zusammenfassung und das Resümee dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Sportmarkt
- 3. Marktversagen
- 3.1 Externe Effekte
- 3.2 Unteilbarkeiten und natürliche Monopole
- 3.3 Öffentliche Güter
- 3.4 Informationsmängel
- 3.4.1 Adverse Selektion
- 3.4.2 Moral Hazard (Moralisches Risiko)
- 3.4.3 Prinzipal-Agent-Ansatz
- 3.4.4 Lösungsmöglichkeiten bei Marktversagen in Folge von Informationsmängeln
- 4: Theorie des Marktversagens im Sport
- 4.1 Externe Effekte im Sport
- 4.2 Öffentliche Güter im Sport
- 4.3 Natürliche Monopole im Sport
- 4.4 Informationsmängel im Sport
- 5. Lösungsmöglichkeiten bei Marktversagen im Sport
- 6. Zusammenfassung und Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Theorie des Marktversagens im Sport und untersucht die Ursachen und Folgen dieses Phänomens. Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise des Sportmarktes und die verschiedenen Arten von Marktversagen zu entwickeln.
- Definition und Analyse des Sportmarktes
- Die Ursachen für Marktversagen, insbesondere externe Effekte, Unteilbarkeiten, natürliche Monopole, öffentliche Güter und Informationsmängel.
- Die Anwendung der Marktversagenstheorie auf den Sportbereich, mit Fokus auf die oben genannten Ursachen im Kontext des Sports.
- Mögliche Lösungsansätze für Marktversagen im Sport.
- Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Relevanz des Sportmarktes und die Problematik des Marktversagens im Sport. Kapitel 2 definiert den Sportmarkt und gliedert ihn in den Sportler- und Zuschauermarkt ein. Es werden die jeweiligen Akteure und die Beziehung zwischen den Märkten dargestellt. Kapitel 3 erläutert die allgemeine Theorie des Marktversagens und beleuchtet verschiedene Ursachen wie externe Effekte, Unteilbarkeiten, natürliche Monopole, öffentliche Güter und Informationsmängel.
Kapitel 4 fokussiert auf die Anwendung der Marktversagenstheorie im Sport. Es werden Beispiele für externe Effekte, öffentliche Güter und natürliche Monopole im Sportbereich vorgestellt und die Besonderheiten der Informationsmängel im Sport erläutert. Das Kapitel 5 geht auf verschiedene Lösungsansätze für Marktversagen im Sport ein. Die Zusammenfassung in Kapitel 6 fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und stellt ein Resümee dar.
Schlüsselwörter
Sportmarkt, Marktversagen, externe Effekte, Unteilbarkeiten, natürliche Monopole, öffentliche Güter, Informationsmängel, adverse Selektion, Moral Hazard, Prinzipal-Agent-Ansatz, Lösungsmöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Marktversagen im Sport?
Marktversagen tritt auf, wenn der Sportmarkt keine effiziente Allokation der Ressourcen erreicht, beispielsweise durch externe Effekte oder Informationsmängel.
Was sind externe Effekte im Sport?
Dies sind Auswirkungen sportlicher Aktivitäten auf Unbeteiligte, wie etwa Lärmbelästigung durch Stadien (negativ) oder gesteigerte nationale Identität (positiv).
Warum gilt Sport oft als öffentliches Gut?
Einige Aspekte des Sports, wie die Übertragung von Großereignissen im Free-TV, weisen Merkmale von Nicht-Rivalität und Nicht-Ausschließbarkeit auf.
Was bedeutet „Moral Hazard“ im Sportmarkt?
Es beschreibt das Risiko, dass sich ein Akteur (z.B. ein Profisportler) nach Vertragsabschluss anders verhält als erwartet, da der Arbeitgeber sein Handeln nicht voll kontrollieren kann.
Wie kann man Marktversagen im Sport lösen?
Lösungsmöglichkeiten umfassen staatliche Interventionen, Zertifizierungen zur Reduktion von Informationsasymmetrien oder die Bildung von Ligen als regulierende Einheiten.
- Quote paper
- Dustin Albrecht (Author), 2017, Überblick über die Theorie des Marktversagens im Sport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/426882