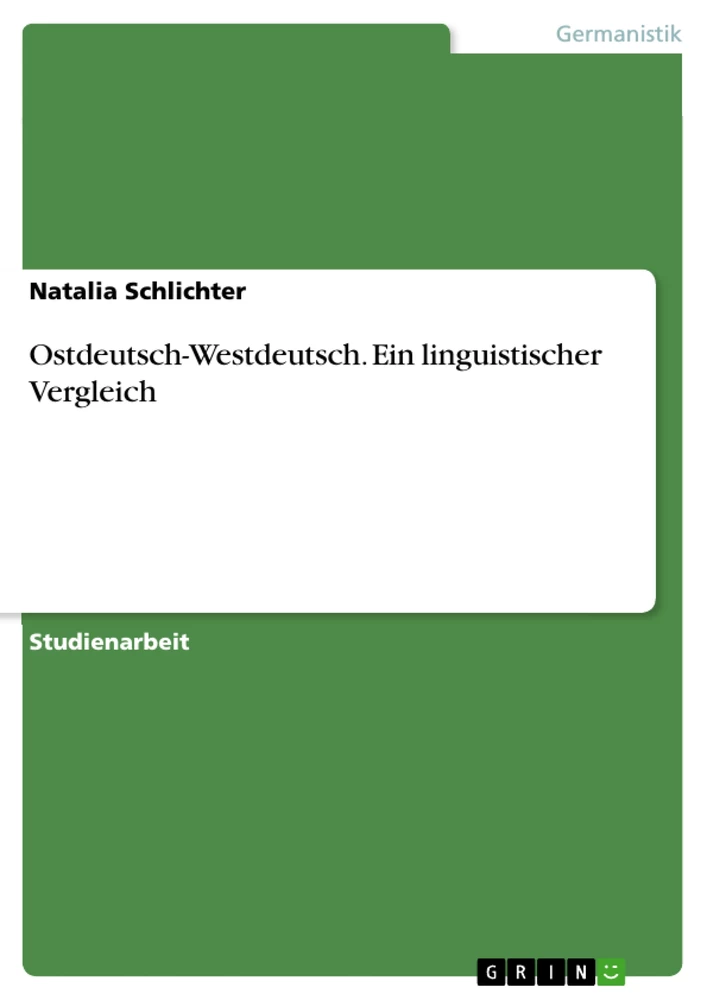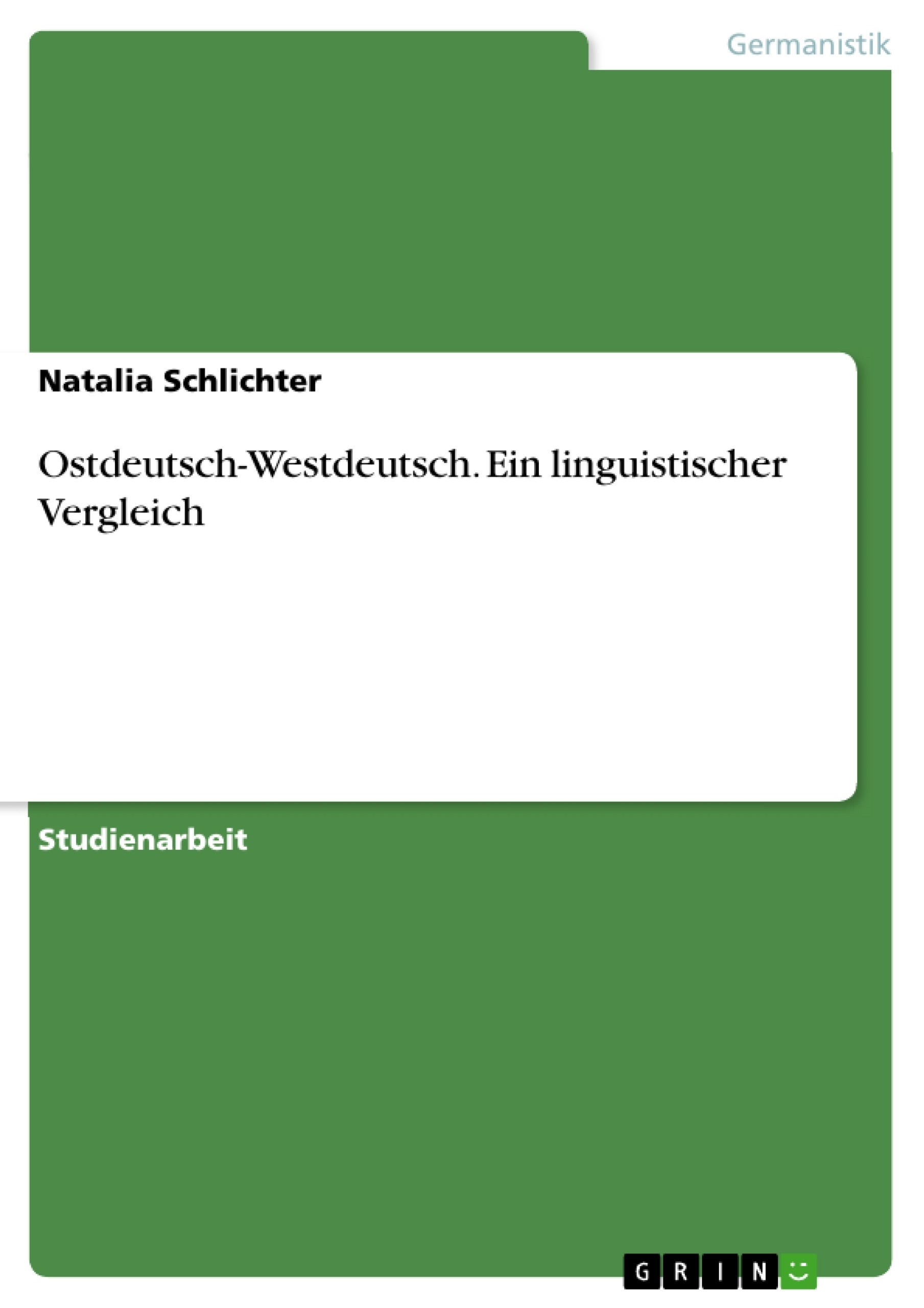1. Die Hintergründe der Sprachuntersuchungen in der Geschichte
Jede natürlich-historische Sprache hat die Eigenschaft sich im zeitlichen Verlauf zu verändern. Das ist durch ein großes sprachwissenschaftliches Interesse gekennzeichnet. Viele Möglichkeiten zur Untersuchung dieses Problems bietet die Geschichte selbst.
Seit der Entstehung zweier souveräner Staaten nach dem zweiten Weltkrieg - der kapitalistischen BRD und sozialistischen DDR - auf dem Territorium des ehemaligen Deutschen Reiches wurde von der Sprachwissenschaft ins Zentrum der Untersuchungen die Frage gestellt, welche Konsequenzen damit für die weitere Entwicklung der deutschen Sprache verbunden sind. Diese Frage wurde auf unterschiedlichste Weise beantwortet, was durch ihre politische Relevanz zu erklären ist. Zwei Fragen, zwei Aspekte stehen im Mittelpunkt der Ausführungen: zum Einen, die
,,Besonderheit der Sprache in einem der beiden Staaten, die durch die Konfrontation zur Sprache im jeweils anderen Staat gewonnen wurde, und zum Anderen, Man beschäftigte sich de facto, nämlich in bezug auf das zugrunde gelegte Corpus, mit der deutschen Sprache in einem der beiden Staaten." (Welke 1992, 1)
Zudem fällt auf, dass die Linguisten sich mehr mit der politischen Situation, als mit der Sprache selbst, bzw. mit den Unterschieden im Wortschatz, auseinandersetzen.
Nach Jahrzehnten der Zweitstaatlichkeit in Deutschland fand nun der umgekehrte Prozess statt. Seit dem 3.10.1990 existiert wieder eine vereinigte BRD, die eigentliche ,,alte BRD", der sich der andere Staat angeschlossen hat. Die frühere Deutsche Demokratische Republik ist als Staat aufgelöst. Damit erhebt sich nun die Frage nach den sprachlichen Konsequenzen dieses Prozesses.
Insbesondere im Vergleich zweier verschiedener Staaten mit der mehr oder weniger gleichen Sprache, wird allerdings die Problematik der Benennung dieser Spracherscheinung offenbar. Waren ,,Ost- und Westdeutsch" zwei Varietäten einer gemeinsamen Sprache? Oder waren die Unterschiede zwischen DDR- und BRD-Deutsch so groß, dass es eines anderen Begriffes bedarf, z. B. ,,Nationalsprache"?
In dieser Arbeit wird versucht, diese Fragen anhand einiger wissenschaftlicher Werke zu beantworten. Zuerst werden einige Arbeiten von DDR- und BRD - Linguisten betrachtet, die in verschiedenen Jahren ihre Meinungen zu diesem Problem geäußert haben. Allerdings lässt sich diese Frage ohne Untersuchung der Sprache selbst nicht beantworten. Als nächstes werden dementsprechend die wesentlichen Aspekte der Sprache vorgestellt, die diesen Entwicklungsabschnitt der deutschen Sprache charakterisieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Hintergründe der Sprachuntersuchungen in der Geschichte
- 2. Reflexion in der Linguistik
- 2.1. Warnung von einer Auseinanderentwicklung der Sprache in der BRD und DDR
- 2.2. Sonderung der DDR-Sprache
- 2.3. Einfluss der Politik auf die Sprache
- 2.4. Die Schwächung des politischen Drucks
- 3. Sprache in der DDR
- 3.1. Kernwortschatz des Marxismus
- 3.2. Neubenennungen
- 3.2.1. Typen der Benennungen nach dem benannten Objekt
- 3.2.2. Komplexe Benennungen, Kurzformen, Initialwörter
- 3.2.3. Hauptwege zur Schaffung von Neubenennungen: Neubedeutungen, Entlehnungen
- 3.3. Korrespondenz
- 3.4. Alltagssprachliche Kritik als Ausdruck eines symbolischen Gegendruckes gegen das System
- 3.5. Zwei Duden
- 4. Kommunikative Schwierigkeiten nach der Wiedervereinigung
- 5. Zwei Staaten, zwei Sprachen
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachlichen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland während der Teilung und die Folgen der Wiedervereinigung. Das Hauptziel ist es, die Entwicklung der deutschen Sprache in diesem Zeitraum zu analysieren und die Rolle politischer Einflüsse zu beleuchten.
- Sprachliche Entwicklung in Ost- und Westdeutschland während der Teilung
- Einfluss der Politik auf die Sprache in der DDR
- Unterschiede im Wortschatz und der Verwendung von Sprache
- Kommunikative Schwierigkeiten nach der Wiedervereinigung
- Die Frage nach der "Sonderung" der DDR-Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Hintergründe der Sprachuntersuchungen in der Geschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der sprachwissenschaftlichen Forschung im geteilten Deutschland. Es untersucht die Frage nach den Konsequenzen der Teilung für die deutsche Sprache und die unterschiedlichen Interpretationen dieser Frage, die stark von politischen Einflüssen geprägt waren. Die Diskussion konzentriert sich auf die "Besonderheit" der Sprache in Ost- und Westdeutschland und die Schwierigkeiten, diese sprachlichen Phänomene zu benennen und zu kategorisieren. Das Kapitel legt den Grundstein für die weitere Analyse, indem es die zentrale Forschungsfrage einführt: Waren Ost- und Westdeutsch zwei Varietäten einer gemeinsamen Sprache, oder handelte es sich um eigenständige Sprachformen?
2. Reflexion in der Linguistik: Dieses Kapitel analysiert die sprachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den sprachlichen Unterschieden zwischen Ost und West. Es beschreibt die unterschiedlichen Perspektiven der Linguistik in der BRD und der DDR, die jeweils von den politischen Rahmenbedingungen beeinflusst waren. Besonders hervorgehoben wird die Rolle der Politik in der DDR, die die sprachwissenschaftliche Forschung beeinflusste und sprachliche Kritik als politische Kritik interpretierte. Es werden verschiedene Phasen der sprachwissenschaftlichen Forschung in der DDR beschrieben, die von einer anfänglichen Warnung vor einer Auseinanderentwicklung der Sprache bis hin zur Feststellung von signifikanten Unterschieden reichen.
3. Sprache in der DDR: Dieses Kapitel widmet sich der detaillierten Beschreibung der Sprache in der DDR. Es untersucht den Einfluss des Marxismus auf den Wortschatz, die Entstehung neuer Begriffe und die Veränderungen in der sprachlichen Praxis. Die Analyse umfasst die Strategien zur Schaffung neuer Bezeichnungen, die sprachliche Korrespondenz und die Rolle der alltagssprachlichen Kritik als Ausdruck von Widerstand gegen das System. Der Einfluss des Russischen wird ebenfalls berücksichtigt. Das Kapitel liefert eine umfassende Darstellung der sprachlichen Besonderheiten der DDR.
4. Kommunikative Schwierigkeiten nach der Wiedervereinigung: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann aufgrund der fehlenden Textinformation nicht erstellt werden.)
5. Zwei Staaten, zwei Sprachen: (Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann aufgrund der fehlenden Textinformation nicht erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Ostdeutsch, Westdeutsch, Sprachentwicklung, DDR, BRD, Wiedervereinigung, Linguistik, Politik, Wortschatz, Sprachvariation, Sprachwandel, Ideologie, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Sprachentwicklung in Ost- und Westdeutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die sprachlichen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland während der Teilung und die Folgen der Wiedervereinigung. Sie analysiert die Entwicklung der deutschen Sprache in diesem Zeitraum und beleuchtet die Rolle politischer Einflüsse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die sprachliche Entwicklung in Ost- und Westdeutschland während der Teilung, den Einfluss der Politik auf die Sprache in der DDR, Unterschiede im Wortschatz und der Sprachverwendung, kommunikative Schwierigkeiten nach der Wiedervereinigung und die Frage nach der "Sonderung" der DDR-Sprache.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Die Hintergründe der Sprachuntersuchungen in der Geschichte; 2. Reflexion in der Linguistik; 3. Sprache in der DDR; 4. Kommunikative Schwierigkeiten nach der Wiedervereinigung; 5. Zwei Staaten, zwei Sprachen; 6. Literaturverzeichnis.
Was ist der Inhalt von Kapitel 1 ("Die Hintergründe der Sprachuntersuchungen in der Geschichte")?
Kapitel 1 beleuchtet die historische Entwicklung der sprachwissenschaftlichen Forschung im geteilten Deutschland, untersucht die Konsequenzen der Teilung für die deutsche Sprache und die unterschiedlichen, politisch geprägten Interpretationen dieser Frage. Es wird die "Besonderheit" der Sprache in Ost und West thematisiert und die Schwierigkeiten, diese sprachlichen Phänomene zu benennen und zu kategorisieren. Zentrale Forschungsfrage: Waren Ost- und Westdeutsch zwei Varietäten einer gemeinsamen Sprache, oder handelte es sich um eigenständige Sprachformen?
Was ist der Inhalt von Kapitel 2 ("Reflexion in der Linguistik")?
Kapitel 2 analysiert die sprachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den sprachlichen Unterschieden zwischen Ost und West und beschreibt die unterschiedlichen, politisch beeinflussten Perspektiven der Linguistik in der BRD und der DDR. Es wird die Rolle der Politik in der DDR hervorgehoben, die sprachwissenschaftliche Forschung beeinflusste und sprachliche Kritik als politische Kritik interpretierte. Es werden verschiedene Phasen der sprachwissenschaftlichen Forschung in der DDR beschrieben.
Was ist der Inhalt von Kapitel 3 ("Sprache in der DDR")?
Kapitel 3 beschreibt detailliert die Sprache in der DDR. Es untersucht den Einfluss des Marxismus auf den Wortschatz, die Entstehung neuer Begriffe und Veränderungen in der sprachlichen Praxis. Die Analyse umfasst Strategien zur Schaffung neuer Bezeichnungen, die sprachliche Korrespondenz und die Rolle der alltagssprachlichen Kritik als Ausdruck von Widerstand gegen das System. Der Einfluss des Russischen wird ebenfalls berücksichtigt.
Was ist der Inhalt von Kapitel 4 und 5?
Kapitel 4 und 5 ("Kommunikative Schwierigkeiten nach der Wiedervereinigung" und "Zwei Staaten, zwei Sprachen") konnten aufgrund fehlender Textinformationen nicht zusammengefasst werden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ostdeutsch, Westdeutsch, Sprachentwicklung, DDR, BRD, Wiedervereinigung, Linguistik, Politik, Wortschatz, Sprachvariation, Sprachwandel, Ideologie, Kommunikation.
- Quote paper
- Natalia Schlichter (Author), 2001, Ostdeutsch-Westdeutsch. Ein linguistischer Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/427