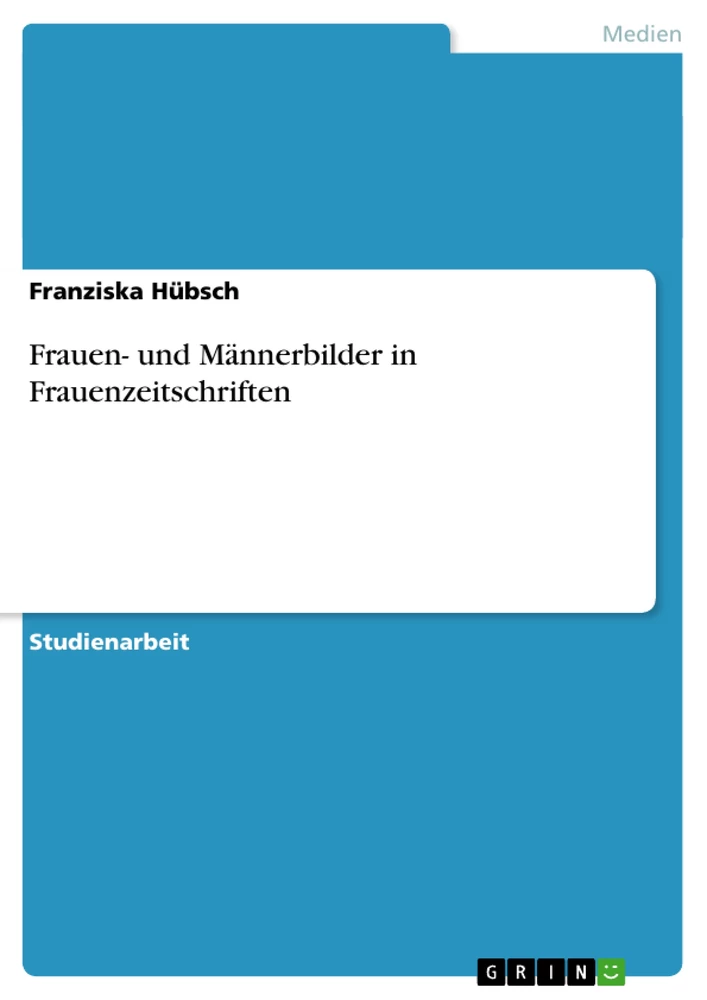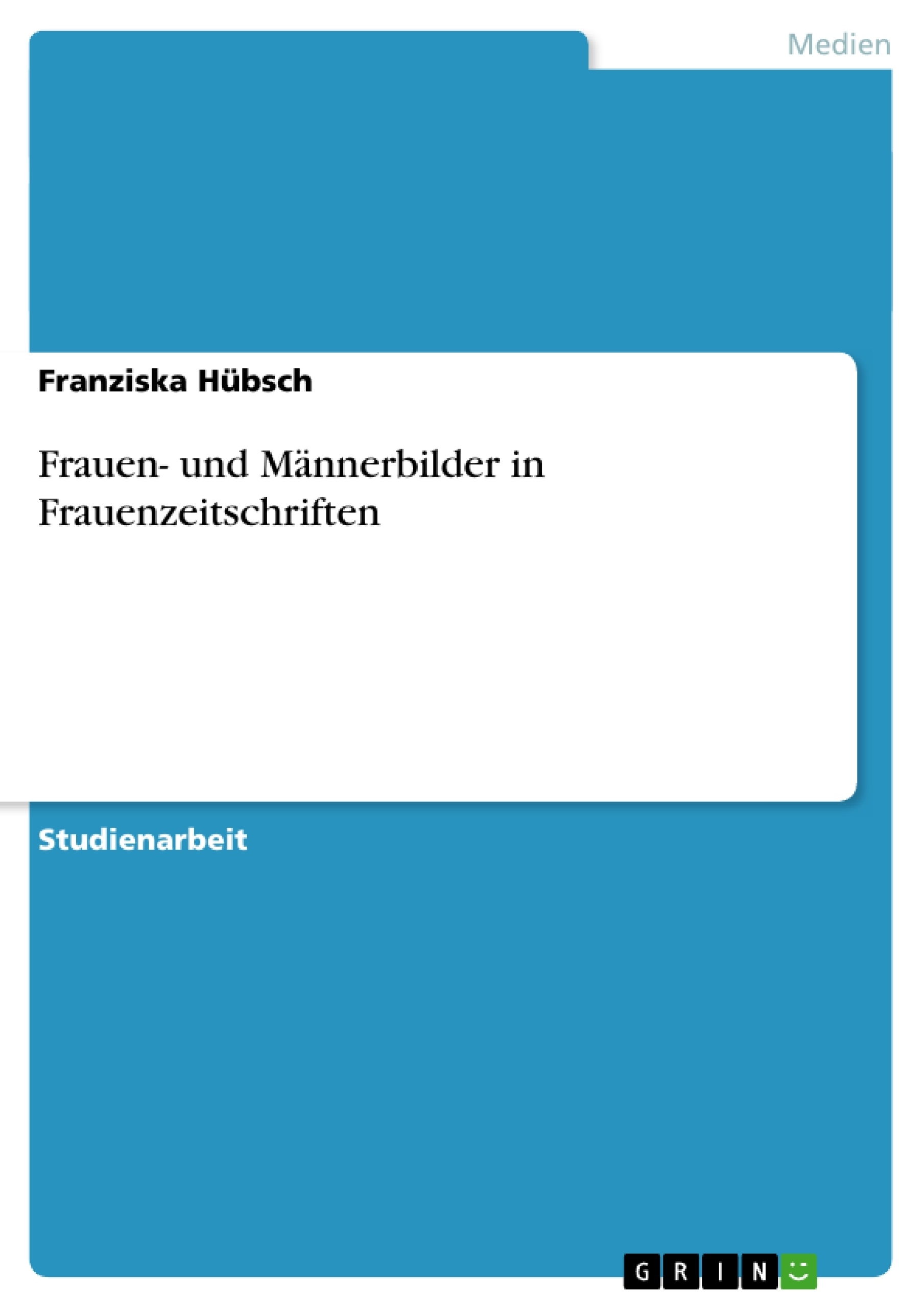Für den Begriff der Frauenzeitschrift ist es schwierig eine zufriedenstellende Definition zu finden. Schon bei der Klärung des allgemeineren Begriffs „Zeitschrift“ gibt es bis heute in der Kommunikationswissenschaft bzw. in der Zeitschriftenforschung Schwierigkeiten. So sagt Bruno Tietz zu dieser Problematik:
„Alle lesen sie, keiner kann sie verbindlich definieren. Zeitschriften sind ´ von Natur aus ´ undefinierbar. Das einzige Gemeinsame: Sie werden unter dem Begriff ´Zeitschriften´ in den Statistiken geführt – ansonsten sind sie so vielfältig wie das Leben selbst.“
Des öfteren sind Versuche unternommen worden, den Begriff der „Zeitschrift“ zu definieren. Daraus sind viele verschiedene Definitionsversuche entstanden, da teilweise unterschiedliche Kriterien benutzt bzw. im Laufe der Zeit Neue ergänzt wurden. Dennoch, ist, wie schon erwähnt, noch keine absolut zufriedenstellende Definition gewonnen worden. Faktoren, bei den vielen verschieden Definitionsversuchen für die Klärung des Begriffs, sind u.a. gewesen: Periodizität, Kontinuität, Publizität und Aktualität.
Betrachtet man den enger gefassten Begriff der „Frauenzeitschrift“ gibt es ebenfalls viele Versuche eine befriedigende Definition zu finden. Jedoch haben wir auch hier Schwierigkeiten die „richtigen“ Kriterien zu finden, die die Frauenzeitschrift exakt charakterisieren. Im Laufe der Jahre wurden viele Definitionen entwickelt und auch weiterentwickelt. Anfänglich wurde hauptsächlich das Kriterium des Rezipientinnenkreises erwähnt:
„Women´s magazines are defined as those magazines whose content and advertising is aimed primarily at a female audience and at female areas of concern and competence, as customarily defined in our culture.“
Jedoch ist es überholt zu behaupten, dass ausschließlich Frauen Rezipienten der Frauenzeitschriften sind. Es kann ebenfalls belegt werden, dass ein nicht geringer Teil der Leserschaft aus Männern besteht. Ein Beispiel hierfür ist die Frauenzeitschrift Brigitte, die von 260 000 Männern gelesen wird (Stand 2003).
Inhaltsverzeichnis
- Begriffserläuterung
- Begriff „Frauenzeitschrift“
- Geschichte
- Typologie
- Analyse anhand von Beispielen
- Formale Analyse
- Rubriken der Inhaltsverzeichnisse im Vergleich
- Art und Umfang der Werbung
- Analyse der Artikel
- Männer in Frauenzeitschriften
- Redaktionsstruktur
- Zusammenfassung
- Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Analyse von Frauenzeitschriften, wobei der Fokus auf die Darstellung von Frauen- und Männerbildern liegt. Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung der Frauenzeitschriften und ihre Funktion in der Gesellschaft zu beleuchten.
- Entwicklung der Frauenzeitschrift
- Darstellung von Frauen- und Männerbildern in Frauenzeitschriften
- Analyse der Inhalte und der Werbebotschaften
- Rolle der Frauenzeitschrift in der weiblichen Emanzipation
- Funktion der Frauenzeitschrift in der heutigen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Begriffserläuterung: Das Kapitel beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs „Frauenzeitschrift“ und beleuchtet die Schwierigkeiten, eine eindeutige Definition zu finden. Die verschiedenen Definitionen werden vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.
- Geschichte: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die historische Entwicklung der Frauenzeitschriften, beginnend mit den ersten Impulsen im 18. Jahrhundert in England. Die Entstehung der Moralischen Wochenschriften und ihre Weiterentwicklung zu Frauenzimmer-Journalen werden beschrieben.
Schlüsselwörter
Frauenzeitschriften, Geschlechterrollen, Medienanalyse, Medienkritik, Emanzipation, Werbung, Inhalte, Rezipienten, Geschichte, Typologie, Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was genau versteht man unter dem Begriff Frauenzeitschrift?
Es ist schwierig, eine allgemeingültige Definition zu finden. Traditionell werden sie als Zeitschriften definiert, deren Inhalte und Werbung sich primär an ein weibliches Publikum und frauentypische Interessen richten. Die Kommunikationswissenschaft weist jedoch darauf hin, dass die Grenzen oft fließend sind.
Werden Frauenzeitschriften ausschließlich von Frauen gelesen?
Nein, das ist ein veraltetes Vorurteil. Ein beachtlicher Teil der Leserschaft ist männlich. Beispielsweise wurde die Zeitschrift „Brigitte“ laut Daten von 2003 von etwa 260.000 Männern gelesen.
Welche Kriterien definieren eine Zeitschrift in der Forschung?
Wichtige Faktoren zur Klärung des Begriffs sind Periodizität (regelmäßiges Erscheinen), Kontinuität, Publizität und Aktualität.
Wie haben sich Frauenzeitschriften historisch entwickelt?
Erste Impulse gab es im 18. Jahrhundert in England. Es entstanden moralische Wochenschriften, die sich später zu den sogenannten „Frauenzimmer-Journalen“ weiterentwickelten.
Welche Rolle spielen Männerbilder in Frauenzeitschriften?
Die Darstellung von Männern ist ein zentraler Analysepunkt. Frauenzeitschriften spiegeln nicht nur Frauenbilder wider, sondern thematisieren auch Rollenbilder und Erwartungen an Männer in der Gesellschaft.
Welche Funktion haben Frauenzeitschriften in der heutigen Gesellschaft?
Sie dienen der Unterhaltung, Information und Identitätsstiftung. Zudem spielen sie eine Rolle im Kontext der weiblichen Emanzipation und reflektieren aktuelle gesellschaftliche Geschlechterrollen.
- Quote paper
- Franziska Hübsch (Author), 2004, Frauen- und Männerbilder in Frauenzeitschriften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42710