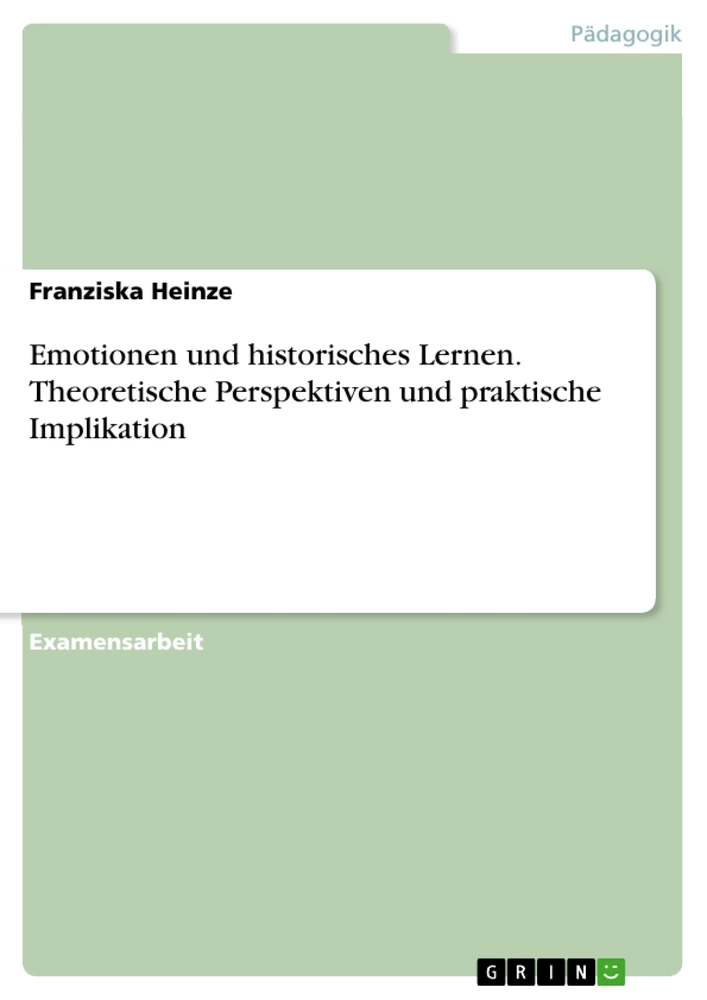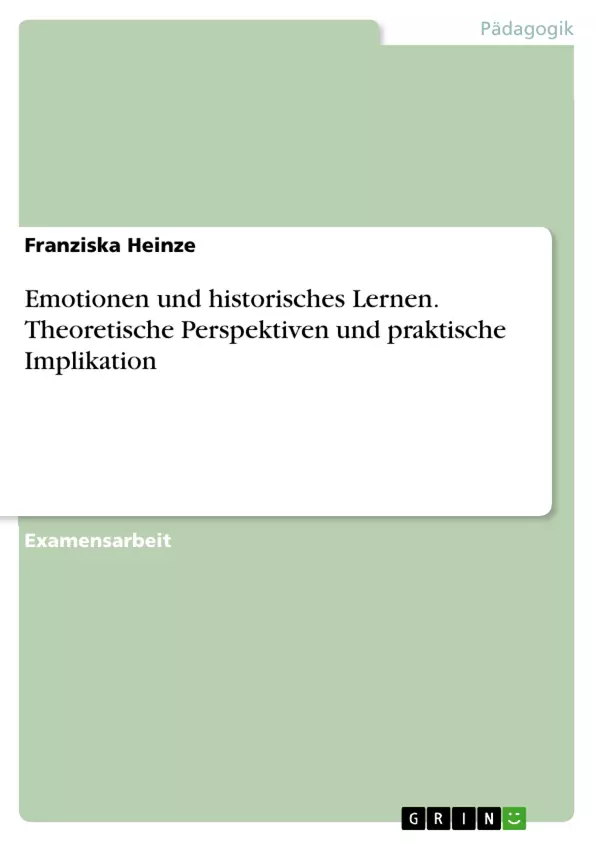Wie empfinden Schüler beim Umgang mit einer Schriftquelle? Davor muss zunächst jedoch geklärt werden, welche Quelle, die die Emotionen in der Vergangenheit repräsentiert, zur Bearbeitung für die Schülerinnen und Schüler ausgewählt wird. Daraus entstehen wiederum Fragen: Wer denkt in der Quelle, wie geht es ihm und warum hat die Lehrkraft diese Quelle ausgewählt und wie wird sie in den Unterricht eingebettet?
Durch Vorgaben der Lehrkraft hinsichtlich zu erwartender Emotionen besteht die Gefahr, dass die Schülerinnen und Schüler, die mutmaßlich vom Lehrer erwarteten oder vermuteten, Emotionen simulieren. Sind die Wahrnehmungen der Schüler kongruent zu den in der Vergangenheit ermittelten Emotionen oder stehen sie möglicherweise in einem Gegensatz? Eventuell werden bestimmte Emotionen gar nicht wahrgenommen, da die Schüler die Situation anders bewerten als der Verfasser der Quelle oder vielleicht entstehen Emotionen, mit denen die Lehrkraft nicht rechnet.
Da eine Quelle nicht ohne jeglichen Kontext, sondern didaktisch aufbereitet von den Schülern bearbeitet wird, ist es unerlässlich, die Lehrkraft in diese Überlegungen einzubeziehen. Werden Gefühle von der Lehrkraft vorweggenommen und implizieren möglicherweise eine soziale Erwünschtheit? Interessant dabei scheint vor allem, welche Vorstellung eine Lehrkraft bezüglich Emotionen im Geschichtsunterricht, im Speziellen einer zu behandelnden Quelle, hat und wie diese Vorstellungen sich zu den Emotionen der Schüler verhalten. Dies entspricht also den Erwartungen der Lehrkraft an die in der Quelle enthaltenden und bei den Schülern entstehenden Emotionen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Pädagogische Verankerung von Emotionen im Geschichtsunterricht
- 3. Forschungsstand
- 3.1 Aspekte der Emotionsforschung
- 3.1.1 Strukturierung und Abgrenzung des Emotionsbegriffs
- 3.1.2 Erfassung von Emotionen
- 3.2 Aspekte der Geschichtsdidaktik
- 3.2.1 Der Emotionsbegriff und seine Dimensionen in der Geschichtsdidaktik
- 3.2.2 Potenzial und Gefahren im Geschichtsunterricht
- 4. Empirische Befunde
- 5. Zielstellung der Arbeit
- 6. Eine Schriftquelle als Grundlage für die Erforschung von Emotionen
- 6.1 Quellenanalyse hinsichtlich enthaltener Emotionen
- 6.2 Didaktisches Potenzial und Einbettung in den Geschichtsunterricht
- 7. Methodenbeschreibung
- 7.1 Experteninterview
- 7.1.1 Forschungstradition und Erhebungsinstrument
- 7.1.2 Ablauf
- 7.1.3 Auswertung
- 7.2 Fragebogen
- 7.2.1 Forschungstradition
- 7.2.2 Operationalisierung
- 7.2.3 Erhebungsinstrument
- 7.2.4 Stichprobe
- 7.2.5 Untersuchungsablauf
- 7.2.6 Statistische Analyseverfahren
- 8. Auswertung
- 8.1 Auswertung des Experteninterviews
- 8.2 Auswertung der Fragebogenerhebung
- 8.3 Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der Quellenanalyse, des Experteninterviews sowie der Fragebogenerhebung
- 9. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle von Emotionen im Geschichtsunterricht. Ziel ist es, theoretische Perspektiven auf Emotionen im historischen Lernen zu beleuchten und praktische Implikationen für den Unterricht zu entwickeln. Die Untersuchung verknüpft dabei Erkenntnisse der Emotionsforschung und Geschichtsdidaktik.
- Der Einfluss von Emotionen auf das Verständnis und die Verarbeitung historischer Inhalte.
- Die didaktische Nutzung von emotionsgeladenen Quellen im Geschichtsunterricht.
- Die Relevanz emotionaler Kompetenz von Schülern und Lehrern im Geschichtsunterricht.
- Die Herausforderungen der Erforschung der Emotionalität historischen Lernens.
- Die Analyse der Kongruenz zwischen den in einer Quelle repräsentierten Emotionen und den von Schülern wahrgenommenen Emotionen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Rolle von Emotionen im Geschichtsunterricht. Sie diskutiert die Bedeutung von Emotionen für das historische Lernen, basierend auf der Arbeit von Ute Frevert und anderen Autoren. Die Einleitung benennt die Forschungslücke bezüglich empirischer Belege zu Emotionen im Lernprozess und formuliert zentrale Forschungsfragen, die sich auf die subjektive, objektive und die im Lern-/Lehrprozess situierte Emotionsebene beziehen. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Analyse einer Schriftquelle, Lehrer- und Schülerbefragungen umfasst.
2. Pädagogische Verankerung von Emotionen im Geschichtsunterricht: Dieses Kapitel verankert die Bedeutung von Emotionen im Geschichtsunterricht, beginnend mit dem historischen Bezug auf Pestalozzi. Es wird die Relevanz von Emotionen in Lernprozessen betont und die Herausforderung thematisiert, dass Emotionen historisch veränderlich und kulturell geprägt sind. Die Arbeit betont die Schwierigkeit, die Emotionen historischer Akteure direkt zu erfassen und die Rolle von Vermittlungsinstanzen wie Geschichtsbücher. Das Kapitel verweist auf den Begriff der emotionalen Kompetenz und deren Bedeutung für den Umgang mit Emotionen im Geschichtsunterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Emotionen im Geschichtsunterricht
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle von Emotionen im Geschichtsunterricht. Sie beleuchtet theoretische Perspektiven auf Emotionen beim historischen Lernen und entwickelt praktische Implikationen für den Unterricht. Die Untersuchung verknüpft Erkenntnisse der Emotionsforschung und Geschichtsdidaktik.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von Emotionen auf das Verständnis und die Verarbeitung historischer Inhalte, der didaktischen Nutzung emotionsgeladener Quellen, der Relevanz emotionaler Kompetenz von Schülern und Lehrern, den Herausforderungen der Erforschung der Emotionalität historischen Lernens und der Analyse der Kongruenz zwischen in einer Quelle repräsentierten und von Schülern wahrgenommenen Emotionen.
Welche Forschungsfragen werden gestellt?
Die Arbeit formuliert zentrale Forschungsfragen, die sich auf die subjektive, objektive und die im Lern-/Lehrprozess situierte Emotionsebene beziehen. Die genaue Formulierung dieser Fragen ist im Text der Einleitung zu finden, jedoch nicht explizit hier aufgeführt.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative und quantitative Forschungsmethode. Es werden Experteninterviews mit Lehrern geführt und Fragebögen an Schüler verteilt, um Daten zu sammeln. Darüber hinaus wird eine schriftliche Quelle hinsichtlich der darin enthaltenen Emotionen analysiert. Die Auswertung der Daten beinhaltet statistische Analyseverfahren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Einleitung, ein Kapitel zur pädagogischen Verankerung von Emotionen, ein Kapitel zum Forschungsstand, ein Kapitel zu empirischen Befunden, die Zielstellung, ein Kapitel zur Analyse einer Schriftquelle und deren didaktisches Potenzial, die Methodenbeschreibung, die Auswertung der Daten und schließlich einen Ausblick. Jedes Kapitel ist detailliert im Inhaltsverzeichnis aufgeführt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Arbeiten von Ute Frevert und anderen Autoren zur Emotionsforschung und Geschichtsdidaktik. Eine spezifische Schriftquelle wird analysiert, um Emotionen zu untersuchen und ihr didaktisches Potenzial im Geschichtsunterricht zu erörtern. Die genauen Quellenangaben sind nicht im FAQ enthalten, aber im Haupttext der Arbeit ersichtlich.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Auswertung umfasst die Analyse des Experteninterviews, die Auswertung der Fragebogenerhebung und den Vergleich der Ergebnisse mit der Quellenanalyse. Die genauen Ergebnisse werden im Kapitel "Auswertung" detailliert dargestellt und sind hier nicht zusammengefasst.
Was ist das Fazit/der Ausblick?
Der Ausblick fasst die Ergebnisse zusammen und gibt Hinweise auf weitere Forschungsfragen und -möglichkeiten. Dieser Abschnitt ist im Text enthalten aber im FAQ nicht detailliert wiedergegeben.
Welche Bedeutung hat die Arbeit?
Die Arbeit leistet einen Beitrag zum Verständnis der Rolle von Emotionen im Geschichtsunterricht. Sie liefert Erkenntnisse für die Praxis und fördert die Entwicklung von methodischen Ansätzen, um Emotionen im Geschichtsunterricht gezielt einzusetzen.
- Arbeit zitieren
- Franziska Heinze (Autor:in), 2018, Emotionen und historisches Lernen. Theoretische Perspektiven und praktische Implikation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/427219