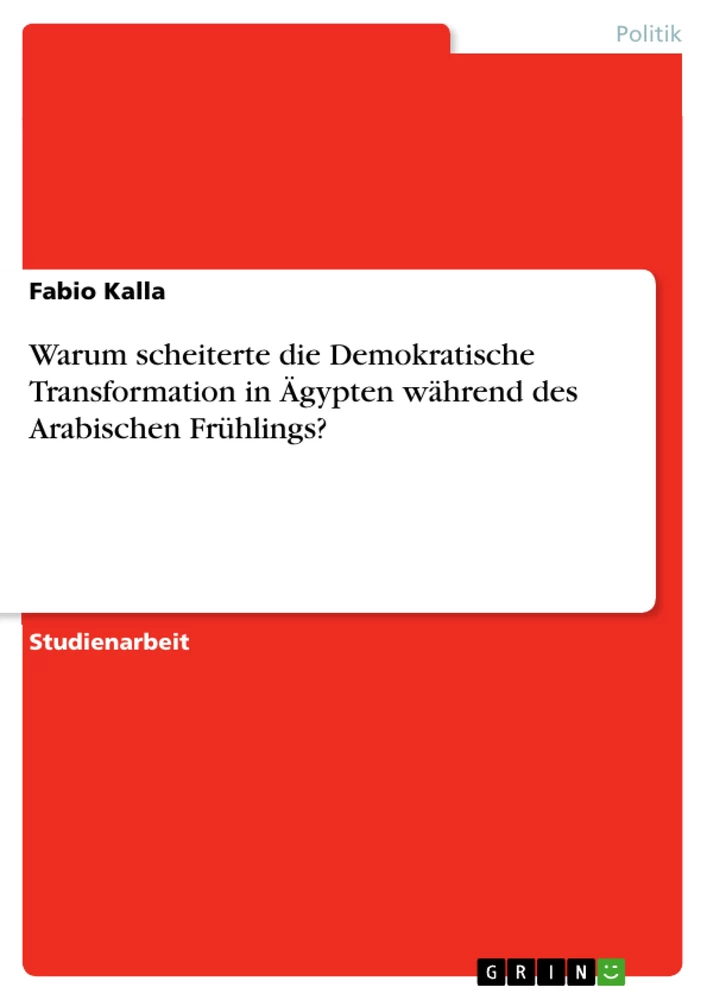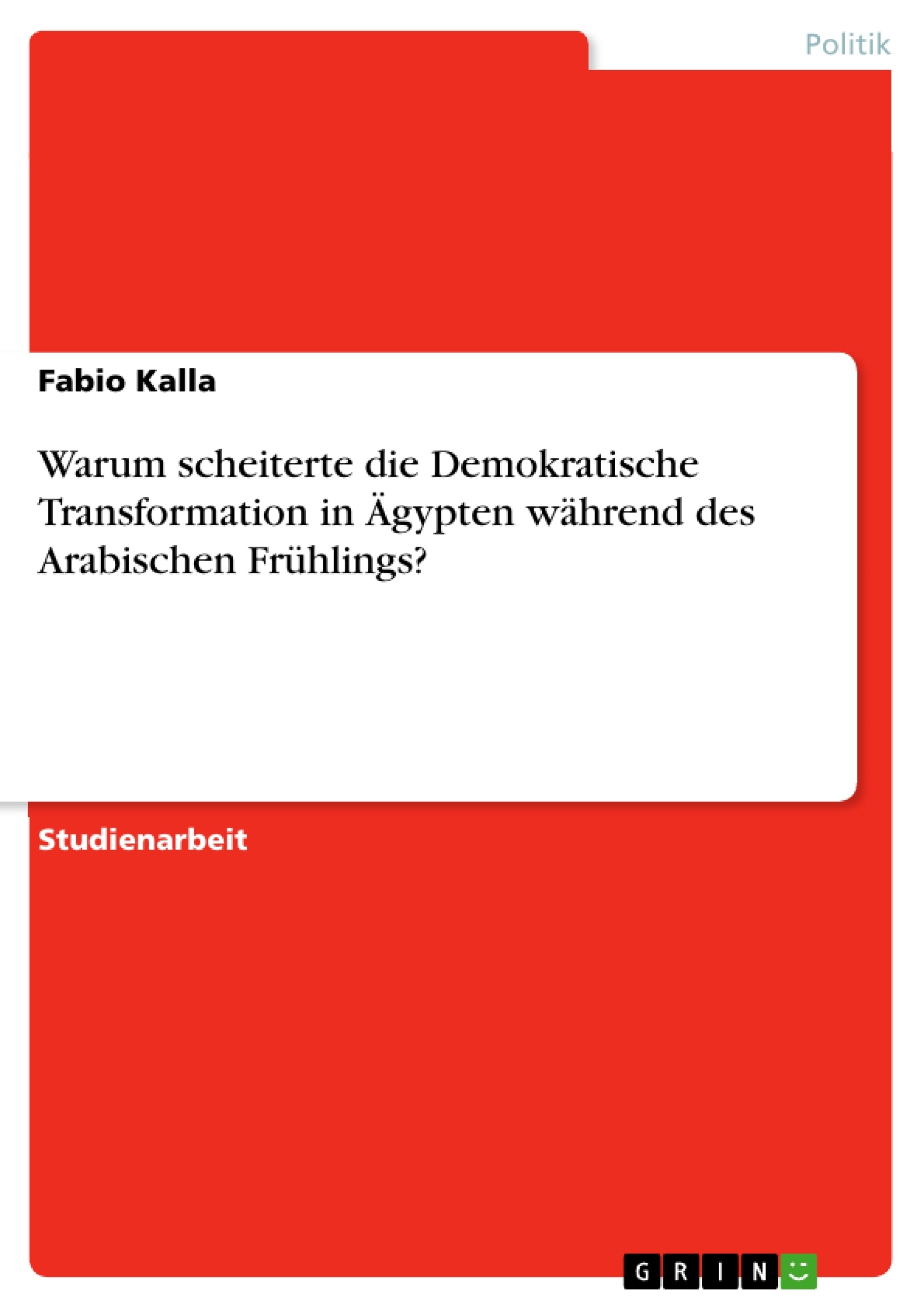Im Januar 2011 gehen Demonstranten in ganz Ägypten auf die Straße, um gegen ihren Präsidenten Husni Mubarak zu protestieren. Die Ideale von Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus und Demokratie breiten sich wie eine Welle über das Land aus. Nach 18 Tagen haben die Protestierenden ihr Ziel erreicht: Mubarak tritt von seinem Amt zurück und legt die Regierungskompetenzen in die Arme des Obersten Rates der Streitkräfte, der einen demokratischen Wandel verspricht. Sechs Jahre später scheint der Traum von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und politischer Teilhabe bereits vorbei zu sein. Der Alltag ist in Ägypten eingekehrt, mit seinem Misstrauen, Verhaftungen und der Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Wie konnte es soweit kommen? Warum scheiterte die demokratische Transformation in Ägypten während des sogenannten Arabischen Frühlings? Welche Akteure sind für die Rückkehr zu einem politischen System mit autoritären Zügen verantwortlich? Diesen Fragen wird die vorliegende Hausarbeit nachgehen. Dabei lautet die These, dass einerseits der fehlende Pakt zwischen den Eliten in der Post-Mubarak-Ära und andererseits die mangelnde demokratische Verfasstheit der handelnden Akteure dem Demokratisierungsprozess ein jähes Ende bereitete. Verglichen mit Tunesien gab es keine aktive Einbindung aller relevanten gesellschaftlichen Gruppen in die Konsolidierung der Demokratie, stattdessen war die Demokratisierung top-down verordnet und war von den Eigeninteressen des Militärs durchzogen, weswegen es die Belange der Bevölkerung konterkarierte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen der Analyse
- Oppositionelle Akteure in Ägypten
- Der Beginn der Proteste bis zum Sturz Mubaraks
- Die Akteure des Protests
- Akteurskonstellation in der Post-Mubarak-Ära
- Die Rolle des Militärs im Transformationsprozess
- Die Muslimbruderschaft an der Macht
- Amtszeit al-Sisis
- Eine Zusammenfassung des Transformationsprozesses
- Gründe für den Ausgang
- Zwischen defekter Demokratie und Autoritarismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gescheiterte demokratische Transformation in Ägypten während des Arabischen Frühlings. Sie analysiert die Akteure und die Elitenkonstellation in der Post-Mubarak-Ära und deren Einfluss auf den Transformationsprozess. Die Arbeit untersucht die Rolle des Militärs, der Muslimbruderschaft und der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen im Übergangsprozess.
- Die Rolle des Militärs in der politischen Transformation
- Der Einfluss der Muslimbruderschaft auf den Demokratisierungsprozess
- Die Ursachen für das Scheitern der Demokratisierung
- Die Bedeutung von Elitenpakten für die Stabilität von Demokratien
- Die Rolle der Massenmobilisierung in Transformationsprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor, indem sie die Proteste in Ägypten im Januar 2011 und den Sturz von Husni Mubarak beschreibt. Sie stellt die zentrale Frage nach den Ursachen für das Scheitern der demokratischen Transformation und skizziert die These der Arbeit, dass der fehlende Pakt zwischen den Eliten und die mangelnde demokratische Verfasstheit der handelnden Akteure zum Scheitern des Demokratisierungsprozesses geführt haben.
Theoretischer Rahmen der Analyse
Dieses Kapitel erklärt den Begriff "Transformation" und beschreibt die Phasen der demokratischen Transformation. Es stellt die deskriptiv-empirische Akteurstheorie vor, die den Fokus auf das Handeln von Eliten in Transformationsprozessen legt und die Bedeutung von Elitenpakten für die Stabilität von Demokratien hervorhebt.
Oppositionelle Akteure in Ägypten
Dieses Kapitel beleuchtet die Oppositionellen in Ägypten, die an den Protesten beteiligt waren, und geht auf die Entwicklungen vor und nach dem Sturz Mubaraks ein.
Akteurskonstellation in der Post-Mubarak-Ära
Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Militärs und der Muslimbruderschaft in der Post-Mubarak-Ära und deren Einfluss auf den Transformationsprozess.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der demokratischen Transformation, Elitenkonstellation, Militär, Muslimbruderschaft, Arabischer Frühling, Ägypten und Akteurstheorie.
- Quote paper
- Fabio Kalla (Author), 2017, Warum scheiterte die Demokratische Transformation in Ägypten während des Arabischen Frühlings?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/427316