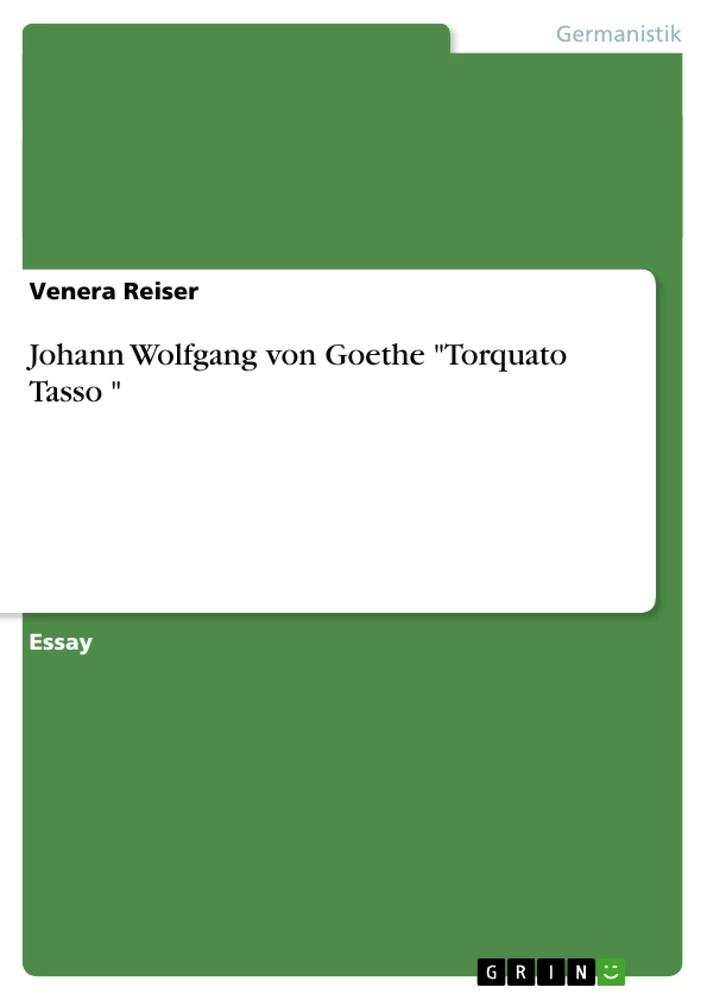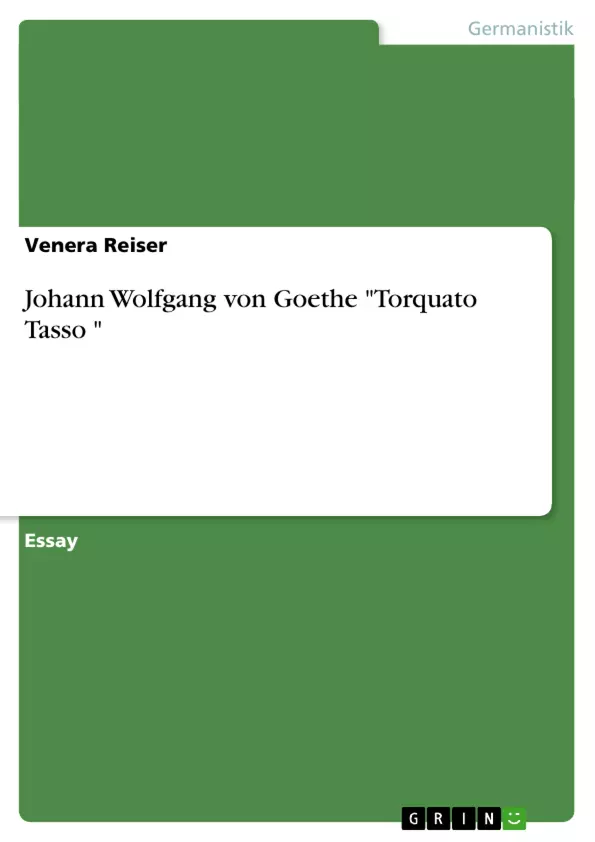Schon in seiner Kindheit, (schreibt er in „Dichtung und Wahrheit“) hat Goethe die Biographie Tassos gelesen. Er begann 1780 mit der Arbeit an dem Stück. Die erste Fassung schrieb er zunächst in Prosa und unterbrach das Schreiben 1781 wieder. Den Antrieb, das Stück weiterzuschreiben, erhielt er zwischen 1786 und 1788 auf seiner ersten Italienreise, die ihm das unvollendete Werk wieder nahebrachte. Ende Juli 1789 stellte er schließlich die Endfassung in Blankversen (fünffüßige Jamben) fertig und 1790 erschien das Buch erstmals. “Torquato Tasso“ wird als eines seiner tiefgehenden Dramen bezeichnet, ist aber auch durch die Umarbeitungen eines seiner Zwiespältigen.
Zweifellos verarbeitete Goethe im Tasso seine eigenen Erfahrungen am Weimarer Hof. Und ebenfalls nach dem Bericht Eckermanns sagte Goethe auf die Frage, >>welche Idee<< er darin zur Anschauung zu bringen gesucht habe:
„Idee?[...] dass ich nicht wüsste! Ich hatte das Leben Tassos, ich hatte meine eigenes Leben, und indem zwei so wunderliche Figuren mit ihren Eigenheiten zusammentraf, entstand in mir das Bild des Tasso, dem ich als prosaischen Kontrast den Antonio entgegenstellte, wozu es mir auch nicht an Vorbildern fehlte. Die weiteren Hof-, Lebens- und Liebesverhältnisse waren übrigens in Weimar wie in Ferrara, und ich kann mit Recht von meiner Darstellung sagen: sie ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch“; (Goethe zu Eckermann,6.Mai 1827)
Sicher ist Tasso eines der Stücke Goethes, in denen äußerlich am wenigsten geschieht. So ist die Sprache weniger Mittel als eigentlicher Gegenstand des Dramas; das nahezu gänzliche Fehlen einer Handlung ist Absicht. Denn der Gegensatz von Handeln und Sprechen, von Tat und Kunst ist das eigentliche Thema des Stücks.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Goethes Beschäftigung mit Tasso und Entstehung des Dramas
- Kapitel 2: Goethes Verarbeitung eigener Erfahrungen und die Idee des Stücks
- Kapitel 3: Tasso als historische Figur und Parallelen zu Goethe
- Kapitel 4: Aufbau des Dramas, Schauplatz und Handlung
- Kapitel 5: Der Konflikt zwischen Kunst und Realität
- Kapitel 6: Tasso und die Romantik: Die Bewahrung der Realität
- Kapitel 7: Die Tragödie des Dichters und die Disproportion des Talents
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Goethes Drama „Torquato Tasso“ und beleuchtet dessen Entstehungsgeschichte, die Verarbeitung autobiografischer Elemente und die zentralen Konflikte des Werks. Es wird die Beziehung zwischen der künstlerischen Schaffenskraft Tassos und den gesellschaftlichen Zwängen am Hofe Ferraras analysiert.
- Die Entstehung und Entwicklung von Goethes „Torquato Tasso“
- Der Konflikt zwischen künstlerischer Selbstverwirklichung und gesellschaftlichen Erwartungen
- Die Parallelen zwischen Goethes Leben und der Figur des Tasso
- Die Darstellung des Verhältnisses zwischen Kunst und Realität
- Die Frage nach der „Tragödie des Dichters“
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Goethes Beschäftigung mit Tasso und Entstehung des Dramas: Dieses Kapitel beschreibt Goethes frühen Kontakt mit der Biografie Tassos und die mehrphasige Entstehung des Dramas. Es beleuchtet die Unterbrechungen des Schreibprozesses und den Einfluss der Italienreise auf die Vollendung des Werks. Die Entwicklung von der ersten Prosa-Fassung bis zur endgültigen Blankvers-Version wird nachvollzogen, wobei die Bedeutung dieser verschiedenen Phasen für die Entwicklung der Thematik hervorgehoben wird. Das Kapitel betont die lange Entstehungszeit und die damit verbundene intensive Auseinandersetzung Goethes mit dem Thema.
Kapitel 2: Goethes Verarbeitung eigener Erfahrungen und die Idee des Stücks: Hier wird Goethes Aussage zu Eckermann, wonach das Drama aus der Verbindung seines eigenen Lebens und dem Tassos entstanden sei, eingehend untersucht. Die Parallelen zwischen Goethes Erfahrungen am Weimarer Hof und Tassos Leben in Ferrara werden herausgearbeitet, um die autobiografischen Elemente des Dramas aufzuzeigen. Das Kapitel analysiert, wie Goethe seine eigenen Konflikte zwischen künstlerischer Selbstverwirklichung und den Anforderungen der höfischen Gesellschaft in der Figur des Tasso verarbeitet. Der Fokus liegt auf der Frage nach der „Idee“ des Stücks und der verweigerten einfachen Deutung.
Kapitel 3: Tasso als historische Figur und Parallelen zu Goethe: In diesem Kapitel wird die historische Figur Torquato Tasso vorgestellt, sein Leben, sein Werk und seine psychischen Probleme. Es wird detailliert auf die Parallelen zwischen Tassos Leben und Goethes eigenen Erfahrungen eingegangen, besonders hinsichtlich des sensiblen und melancholischen Charakters, der Liebesbeziehungen und der Schwierigkeiten, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Die Ähnlichkeiten zwischen Tassos Schicksal und Goethes eigener Lebenssituation werden als Grundlage für die Identifikation und die dramatische Entwicklung des Stückes erläutert. Die Beschreibung Tassos als Geisteskranken und sein Tod werden im Kontext der Darstellung in Goethes Drama analysiert.
Kapitel 4: Aufbau des Dramas, Schauplatz und Handlung: Der klassische Aufbau des Dramas in fünf Aufzügen wird erläutert, wobei betont wird, dass die seelischen Vorgänge im Vordergrund stehen, während die äußere Handlung eher im Hintergrund bleibt. Das Kapitel beschreibt den Schauplatz Belriguardo und die Bedeutung der einzelnen Szenen. Die Schlüsselbegebenheiten werden analysiert, wie die Überreichung des Epos und die Bekränzung mit dem Lorbeerkranz. Der Fokus liegt auf der Analyse der Interaktionen der Figuren und deren Auswirkung auf Tassos seelischen Zustand. Die klassische Einheit von Ort, Zeit und Handlung wird im Kontext des Gesamtwerks diskutiert.
Kapitel 5: Der Konflikt zwischen Kunst und Realität: Dieser Abschnitt analysiert den zentralen Konflikt des Dramas: die Diskrepanz zwischen Tassos künstlerischer Welt und der Realität des höfischen Lebens. Die unterschiedlichen Sichtweisen Antonios und der Prinzessin werden verglichen, um das Missverständnis zwischen Kunst und höfischer Realität zu verdeutlichen. Tassos Reaktion auf die Zurückweisung durch Antonio und seine zunehmende Isolation werden im Detail beleuchtet. Der Bruch zwischen der ästhetischen Welt Tassos und der pragmatischen Haltung des Hofes wird als Kern des Konflikts dargestellt.
Kapitel 6: Tasso und die Romantik: Die Bewahrung der Realität: Dieses Kapitel untersucht Goethes „Tasso“ im Kontext der Romantik und differenziert dessen Position dazu. Es wird argumentiert, dass Goethe im Gegensatz zur Romantik die Realität und deren Gültigkeit beibehält. Die Bedeutung der gesellschaftlichen Realität als Gegenüber für den Dichter wird analysiert, und der Unterschied zu einer romantischen Entwertung der Wirklichkeit wird herausgestellt. Goethes Bewahrung der Realität wird als Schlüsselfaktor für das Verständnis des Dramas und seines zentralen Konflikts erläutert.
Kapitel 7: Die Tragödie des Dichters und die Disproportion des Talentes: Der Schlussabschnitt analysiert die "Tragödie des Dichters" in Goethes "Tasso" und seine Aussage zur "Disproportion des Talents mit dem Leben". Die Interpretation des Talentes als eine sowohl auszeichnende als auch belastende Gabe wird detailliert dargestellt. Der Konflikt zwischen Tassos schöpferischer Kraft und den Anforderungen der höfischen Gesellschaft wird analysiert und in den Kontext der menschlichen Tragik eingeordnet. Goethes eigene Worte über sein Werk werden herangezogen, um die komplexe Beziehung zwischen Talent und Leben zu interpretieren. Die "Disproportion" wird nicht nur als Konflikt des Individuums mit der Gesellschaft, sondern auch als innerer Konflikt innerhalb des Individuums dargestellt.
Schlüsselwörter
Goethe, Torquato Tasso, Künstlerdrama, Hofgesellschaft, Kunst und Realität, Selbstverwirklichung, Disproportion des Talents, Autobiografische Elemente, Romantik, Tragödie des Dichters.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Torquato Tasso"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Goethes Drama "Torquato Tasso" umfassend. Sie untersucht die Entstehungsgeschichte, die Verarbeitung autobiografischer Elemente und die zentralen Konflikte des Werks. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Konflikt zwischen künstlerischer Selbstverwirklichung und gesellschaftlichen Erwartungen, der Beziehung zwischen Kunst und Realität und der "Tragödie des Dichters".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem einzelnen Kapitel?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Kapitel 1 behandelt Goethes Beschäftigung mit Tasso und die Entstehung des Dramas, inklusive der verschiedenen Fassungen. Kapitel 2 analysiert die Verarbeitung autobiografischer Elemente und die "Idee" des Stücks. Kapitel 3 beleuchtet die historische Figur Tassos und die Parallelen zu Goethe. Kapitel 4 beschreibt den Aufbau des Dramas, den Schauplatz und die Handlung. Kapitel 5 konzentriert sich auf den Konflikt zwischen Kunst und Realität. Kapitel 6 untersucht die Beziehung zwischen "Tasso" und der Romantik. Schließlich analysiert Kapitel 7 die "Tragödie des Dichters" und die "Disproportion des Talents".
Welche Schlüsselthemen werden in "Torquato Tasso" behandelt?
Schlüsselthemen sind der Konflikt zwischen künstlerischer Selbstverwirklichung und gesellschaftlichen Erwartungen, die Beziehung zwischen Kunst und Realität, die "Tragödie des Dichters", die Verarbeitung autobiografischer Elemente, und die Auseinandersetzung mit der Romantik (im Vergleich zu Goethes Ansatz).
Wie werden Goethes eigene Erfahrungen in "Torquato Tasso" verarbeitet?
Die Arbeit argumentiert, dass Goethe seine eigenen Erfahrungen am Weimarer Hof und seine Konflikte zwischen künstlerischer Selbstverwirklichung und den Anforderungen der höfischen Gesellschaft in der Figur des Tasso verarbeitet hat. Parallelen zwischen Goethes Leben und dem Leben Tassos werden detailliert herausgearbeitet.
Welche Rolle spielt der Konflikt zwischen Kunst und Realität in "Torquato Tasso"?
Der Konflikt zwischen Tassos künstlerischer Welt und der Realität des höfischen Lebens ist der zentrale Konflikt des Dramas. Die unterschiedlichen Sichtweisen der Figuren und Tassos zunehmende Isolation aufgrund dieses Konflikts werden analysiert.
Wie positioniert sich "Torquato Tasso" im Kontext der Romantik?
Die Arbeit argumentiert, dass Goethe im Gegensatz zur Romantik die Realität und deren Gültigkeit beibehält. Der Unterschied zu einer romantischen Entwertung der Wirklichkeit wird herausgestellt.
Was ist die "Tragödie des Dichters" in "Torquato Tasso"?
Die "Tragödie des Dichters" bezieht sich auf den Konflikt zwischen Tassos schöpferischer Kraft und den Anforderungen der höfischen Gesellschaft, sowie auf den inneren Konflikt innerhalb des Individuums, der durch die "Disproportion des Talents" entsteht – die Belastung und die Auszeichnung, die mit außergewöhnlichem Talent einhergehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Goethe, Torquato Tasso, Künstlerdrama, Hofgesellschaft, Kunst und Realität, Selbstverwirklichung, Disproportion des Talents, Autobiografische Elemente, Romantik, Tragödie des Dichters.
- Arbeit zitieren
- Venera Reiser (Autor:in), 2001, Johann Wolfgang von Goethe "Torquato Tasso ", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42754