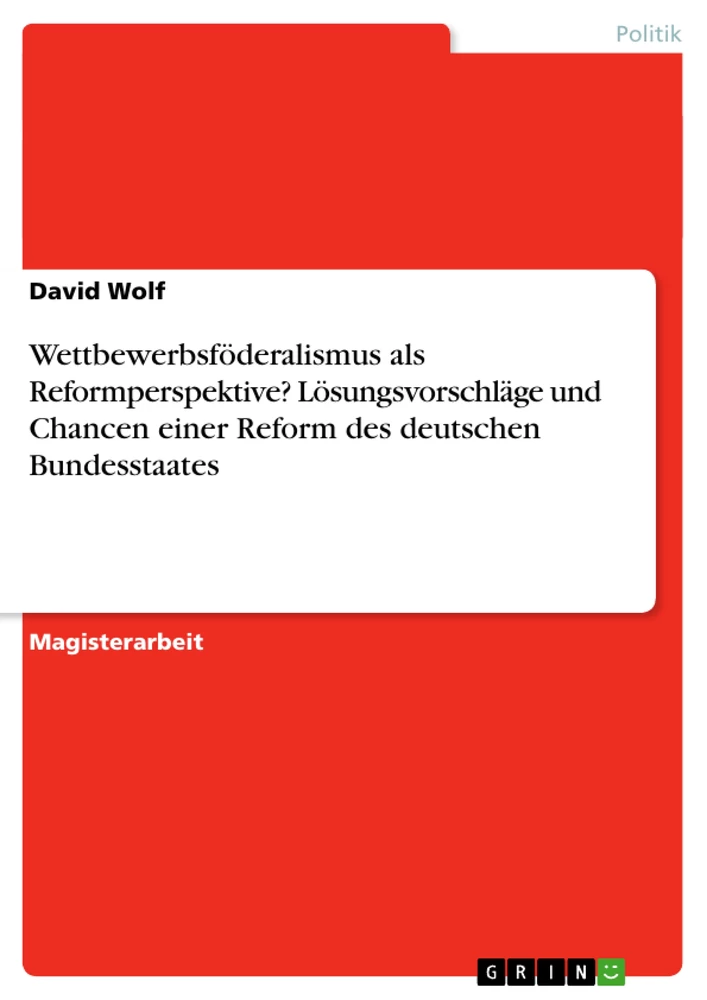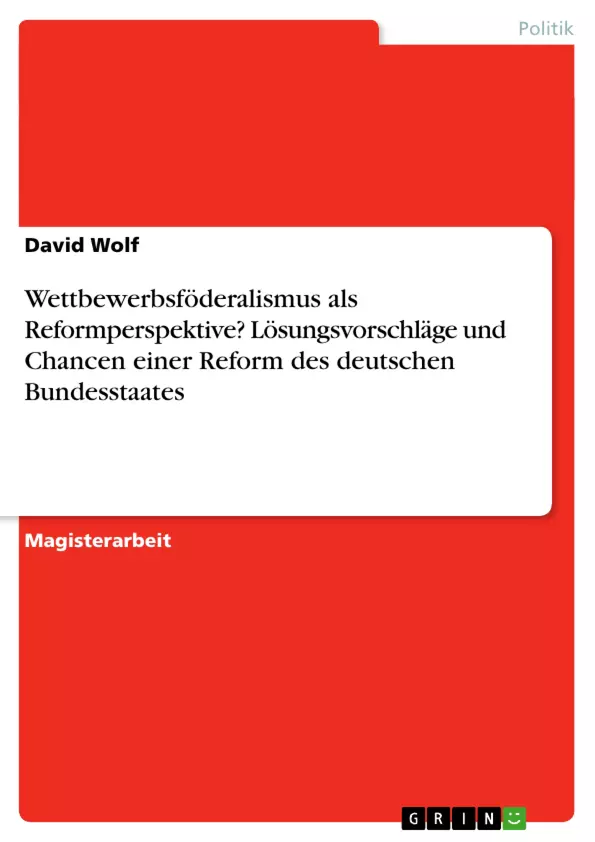Es sollte der große Wurf werden, doch letztlich hat es nicht gereicht. Am Ende des vergangenen Jahres (2004) erklärten die Vorsitzenden der im Oktober des Jahres 2003 eingerichteten gemeinsamen Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Franz Müntefering und der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU), die Föderalismusreform offiziell für gescheitert. Hauptgrund war der Kompetenzstreit zwischen Bund und Ländern um die Bildungspolitik. Umso bedauerlicher, hatten sich doch beide Ebenen bereits in anderen wesentlichen Reformbereichen bis zur Beschluss- reife geeinigt. So galt in der Kommission unter anderem das d’accord, die Bestimmungen des EU-Stabilitätspaktes ins Grundgesetz aufzunehmen und die Länder bei einer Ver-letzung der Defizitobergrenze an Strafzahlungen zu beteiligen. Doch schlussendlich patzten die Politiker „bei der ‚Mutter aller Reformen’“ . Das Scheitern der Bemühungen rief sowohl auf Seiten der Politik als auch der Wirtschaft Bestürzung und Bedauern hervor. Bundespräsident Horst Köhler nannte das Ergebnis „kein Ruhmesblatt für die Politik“ , während der scheidende Präsident des Bundesverbandes der Industrie (BDI), Michael Rogowski, „den Fehlschlag ‚blamabel für Deutschland’“ hält.
Doch wie soll und vor allem wie kann es nun weitergehen? Der deutsche Föderalismus ist reformbedürftig. Darin stimmen Politiker von Bund und Ländern überein und dieser Befund wird auch von Wissenschaftlern, die sich mit der Bundesstaatlichkeit in Deutschland befassen, geteilt. Auch der Bundespräsident hat sich der Sache verschrieben: „Das Thema interessiert ihn seit Amtsbeginn (...). Köhler hat sich entschlossen, das ganze Gewicht seines Amtes in die Waagschale zu werfen.“ Das sieht man auf Seiten der beiden großen Parteien ähnlich. „Das Scheitern der Kommission ‚kann nicht das letzte Wort gewesen sein’, mahnte CDU-Chefin Angela Merkel (...) in einem Brief an alle Mandatsträger der Partei. Mit einem Neubeginn dürfe man nicht bis zum nächsten Jahr warten, erklärte auch Bundeskanzler Gerhard Schröder.“ Und schenkt man den Ankündigungen der FDP Glauben, so möchten die Liberalen als Reaktion auf das Scheitern alsbald einen Vorstoß in Richtung eines Verfassungskonvents unternehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I. Einleitung und Methodik der Arbeit
- A. Einleitung
- B. Zum Begriff des Wettbewerbsföderalismus
- 1. Versuch einer Operationalisierung
- 2. Die ökonomische Theorie des Föderalismus als ideengeschichtlicher Hintergrund
- 2.1 Der Rational-Choice-Ansatz
- 2.2 Grundlagen eines wettbewerbsorientierten Föderalismus
- Teil II. Kooperativer Föderalismus und Wettbewerbsföderalismus – Praxis und Ideal
- A. Die Praxis: Unitarisch-kooperativer Föderalismus im Grundgesetz
- 1. Die Große Finanzreform von 1969 - die institutionalisierte Kooperation
- 1.1 Entstehungszusammenhang
- 1.2 Ergebnisse der Finanzreform
- 2. Zentrale Institutionen der bundesdeutschen Finanzverfassung
- 2.1 Aufgaben- und Ausgabenverteilung (Art. 104a GG)
- 2.1.1 Das Konnexitätsprinzip als Grundsatz
- 2.1.2 Ausnahmen
- 2.2 Kompetenzen zur Steuergesetzgebung (Art. 105 GG)
- 2.3 Die vertikale Verteilung der Steuererträge (Art. 106 GG)
- 2.3.1 Das Trennsystem (Art. 106 Abs. 1 und 2 GG)
- 2.3.2 Das Verbundsystem (Art. 106 Abs. 3 GG)
- 2.4 Das System des Finanzausgleichs (Art. 107 GG)
- 2.4.1 Der horizontale Finanzausgleich zwischen den Ländern (Länderfinanzausgleich)
- 2.4.1.1 Länderfinanzausgleich im weiteren Sinne (Art. 107 Abs. 1 GG)
- 2.4.1.2 Länderfinanzausgleich im engeren Sinne (Art. 107 Abs. 2 S. 1 GG)
- 2.4.2 Der vertikale Finanzausgleich - die Bundesergänzungszuweisungen (Art. 107 Abs. 2 S. 3 GG)
- 2.4.2.1 Fehlbetrags-BEZ
- 2.4.2.2 Sonderbedarfs-BEZ
- B. Die Theorie: Reformszenarien für eine Neuausrichtung der föderalen Ordnung
- I. Vorschläge aus dem politischen Raum
- 1. Position der Bundesregierung
- 2. Position der Länderregierungen
- 3. Position der Länderparlamente – der „Föderalismuskonvent“
- 4. Reformkonzepte parteinaher Stiftungen und Einrichtungen
- 4.1 Konrad-Adenauer-Stiftung
- 4.2 Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen (BACDJ)
- 4.3 Friedrich-Naumann-Stiftung
- 5. Reformkonzepte parteiunabhängiger Stiftungen
- 5.1 Bertelsmann Stiftung
- 5.2 Stiftung Marktwirtschaft
- 6. Stiftungsallianz „Bürgernaher Bundesstaat“
- II. Reformkonzepte aus dem Wirtschafts- bzw. finanzwissenschaftlichen Bereich
- 1. Abmilderung der Fehlanreize des Finanzausgleichs durch Abbau - der Grenzbelastungen – eine Reformstudie
- 1.1 Darstellung der Zahlungen im Finanzausgleich 1999
- 1.2 Darstellung der Grenzbelastungen im Finanzausgleich 1999
- 1.3 Reformvorschlag
- 2. „Begrenzte Steuerautonomie“ der Länder eine Studie des ifo-Instituts -
- 2.1 Begrenztes Zuschlags- oder Abschlagsrecht der Länder
- 2.2 Effizienzverbesserung bei der Mischfinanzierung
- 3. Getrennte Aufgaben- und Steuerverteilung zwischen Bund und Ländern
- 3.1 Vorschlag für die Aufgaben- (Ausgaben-)Verteilung
- 3.2 Gebundenes Trennsystem bei der Steuerverteilung eine Simulation
- 3.3 Ergebnisse des Simulationsmodells
- 3.4 Realisierbarkeit des Konzepts
- 4. Reformvorschläge des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)
- 4.1 Eindeutige Zuordnung von Staatsaufgaben, Finanzverantwortung und Steuereinnahmen
- 4.2 Abschaffung von Gemeinschaftsaufgaben und Mischfinanzierung
- 4.3 Zurückführung des Länderfinanzausgleichs
- 5. Position der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
- 5.1 Entflechtung bei der Gesetzgebung
- 5.2 Stärkung der Länderautonomie und Neuordnung des Länderfinanzausgleichs
- 6. Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
- 6.1 Vorschläge zur Steuerentflechtung
- 6.2 Abbau von Mischfinanzierungen
- III. Reformüberlegungen von Seiten der politikwissenschaftlichen Forschung
- 1. Die Agenda einer realisierbaren Föderalismusreform bei Fritz W. Scharpf
- 1.1 Experimentierklauseln für die Bundesländer
- 1.2 Einführung eines systematischen Leistungsvergleichs für die Lösungen der Länder
- 1.3 Zur Reform der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern
- 2. Die Reform der Finanzbeziehungen bei Arthur Benz
- 2.1 Wichtige Funktionen der Gemeinschaftsaufgaben
- 2.2 Beibehaltung der Aufgaben- bzw. Ausgabenverteilung im Grundgesetz
- 2.3 Finanzhilfen nicht generell ausschließen
- 3. Modernisierung durch eine Korrektur des Status quo
- 3.1 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
- 3.2 Neugliederung des Bundesgebietes
- 3.3 Neuverteilung von Gesetzgebungskompetenzen
- 3.4 Auflösung von Verflechtungstatbeständen
- 4. Lernen von den Nachbarn? Die Rolle von „best practice“-Modellen
- 5. Das Modell des kooperativen Wettbewerbsföderalismus und die indirekte Entflechtung
- 6. Zusammenfassung der Reformvorschläge
- Teil III. Die Reformierbarkeit des deutschen Föderalismus - Wettbewerbsföderalismus als bloßes Symbol oder tatsächlich machbar?
- A. Ergebnisse bisheriger Reformbemühungen
- B. Institutionelle Widerstandspotenziale und Blockademöglichkeiten
- 1. Parteienwettbewerb als Hemmnis für Reformen
- 1.1 Die Rolle des Parteienwettbewerbs bei Gerhard Lehmbruch
- 1.2 Die Rolle der Parteien im Reformprozess bei Arthur Benz
- 2. Vetospieler im Reformprozess -
- 2.1 Vetospieler Wahlrecht – die Notwenigkeit zur Koalitionsbildung
- 2.2 Vetospieler Bundesrat
- 2.3 Vetospieler Bundesverfassungsgericht
- 3. Die „Politikverflechtungsfalle“
- 3.1 Politikverflechtung im deutschen Bundesstaat
- 3.2 Die Theorie der Politikverflechtung
- 4. Der historisch-institutionelle Ansatz - Pfadabhängigkeit gewachsener Strukturen
- 5. Der akteursorientierte Ansatz - Handeln aus politischen Eigeninteressen
- 6. Der rational-psychologische Ansatz – die Angst vor unkalkulierbaren Risiken
- C. Kritische Diskussion
- 1. Alles nur Pfadabhängigkeit und Politikverflechtung?
- 2. Relativierung des Parteienwettbewerbs
- 3. Vetospieler handeln auch strategisch
- D. Anforderungen an eine „machbare“ Föderalismusreform
- 1. Prinzipielle Voraussetzungen einer strukturellen Reform
- 1.1 Einbeziehung und Mobilisierung der Öffentlichkeit
- 1.2 Nicht bloß Anpassungsreformen
- 1.3 Abgesicherte sozio-ökonomische und kulturelle Vielfalt
- 1.4 Aufbrechen des Steuerverbundes
- 1.5 Überdenken der Kompetenzen des Bundesrates
- 1.6 Positive Nebenwirkungen von Reformen
- 2. Berücksichtigung der Komplexität des deutschen Bundesstaates
- Teil IV. Zusammenfassendes Fazit und Ausblick
- Analyse der ökonomischen Theorie des Föderalismus und des Rational-Choice-Ansatzes
- Bewertung der aktuellen Finanzverfassung Deutschlands und der Herausforderungen des kooperativen Föderalismus
- Untersuchung verschiedener Reformkonzepte, die eine Neuausrichtung des deutschen Föderalismus zum Ziel haben
- Bewertung der Machbarkeit von Wettbewerbsföderalismus im Kontext des deutschen Bundesstaates
- Identifizierung von institutionellen Widerstandspotenzialen und Blockademöglichkeiten für eine Föderalismusreform
- Teil I führt in die Thematik des Wettbewerbsföderalismus ein und erläutert die Methodik der Arbeit.
- Teil II analysiert die Praxis des deutschen Föderalismus, insbesondere die Finanzverfassung und die institutionelle Kooperation zwischen Bund und Ländern. Des Weiteren werden verschiedene Reformkonzepte aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft vorgestellt.
- Teil III befasst sich mit der Frage der Reformierbarkeit des deutschen Föderalismus.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob der Wettbewerbsföderalismus eine Reform-perspektive für den deutschen Bundesstaat bietet. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen des Wettbewerbsföderalismus, analysiert die praktische Umsetzung des kooperativen Föderalismus im Grundgesetz und beleuchtet Reformvorschläge aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Wettbewerbsföderalismus, kooperativer Föderalismus, Finanzverfassung, Grundgesetz, Reformkonzepte, Machbarkeit, institutionelle Widerstandspotenziale, Blockademöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Wettbewerbsföderalismus?
Wettbewerbsföderalismus basiert auf der ökonomischen Theorie des Föderalismus und zielt darauf ab, durch Wettbewerb zwischen den Gliedstaaten Effizienz und Innovation zu steigern.
Warum scheiterte die Föderalismusreform im Jahr 2004?
Hauptgrund war ein Kompetenzstreit zwischen Bund und Ländern über die Bildungspolitik.
Welche Rolle spielen "Vetospieler" im Reformprozess?
Institutionen wie der Bundesrat, das Bundesverfassungsgericht oder der Parteienwettbewerb können Reformen blockieren oder deren Umsetzung erschweren.
Was ist das Problem der "Politikverflechtungsfalle"?
Sie beschreibt eine Situation, in der notwendige Reformen durch die enge institutionelle Verflechtung und gegenseitige Abhängigkeit von Bund und Ländern verhindert werden.
Welche Reformvorschläge werden in der Arbeit diskutiert?
Diskutiert werden unter anderem die Steuerautonomie der Länder, die Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und die Neugestaltung des Länderfinanzausgleichs.
- Citar trabajo
- David Wolf (Autor), 2005, Wettbewerbsföderalismus als Reformperspektive? Lösungsvorschläge und Chancen einer Reform des deutschen Bundesstaates, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42792