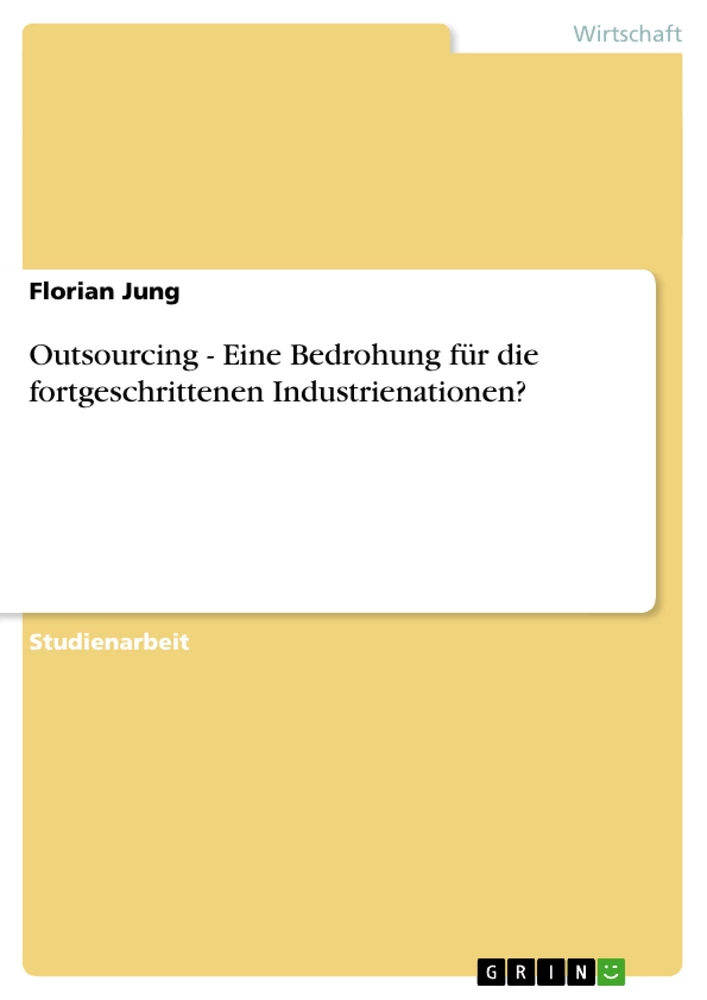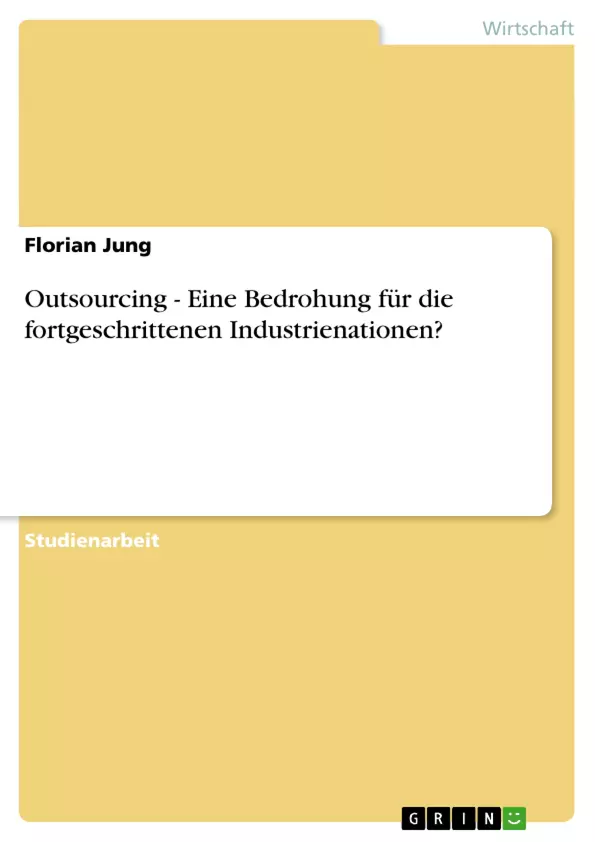Die Wellen der Entrüstung überschlugen sich in der amerikanischen Öffentlichkeit als der hoch angesehene Volkswirtschaftsprofessor und Vorsitzende des CEA Gregory Mankiw Outsourcing als „… probably a plus for the economy in the long-run“ einschätzte. John Kerry beschuldigte die Regierung daraufhin des vorsätzlichen Exportes amerikanischer Arbeitsplätze ins Ausland, und der zur Wahl des demokratischen Präsidentschaftskandidaten angetretene Senator John Edwards schlug gar vor, als erstes die Bush-Administration outzusourcen, wenn sie einem solchen Berater vertraue.
Der reinen Intuition folgend erscheinen die beiden letzten Aussagen leicht nachvollziehbar: Die Verlegung von Teilen der inländischen Wertschöpfungskette ins Ausland, gemeinhin als Outsourcing bezeichnet, zieht automatisch einen Export von Arbeitsplätzen nach sich, der im Sinne eines Nullsummenspiels zugleich einen Verlust eben solcher in der heimischen Volkswirtschaft bedeutet. Sofern die der Auslagerung vorangehenden unternehmensinternen Entscheidungen reinem Kostenminimierungskalkül folgen, ist die Fließrichtung dieses Stromes an Arbeitsplätzen auch eindeutig festgelegt – sie weist hinaus aus den fortgeschrittenen Industrienationen wie Amerika, Japan oder Deutschland hinein in die Niedriglohnländer Indien, China und Russland.
Angesichts dieses einfachen wie scheinbar plausiblen Gedankenganges erscheint es kaum überraschend, dass sich in einer repräsentativen Meinungsumfrage 69 % der Amerikaner davon überzeugt zeigten, dass Outsourcing der heimischen Wirtschaft eher schadet als nutzt. Doch wie weit trägt diese doch sehr laienhaft anmutende Intuition? Ist Outsourcing eine tatsächliche Bedrohung für den Wohlstand in den fortgeschrittenen Industrienationen? Diese Fragen zu beantworten ist Ziel der vorliegenden Arbeit. Zur Erreichung desselbigen ist es zunächst unabdinglich, den bislang verwendeten Begriff des Outsourcing zu präzisieren. Im Anschluss daran sollen die Auswirkungen von Outsourcing auf die Volkswirtschaft des „Arbeitsplätze auslagernden“ Landes mittels ausgewählter volkswirtschaftlicher Modelle untersucht werden. Diese theoretische Analyse soll durch eine empirische Bestandsaufnahme ergänzt werden, sodass abschließend eine umfassende Beantwortung der aufgeworfenen Fragen möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- II. Begriffsbestimmung
- 1. Abgrenzung nach außen
- 2. Abgrenzung nach innen
- III. Wirtschaftstheoretische Wohlfahrtswirkungen
- 1. Gemäß der Theorie des komparativen Vorteils
- 1.1 Modellierung
- 1.2 Wider die Vorteilhaftigkeit
- 1.3 Wider die Bedrohung
- 2. Innerhalb des Modells sektorspezifischer Faktoren
- 2.1 Modellierung
- 2.2 Der unmittelbare gesamtwirtschaftliche Vorteil
- 2.3 Der unmittelbare faktorspezifische Nachteil
- 2.4 Der mittelbare gesamtwirtschaftliche Nachteil
- 3. Gemäß der klassischen Außenhandelstheorie
- 3.1 Beschäftigungseffekt
- 3.2 Veränderungen der ToT
- 3.3 Schlussfolgerung
- IV. Empirische Wohlfahrtswirkungen
- 1. Beschäftigungseffekt
- 2. Gesamtwohlfahrtseffekt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Outsourcing eine Bedrohung für den Wohlstand in den fortgeschrittenen Industrienationen darstellt. Es werden zunächst verschiedene Konzepte von Outsourcing definiert und voneinander abgegrenzt. Anschließend werden die wirtschaftlichen Auswirkungen von Outsourcing anhand verschiedener theoretischer Modelle untersucht, darunter die Theorie des komparativen Vorteils und das Modell sektorspezifischer Faktoren. Darüber hinaus werden die Ergebnisse empirischer Untersuchungen betrachtet.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Outsourcing
- Theoretische Analyse der Wohlfahrtswirkungen von Outsourcing
- Empirische Untersuchung der Auswirkungen von Outsourcing auf Beschäftigung und Gesamtwohlfahrt
- Beurteilung der Bedrohungspotenziale von Outsourcing für die fortgeschrittenen Industrienationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Einführung
Diese Einleitung beleuchtet die aktuelle Debatte um Outsourcing und die damit verbundenen Bedenken hinsichtlich der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland. Es wird deutlich, dass eine umfassende Analyse des Themas erforderlich ist, um die komplexen Auswirkungen von Outsourcing zu verstehen.
- Kapitel II: Begriffsbestimmung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Abgrenzung des Begriffs Outsourcing. Es wird gezeigt, dass die gängige Verwendung des Begriffs oft unpräzise ist und verschiedene Formen von Arbeitsverlagerung umfasst. Es wird darauf hingewiesen, dass der Begriff Offshoring besser geeignet ist, um die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland zu beschreiben.
- Kapitel III: Wirtschaftstheoretische Wohlfahrtswirkungen
Dieses Kapitel untersucht die theoretischen Auswirkungen von Outsourcing auf die Wohlfahrt der Volkswirtschaft. Es werden verschiedene Modelle aus der Wirtschaftstheorie herangezogen, um die potenziellen Vor- und Nachteile von Outsourcing zu beleuchten.
- Kapitel IV: Empirische Wohlfahrtswirkungen
Dieses Kapitel analysiert die empirischen Auswirkungen von Outsourcing auf die Beschäftigung und die Gesamtwohlfahrt. Es werden Daten und Ergebnisse von empirischen Studien ausgewertet, um die tatsächlichen Folgen von Outsourcing zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die vorliegenden Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Outsourcing, insbesondere mit der Verlagerung von Produktionsaktivitäten und Arbeitsplätzen ins Ausland. Wichtige Themen sind die Definition und Abgrenzung des Begriffs, die theoretischen Auswirkungen auf die Wohlfahrt der Volkswirtschaft sowie empirische Untersuchungen zu den Beschäftigungseffekten und der Gesamtwohlfahrt. Schlüsselbegriffe sind: Offshoring, komparativer Vorteil, sektorspezifische Faktoren, Beschäftigung, Gesamtwohlfahrt, Terms of Trade.
Häufig gestellte Fragen
Ist Outsourcing eine Bedrohung für Arbeitsplätze in Industrienationen?
Die Arbeit untersucht, ob die Verlagerung von Wertschöpfungsketten ins Ausland zwangsläufig zu einem Wohlstandsverlust führt oder ob komparative Vorteile den heimischen Markt langfristig stärken.
Was ist der Unterschied zwischen Outsourcing und Offshoring?
Outsourcing bezeichnet die Auslagerung von Aufgaben an Dritte. Offshoring beschreibt spezifisch die Verlagerung von Aktivitäten ins Ausland, oft zur Kostenminimierung.
Was besagt die Theorie des komparativen Vorteils im Kontext von Outsourcing?
Laut dieser Theorie profitieren beide Länder vom Handel, wenn sie sich auf die Produktion von Gütern spezialisieren, bei denen sie relativ am effizientesten sind, auch wenn ein Land absolut in allem besser ist.
Welche negativen Effekte hat Outsourcing laut dem Modell sektorspezifischer Faktoren?
Es kann zu unmittelbaren faktorspezifischen Nachteilen kommen, wie z. B. Lohnkürzungen oder Arbeitslosigkeit in den Sektoren, die direkt von der Auslagerung betroffen sind.
Wie wirken sich Terms of Trade (ToT) auf Outsourcing aus?
Veränderungen im Preisverhältnis zwischen Export- und Importgütern können den Wohlstandseffekt von Outsourcing für die heimische Volkswirtschaft entweder verstärken oder dämpfen.
Was zeigen empirische Untersuchungen zum Beschäftigungseffekt?
Die Arbeit analysiert Daten, um festzustellen, ob der befürchtete massive Nettoverlust an Arbeitsplätzen in Industrienationen wie den USA oder Deutschland tatsächlich eingetreten ist.
- Quote paper
- Florian Jung (Author), 2005, Outsourcing - Eine Bedrohung für die fortgeschrittenen Industrienationen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/42795