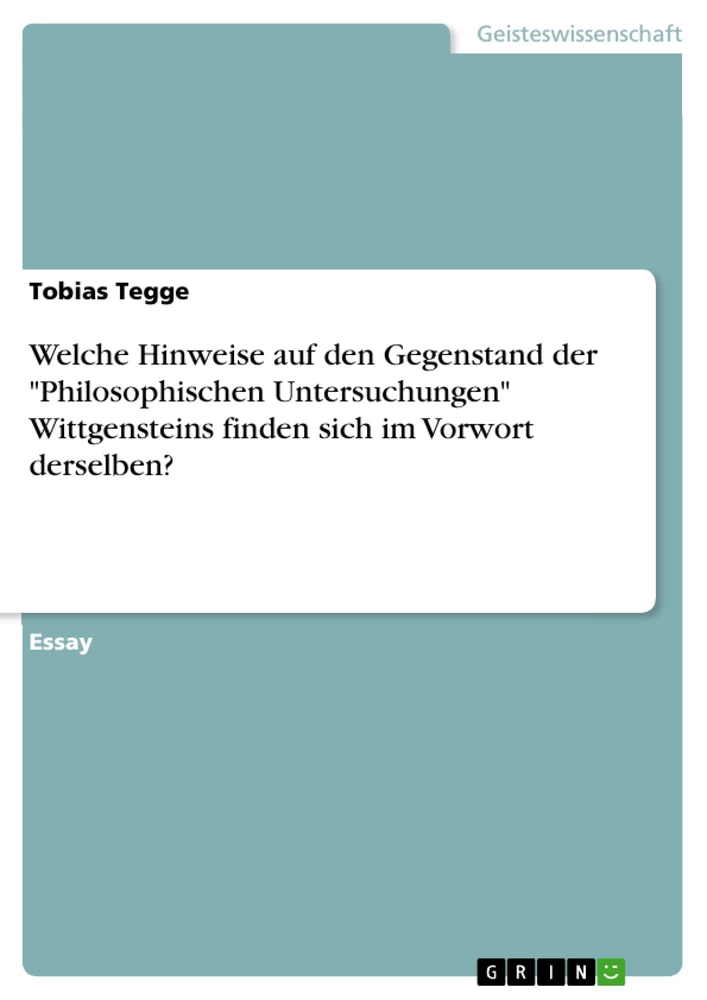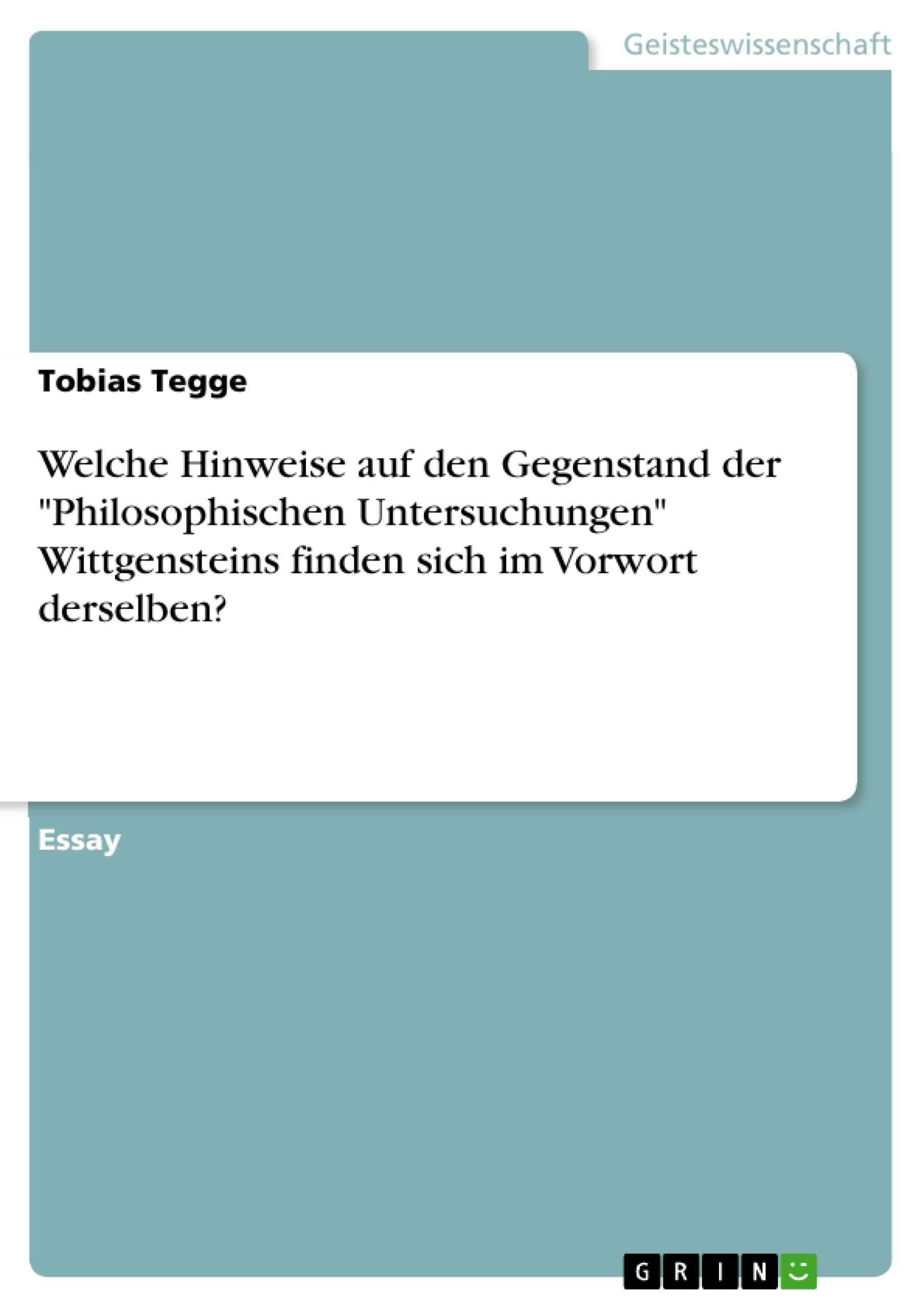Wittgensteins Philosophische Untersuchungen sind eine Reihe von „Bemerkungen“.1 Sie können aufeinanderfolgend einen bestimmten Themenbereich beleuchten, sind aber nicht in jedem Fall fortlaufend gemeint. Nicht selten endet eine dieser Bemerkungen in einer Reihe von Fragen (§§ 20, 80, 86, 388 zum Beispiel) oder einer Aufforderung (§§ 27, 72, 166, 167 wieder nur als Auswahl), die – dem Kontext entrissen – zum Denken anzuregen scheint.
Deshalb lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich das Werk als rätselhaft bezeichne. Den PU geht allerdings ein vom Autor selbst verfasstes Vorwort voran, das wertvolle Hinweise bietet, wenn wir voraussetzen, dass Wittgenstein tatsächlich etwas daran lag, verstanden zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Welche Hinweise auf den Gegenstand der ,,Philosophischen Untersuchungen\" Wittgensteins finden sich im Vorwort derselben?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Wittgensteins Vorwort zu seinen „Philosophischen Untersuchungen“ (PU) und versucht, die Ziele und Intentionen des Werks aus den darin geäußerten Aussagen zu erschließen. Der Autor betrachtet das Vorwort als wertvolle Quelle, um Wittgensteins Gedanken zum Schreiben der PU und die Bedeutung des Werks zu verstehen.
- Wittgensteins Intention, den Leser zum Nachdenken anzuregen und eigene Gedanken zu entwickeln
- Die Entstehung der PU als Ergebnis langjähriger philosophischer Untersuchungen und als Reaktion auf „schwere Irrtümer“ in Wittgensteins frühem Werk, den „Logisch-Philosophischen Abhandlungen“
- Die Bedeutung der Sprache und ihre Rolle im philosophischen Diskurs
- Die Struktur und Form der PU als Ausdruck der komplexen Gedanken und des assoziativen Denkens Wittgensteins
- Wittgensteins Abwendung von einer klassischen philosophischen Methode und die Hinwendung zu einer fragmentarischen und offenkundigen Art des Schreibens
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Der Text analysiert zunächst den Schluss des Vorworts, in dem Wittgenstein betont, dass die PU nicht dazu dienen sollen, „Andern das Denken [nicht] ersparen“, sondern „jemand zu eigenen Gedanken anregen“. Die PU sollen somit als Denkanstöße verstanden werden, die den Leser zu eigenen Überlegungen anregen.
- Kapitel 2: Im weiteren Verlauf des Textes wird die Entstehungsgeschichte der PU beleuchtet. Wittgenstein erklärt, dass er sich nach 16 Jahren erneut mit Philosophie beschäftigt hat und zu der Erkenntnis kam, dass seine „Logisch-Philosophischen Abhandlungen“ „schwere Irrtümer“ enthielten. Diese Erkenntnis hatte seine philosophische Entwicklung maßgeblich beeinflusst und zur Entstehung der PU geführt.
- Kapitel 3: Der Text untersucht die Struktur und Form der PU. Wittgenstein beschreibt seine Arbeitsweise als „ein Netz von aufeinander verweisenden Gedanken“, die aus verschiedenen Perspektiven auf ein Thema eingehen. Diese fragmentarische Form spiegelt den komplexen und assoziativen Charakter von Wittgensteins Denken wider.
- Kapitel 4: Der Autor erläutert die Besonderheit von Wittgensteins Schreibstil. Er verwendet metaphorische Sprache und vergleicht die PU mit „Landschaftsskizzen“, die während einer langen und verwickelten Reise entstanden sind. Diese Metapher soll den Leser auf den unkonventionellen Charakter des Werks aufmerksam machen.
Schlüsselwörter
Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Logisch-philosophische Abhandlungen, Sprache, Philosophie, Denkanstöße, Fragmentarität, assoziatives Denken, metaphorische Sprache, Struktur, Form, Interpretation, Abwendung von der klassischen Philosophie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel von Wittgensteins „Philosophischen Untersuchungen“?
Laut Vorwort möchte Wittgenstein den Leser nicht dazu bringen, seine Gedanken einfach zu übernehmen, sondern ihn dazu anregen, eigene Gedanken zu entwickeln.
Warum bezeichnet der Autor das Werk als rätselhaft?
Das Werk besteht aus einer Reihe von Bemerkungen, die nicht immer fortlaufend gemeint sind und oft in offenen Fragen oder Aufforderungen enden, die zum Nachdenken anregen.
Welche Rolle spielt Wittgensteins früheres Werk für die PU?
Die PU entstanden als Reaktion auf „schwere Irrtümer“, die Wittgenstein in seinem frühen Werk, den „Logisch-Philosophischen Abhandlungen“, erkannte.
Wie beschreibt Wittgenstein die Struktur seines Werkes?
Er beschreibt sie als ein „Netz von aufeinander verweisenden Gedanken“ und vergleicht das Buch metaphorisch mit „Landschaftsskizzen“ einer langen Reise.
Was verrät das Vorwort über Wittgensteins Schreibstil?
Es zeigt eine Abkehr von klassischen philosophischen Methoden hin zu einer fragmentarischen, assoziativen und metaphorischen Art des Schreibens.
- Arbeit zitieren
- Tobias Tegge (Autor:in), 2014, Welche Hinweise auf den Gegenstand der "Philosophischen Untersuchungen" Wittgensteins finden sich im Vorwort derselben?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428104