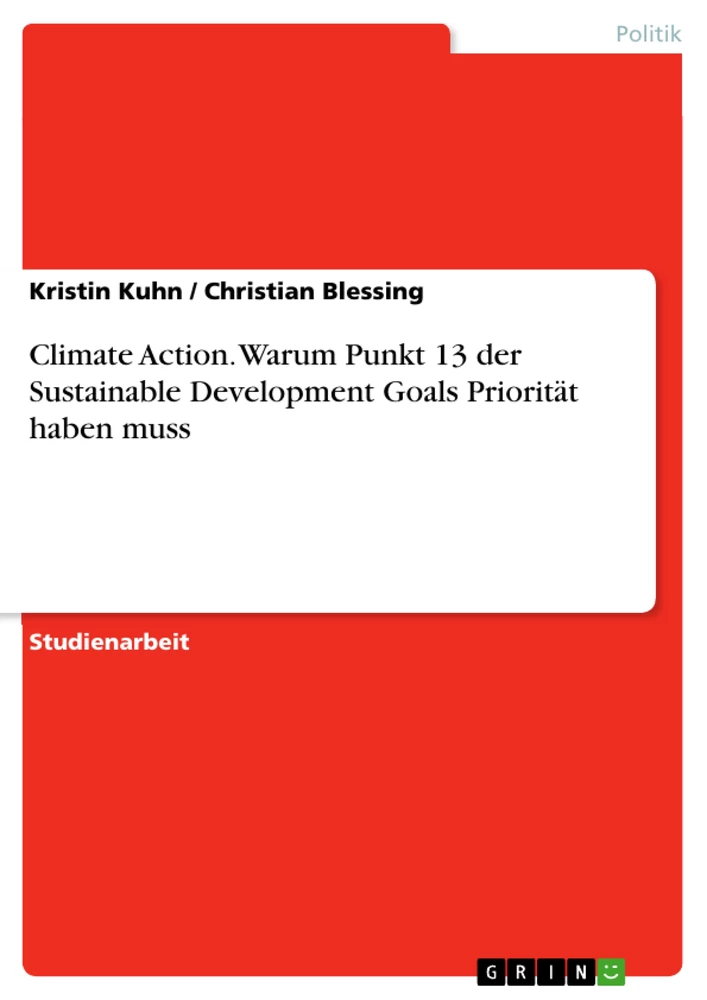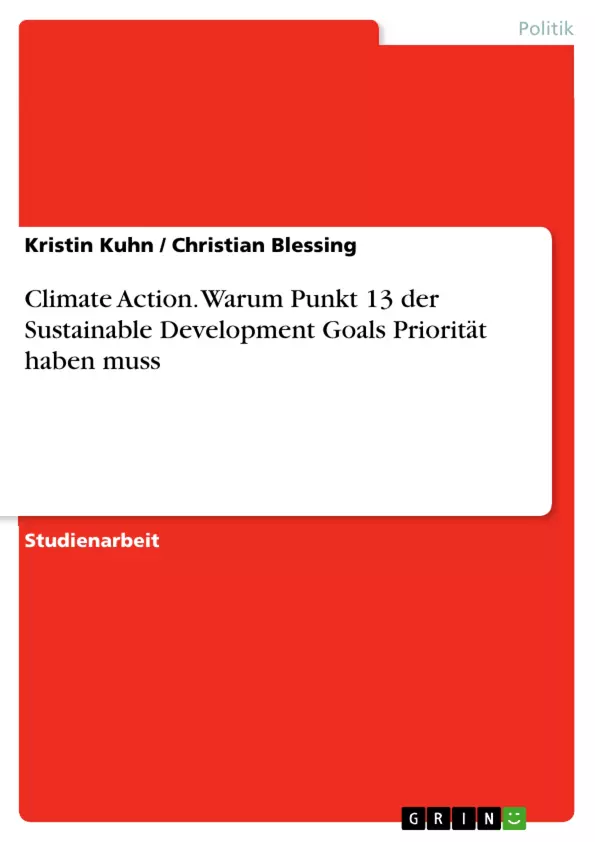Diese Ausarbeitung verfolgt das Ziel darzustellen, dass es von größter Bedeutung ist, den Klimawandel nicht weiter voranschreiten zu lassen. Hierbei wird als effektivster Ansatz proklamiert, die menschengemachte Erderwärmung an ihrer Wurzel, dem Ausstoß von Treibhausgasen, anzupacken. Kritik wird vorwiegend an den, von den Vereinten Nationen erstellten Millenium Development Goals (kurz MDGs) und den darauf aufbauenden Sustainable Development Goals (kurz SDGs), geübt, da beide den Klimaschutz, „ensure environmental sustainability“ (United Nations 2015) bzw. „climate action“ (United Nations 2018) als eine der letzten und somit am wenigsten priorisierten Ziele ansehen.
Zu Beginn der Arbeit müssen die Begriffe der Entwicklungszusammenarbeit und Klimaschutz definiert werden. Hierzu wird jeweils ein kurzer Überblick über die historische Entwicklung der Begrifflichkeiten gegeben. Anschließend werden sowohl die MDGs, als auch die SDGs auf ihren Anteil an klimapolitischen Zielsetzungen überprüft und in den zeitpolitischen Kontext gebracht. Im darauffolgenden Kapitel wird sich exemplarisch mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Bewohner der Entwicklungsländer auseinandergesetzt, sodass im letzten, abschließenden Teil ein Fazit gezogen werden kann und ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Two birds with one stone? – Ergänzen sich Klimaschutz und Entwicklungszusammenarbeit?
- Domination, relation, cooperation? - Von dem paternalistisch angehauchten Begriff der Entwicklungshilfe hin zur neutraleren Bezeichnung der Entwicklungszusammenarbeit
- Climate change and development policy - Wie hängen Klimaschutz und Entwicklungspolitik zusammen?
- How bad is climate change? - Eine Darstellung des öffentlichen Diskurses zum Klimawandel
- What we empirically know about the climate change – wissenschaftliche Fakten zum Klimawandel
- How environmental policy deals with climate change – Antworten der internationalen Politik auf die drohende Gefahr des Klimawandels
- Climate change and development policy – Wie hängen Klimaschutz und Entwicklungspolitik zusammen?
- We can end poverty by achieving 17 goals to transform our world - Entwicklungspolitik im Rahmen der MDGs und SDGs
- Ensure environmental sustainability through climate action - Klimapolitik im Rahmen der MDGs und SDGs
- Two birds with one stone? – Ja, aber Punkt 13 der Sustainable Development Goals, climate action, sollte eigentlich Priorität haben
- What happens in the future? – Ein Ausblick auf die Realisierung der klimapolitischen Ziele in den SDGs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Bedeutung des Klimaschutzes im Kontext der internationalen Entwicklungspolitik. Sie argumentiert, dass der Klimaschutz als wichtiger Bestandteil der Sustainable Development Goals (SDGs) priorisiert werden sollte und nicht nur ein ergänzendes Ziel darstellt. Die Arbeit beleuchtet die historischen Entwicklungen der Begriffe Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit sowie die Herausforderungen, die der Klimawandel für Entwicklungsländer mit sich bringt.
- Die Bedeutung des Klimaschutzes im Kontext der internationalen Entwicklungspolitik
- Die historische Entwicklung der Begriffe Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit
- Die Auswirkungen des Klimawandels auf Entwicklungsländer
- Die Rolle der Sustainable Development Goals (SDGs) im Kampf gegen den Klimawandel
- Die Bedeutung einer globalen Zusammenarbeit im Klimaschutz
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die enge Verbindung zwischen Klimaschutz und Entwicklungszusammenarbeit und argumentiert, dass beide Themenbereiche untrennbar miteinander verbunden sind. Es wird dargelegt, dass der Klimawandel Entwicklungsländer besonders stark betrifft und die Notwendigkeit für eine gemeinsame Lösung auf internationaler Ebene betont.
- Im zweiten Kapitel wird die historische Entwicklung der Begriffe Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit dargestellt. Es werden kritische Punkte hinsichtlich der paternalistischen Konnotation des Begriffs "Entwicklungshilfe" beleuchtet und die Bedeutung des Begriffs "Entwicklungszusammenarbeit" für eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Geber- und Nehmerländern hervorgehoben.
- Das dritte Kapitel untersucht die Beziehung zwischen Klimaschutz und Entwicklungspolitik im Detail. Es beleuchtet die Folgen des Klimawandels für Entwicklungsländer und diskutiert verschiedene Ansätze der internationalen Politik zur Bewältigung der Herausforderungen.
- Das vierte Kapitel analysiert die Rolle der MDGs und SDGs im Kampf gegen den Klimawandel. Es wird herausgestellt, dass beide Entwicklungsziele den Klimaschutz als einen der wichtigsten Punkte ansehen und die Notwendigkeit einer verstärkten Klimapolitik im Rahmen der SDGs betont.
- Das fünfte Kapitel argumentiert, dass der Klimaschutz eine höhere Priorität innerhalb der Sustainable Development Goals erhalten sollte. Es wird betont, dass ein effektiver Klimaschutz entscheidend für die nachhaltige Entwicklung der Welt ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit setzt sich mit den Themen Klimaschutz, Entwicklungszusammenarbeit, Sustainable Development Goals (SDGs), Klimawandel, Entwicklungspolitik und globaler Zusammenarbeit auseinander. Dabei stehen die Herausforderungen und Chancen im Kampf gegen den Klimawandel im Vordergrund, besonders im Kontext der Entwicklungsländer.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Punkt 13 der SDGs?
Punkt 13 ("Climate Action") fordert umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen.
Warum wird die Priorisierung der SDGs kritisiert?
Die Arbeit kritisiert, dass Klimaschutz oft als eines der letzten Ziele gelistet wird, obwohl er die Grundlage für das Erreichen fast aller anderen Entwicklungsziele ist.
Wie hängen Entwicklungszusammenarbeit und Klimaschutz zusammen?
Entwicklungsländer leiden am stärksten unter dem Klimawandel. Ohne effektiven Klimaschutz sind Fortschritte in der Armutsbekämpfung gefährdet.
Was ist der Unterschied zwischen Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit?
Der Begriff Entwicklungszusammenarbeit betont eine gleichberechtigte Partnerschaft, während "Hilfe" oft als paternalistisch wahrgenommen wird.
Welche wissenschaftlichen Fakten werden zum Klimawandel angeführt?
Die Arbeit stützt sich auf empirische Daten zur menschengemachten Erderwärmung durch den Ausstoß von Treibhausgasen.
- Quote paper
- Kristin Kuhn (Author), Christian Blessing (Author), 2018, Climate Action. Warum Punkt 13 der Sustainable Development Goals Priorität haben muss, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/428218